Thema: Filmtagebuch
06. November 14 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen beim Perlentaucher)
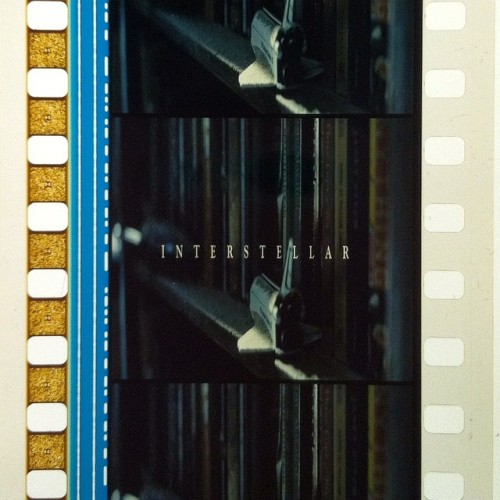
(via)
Die Zukunft ist eine Sache der Vergangenheit. Zumindest der Fluchtpunkt, der mal als Zukunft verstanden und verhandelt wurde. Folgt man dem Popjournalisten Simon Reynols (in "Retromania") oder dem Kulturtheoretiker Mark Fisher (in "Ghosts of my Life", ein Auszug) lautet so der zeitdiagnostische Befund unserer Tage. Demnach hat Pop als einstmals zentrale Schubkraft nicht nur seine "Nowness" verloren, sondern auch seine aufsprengende Kraft, aus der Gegenwart heraus einen verheißungsvollen Möglichkeitsraum für Künftiges zu skizzieren. Stattdessen: Nostalgie und Depression, Archivierung und Musealisierung. Das große utopische Narrativ unserer Zeit: Zurück zum Wohlfahrtsstaat, zurück in die gute alte Zeit, als immerhin noch Aussicht auf Aufbruch bestand.

Mit seinem neuen Epos "Interstellar" knüpft Christopher Nolan daran nun in mehrfacher Hinsicht an. Zum einen, da Nolan - ganz Klassizist und neben Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson der hartnäckigste prominente Fürsprecher klassischen Filmträgermaterials - seinen Griff nach den Sternen bewusst auf 35- und 65mm-Material gedreht hat, also mittels einer bereits als obsolet eingeschätzten Technik, und überdies zumindest in den USA für die Kinoauswertung eine erkleckliche Anzahl 70mm-Prints durchsetzen konnte (in Europa kursieren immerhin vier solcher Kopien, eine davon zeigt der Berliner Zoo-Palast).
Zum anderen, da Nolan auch ästhetisch das Raum-Zeit-Kontinuum wenigstens der Filmgeschichte im Sinn von "zurück zum Aufbruch" auf Vergangenheit umbiegt: Hauptsächlich in klassischen, schön auf abgenutzt gestalteten Sets und mit Miniatur- und Kameratricks unter Verzicht auf CGI gedreht (freilich, für schwarze Löcher und andere Aufsehen erregende Space-Madness nutzt er die Digitaltechnik unter größtmöglichem, aber produktivem Aufwand), orientiert sich "Interstellar" in vielerlei Hinsicht an Stanley Kubricks "2001: A Space Odyssey", dem großen Monolithen der filmischen Science Fiction, und dessen noch vor dem Erfolg der Apollo-Missionen geleisteten Versprechen, ein Weltall-Setting zunächst in aufregender ästhetischer Glaubwürdigkeit zu vermitteln, um sich schließlich kopfüber in den Psychedelic-Rausch des Hyperraums zu stürzen. Kurz vor der Mondlandung war dieser Ausblick in die Schwärze des Alls tatsächlich raumgreifend. Vielleicht braucht es heute, da Raumstationen und Space-Shuttle-Missionen gerade mal am Rand unserer Atmosphäre kratzen, wieder so einen Film.
Doch Nolan erzählt in seinem Film auch von einer umfassend ermatteten Welt, der jegliche Perspektive auf die Zukunft abhanden gekommen ist: Die USA - ein einziger, buchstäblicher Dust Bowl - ist nach klimatischen Verheerungen auf das Niveau einer Farmer-Nation zurückgefallen, Sandstürme bestimmen den Alltag, weite Teile des Ernteertrags werden von Schädlingen und Pilzbefall zunichte gemacht: Drohende Hungersnöte gehören zum Alltag. Eine Welt wie aus den Depressionsjahren der 30er - ausgebildet werden Bauern, an Ingenieuren gibt es keinen Bedarf. Um erst gar keine Aspirationen unter den Kindern aufkommen zu lassen, lehren die Schulbücher, dass es die Mondlandung nie gegeben habe, sondern ein strategisches Fake-Manöver war, um die Sowjetunion in einen selbstzerstörerischen Innovationszugzwang zu verstricken. Nicht zuletzt droht der Menschheit der Erstickungstod. Was die Zukunft einst hätte sein können, schlummert als verstaubte Erinnerungsspur in alten, nicht mehr aufgeschlagenen Büchern.

Für Cooper (Matthew McConaughey), ein einstiges, heute zum Farmer-Dasein gezwungenes Piloten-Ass, die trübsinnigste aller denkbaren Welten: "Früher haben wir am Himmel unseren Platz im Universum gesucht, heute blicken wir auf den Boden und suchen unseren Platz im Schmutz", sinniert er an einer Stelle. Immerhin im Kleinen stellt er sich gegen die zwangsverordnete Depression: Das wenige, was er seinen Kindern an Neugier auf die Welt und Lust an der Wissenschaft vermitteln kann, vermittelt er ihnen mit sichtlichem Enthusiasmus. Und stößt dabei, nach sonderbaren Botschaften eines "Geists", zu dem seine Tochter Murph (Mackenzie Foy) Kontakt haben will, auf eine vor den Augen der Öffentlichkeit versteckte Dependance der NASA, die unter der Anleitung von Professor Brand (Michael Caine) im Verborgenen einen Masterplan zur Umsiedelung auf einen fernen Planeten vermittels eines - von außerirdischen Intelligenzen? - beim Saturn platzierten Wurmlochs ausheckt und in Cooper den für diese Mission idealen Piloten sieht. Der steht nun vor einem Dilemma: Gemäß der Relativitätstheorie würden für ihn bei dieser Reise nur wenige Jahre vergehen - während die Zeit auf der Erde dramatisch schneller verlaufen würde. Nicht nur gilt es, dem Untergang der Menschheit zuvor zu kommen - auch die Möglichkeit eines Wiedersehens mit der geliebten Tochter steht auf dem Spiel.
Raum und Zeit - nur konsequent, dass sich Christopher Nolan in seinem technisch bisher avanciertesten Film der grundlegenden Koordinaten des menschlichen Daseins nun auch in kosmologischer Hinsicht annimmt. Ob in "Memento" oder "Inception", die Frage nach deren zwangsläufiger Linearität stellte schon frühzeitig eine Konstante in seinem Schaffen dar - und stets verstand dieser virtuose Technokrat des Kinos die Montierbarkeit von Film als eine Möglichkeit zur Aufsprengung, die Raum und Zeit als wachsweiche Verfügungs- und Gestaltungsmasse erschließt. Ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so verrätselt wie in "Memento" oder "Inception" (dass "Interstellar" einst für Spielberg konzipiert wurde, ist dem Film in Spuren noch immer anzusehen), funktioniert auch "Interstellar": Raum und Zeit werden hyper-dimensional aufgegliedert und auf dem Gerüst der Liebe zwischen einem Vater und einer Tochter zum interstellaren Erzählgefüge aufgespannt. Insbesondere in der erzählerischen Schlusspointe kulminiert dies in die reizvolle Visualisierung eines Raums jenseits des Raums, einer Zeit jenseits der Zeit.

Toll ist auch - neben der emotional ergreifenden Geschichte zwischen Vater und Tochter, die man dem ansonsten eher als kühl verschrieenen Erzähler kaum zugetraut hätte -, wie es Nolan gelingt, nicht nur die Ästhetik historischen NASA-Filmmaterials, sondern auch die in der Science-Fiction eher abgelegten Tropen von Pioniergeist und Weltentdeckertum mit den Mitteln der Kino-Großentwürfe des Genres für eine zukunftsenthusiastische Form wieder urbar zu machen - sogar die Roboter wirken wieder so herzig wie in der naiven SF der 50er Jahre und strahlen dennoch nichts als "Nowness" aus. Nolan hängt zwar einem alten, längst melancholisch beiseite gelegten Traum von der Rettung der Welt durch hartnäckige Ingenieurswissenschaft nach - doch dessen Utopie rückt er mit seinen brillanten 70mm-Bildern (und nicht zuletzt dem schönen emotionalen, verwundbaren Schmalz) zum Greifen nahe vors Auge.
Nicht zuletzt legt Nolan im Feld des Blockbusters einen schönen Raum-Zeit-Spagat hin. Neigt insbesondere der Superhelden-Blockbuster der heutigen Zeit zum vollgestellten Wuselbild aus dem Computer, schwelgt Nolan in majestätisch leeren, dafür aber umso luxuriöser produzierten Bildern: Wenn die Raumstation - wie es sich gehört: lautlos - am Saturn vorbei zieht, entwickelt die Schlichtheit des Bildes Erhabenheit. Wenn auf einem fernen Planeten ein Tsunami von kosmischen Ausmaßen dem gestrandeten Raumschiff entgegenbrandet, ist das zwar nichts im Vergleich zu den urbanen Kataklysmen aus den Marvel-Filmen, doch in seiner existenzialistischen Komponente allemal dringlicher und effektiver. Und die fernen Planeten, die zu erkunden sind? Der eine ist eine Wasserwelt - eine kleine Hommage an Lems "Solaris" -, der andere eine in Island fotografierte Gletscherwelt. Unter den Bedingungen von 70mm sind beide aufregender anzusehen als jeder heranklotzende Strampelhosen-Superheldenfilm.
Zwar konnte Kubrick noch minutenlang in aller Stille durchs All driften, während bei Nolan die Einstellungsdauer wesentlich kürzer ist, doch zeigt sich auch hier die melancholische Trauer um abhanden gekommene Formen, die Nolan dafür mit umso hartnäckigerer Insistenz zurück ins Hier und Jetzt holt. Von hier aus mag es schließlich - das ist am Ende das Schönste an diesem trotz aller Wucht erstaunlich zärtlichen Film - weitergehen.
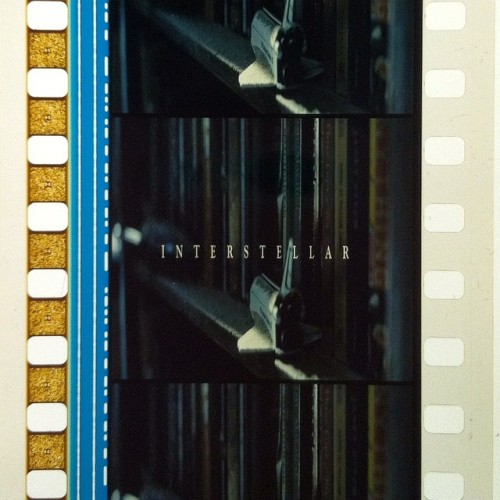
(via)
Die Zukunft ist eine Sache der Vergangenheit. Zumindest der Fluchtpunkt, der mal als Zukunft verstanden und verhandelt wurde. Folgt man dem Popjournalisten Simon Reynols (in "Retromania") oder dem Kulturtheoretiker Mark Fisher (in "Ghosts of my Life", ein Auszug) lautet so der zeitdiagnostische Befund unserer Tage. Demnach hat Pop als einstmals zentrale Schubkraft nicht nur seine "Nowness" verloren, sondern auch seine aufsprengende Kraft, aus der Gegenwart heraus einen verheißungsvollen Möglichkeitsraum für Künftiges zu skizzieren. Stattdessen: Nostalgie und Depression, Archivierung und Musealisierung. Das große utopische Narrativ unserer Zeit: Zurück zum Wohlfahrtsstaat, zurück in die gute alte Zeit, als immerhin noch Aussicht auf Aufbruch bestand.

Mit seinem neuen Epos "Interstellar" knüpft Christopher Nolan daran nun in mehrfacher Hinsicht an. Zum einen, da Nolan - ganz Klassizist und neben Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson der hartnäckigste prominente Fürsprecher klassischen Filmträgermaterials - seinen Griff nach den Sternen bewusst auf 35- und 65mm-Material gedreht hat, also mittels einer bereits als obsolet eingeschätzten Technik, und überdies zumindest in den USA für die Kinoauswertung eine erkleckliche Anzahl 70mm-Prints durchsetzen konnte (in Europa kursieren immerhin vier solcher Kopien, eine davon zeigt der Berliner Zoo-Palast).
Zum anderen, da Nolan auch ästhetisch das Raum-Zeit-Kontinuum wenigstens der Filmgeschichte im Sinn von "zurück zum Aufbruch" auf Vergangenheit umbiegt: Hauptsächlich in klassischen, schön auf abgenutzt gestalteten Sets und mit Miniatur- und Kameratricks unter Verzicht auf CGI gedreht (freilich, für schwarze Löcher und andere Aufsehen erregende Space-Madness nutzt er die Digitaltechnik unter größtmöglichem, aber produktivem Aufwand), orientiert sich "Interstellar" in vielerlei Hinsicht an Stanley Kubricks "2001: A Space Odyssey", dem großen Monolithen der filmischen Science Fiction, und dessen noch vor dem Erfolg der Apollo-Missionen geleisteten Versprechen, ein Weltall-Setting zunächst in aufregender ästhetischer Glaubwürdigkeit zu vermitteln, um sich schließlich kopfüber in den Psychedelic-Rausch des Hyperraums zu stürzen. Kurz vor der Mondlandung war dieser Ausblick in die Schwärze des Alls tatsächlich raumgreifend. Vielleicht braucht es heute, da Raumstationen und Space-Shuttle-Missionen gerade mal am Rand unserer Atmosphäre kratzen, wieder so einen Film.
Doch Nolan erzählt in seinem Film auch von einer umfassend ermatteten Welt, der jegliche Perspektive auf die Zukunft abhanden gekommen ist: Die USA - ein einziger, buchstäblicher Dust Bowl - ist nach klimatischen Verheerungen auf das Niveau einer Farmer-Nation zurückgefallen, Sandstürme bestimmen den Alltag, weite Teile des Ernteertrags werden von Schädlingen und Pilzbefall zunichte gemacht: Drohende Hungersnöte gehören zum Alltag. Eine Welt wie aus den Depressionsjahren der 30er - ausgebildet werden Bauern, an Ingenieuren gibt es keinen Bedarf. Um erst gar keine Aspirationen unter den Kindern aufkommen zu lassen, lehren die Schulbücher, dass es die Mondlandung nie gegeben habe, sondern ein strategisches Fake-Manöver war, um die Sowjetunion in einen selbstzerstörerischen Innovationszugzwang zu verstricken. Nicht zuletzt droht der Menschheit der Erstickungstod. Was die Zukunft einst hätte sein können, schlummert als verstaubte Erinnerungsspur in alten, nicht mehr aufgeschlagenen Büchern.

Für Cooper (Matthew McConaughey), ein einstiges, heute zum Farmer-Dasein gezwungenes Piloten-Ass, die trübsinnigste aller denkbaren Welten: "Früher haben wir am Himmel unseren Platz im Universum gesucht, heute blicken wir auf den Boden und suchen unseren Platz im Schmutz", sinniert er an einer Stelle. Immerhin im Kleinen stellt er sich gegen die zwangsverordnete Depression: Das wenige, was er seinen Kindern an Neugier auf die Welt und Lust an der Wissenschaft vermitteln kann, vermittelt er ihnen mit sichtlichem Enthusiasmus. Und stößt dabei, nach sonderbaren Botschaften eines "Geists", zu dem seine Tochter Murph (Mackenzie Foy) Kontakt haben will, auf eine vor den Augen der Öffentlichkeit versteckte Dependance der NASA, die unter der Anleitung von Professor Brand (Michael Caine) im Verborgenen einen Masterplan zur Umsiedelung auf einen fernen Planeten vermittels eines - von außerirdischen Intelligenzen? - beim Saturn platzierten Wurmlochs ausheckt und in Cooper den für diese Mission idealen Piloten sieht. Der steht nun vor einem Dilemma: Gemäß der Relativitätstheorie würden für ihn bei dieser Reise nur wenige Jahre vergehen - während die Zeit auf der Erde dramatisch schneller verlaufen würde. Nicht nur gilt es, dem Untergang der Menschheit zuvor zu kommen - auch die Möglichkeit eines Wiedersehens mit der geliebten Tochter steht auf dem Spiel.
Raum und Zeit - nur konsequent, dass sich Christopher Nolan in seinem technisch bisher avanciertesten Film der grundlegenden Koordinaten des menschlichen Daseins nun auch in kosmologischer Hinsicht annimmt. Ob in "Memento" oder "Inception", die Frage nach deren zwangsläufiger Linearität stellte schon frühzeitig eine Konstante in seinem Schaffen dar - und stets verstand dieser virtuose Technokrat des Kinos die Montierbarkeit von Film als eine Möglichkeit zur Aufsprengung, die Raum und Zeit als wachsweiche Verfügungs- und Gestaltungsmasse erschließt. Ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so verrätselt wie in "Memento" oder "Inception" (dass "Interstellar" einst für Spielberg konzipiert wurde, ist dem Film in Spuren noch immer anzusehen), funktioniert auch "Interstellar": Raum und Zeit werden hyper-dimensional aufgegliedert und auf dem Gerüst der Liebe zwischen einem Vater und einer Tochter zum interstellaren Erzählgefüge aufgespannt. Insbesondere in der erzählerischen Schlusspointe kulminiert dies in die reizvolle Visualisierung eines Raums jenseits des Raums, einer Zeit jenseits der Zeit.

Toll ist auch - neben der emotional ergreifenden Geschichte zwischen Vater und Tochter, die man dem ansonsten eher als kühl verschrieenen Erzähler kaum zugetraut hätte -, wie es Nolan gelingt, nicht nur die Ästhetik historischen NASA-Filmmaterials, sondern auch die in der Science-Fiction eher abgelegten Tropen von Pioniergeist und Weltentdeckertum mit den Mitteln der Kino-Großentwürfe des Genres für eine zukunftsenthusiastische Form wieder urbar zu machen - sogar die Roboter wirken wieder so herzig wie in der naiven SF der 50er Jahre und strahlen dennoch nichts als "Nowness" aus. Nolan hängt zwar einem alten, längst melancholisch beiseite gelegten Traum von der Rettung der Welt durch hartnäckige Ingenieurswissenschaft nach - doch dessen Utopie rückt er mit seinen brillanten 70mm-Bildern (und nicht zuletzt dem schönen emotionalen, verwundbaren Schmalz) zum Greifen nahe vors Auge.
Nicht zuletzt legt Nolan im Feld des Blockbusters einen schönen Raum-Zeit-Spagat hin. Neigt insbesondere der Superhelden-Blockbuster der heutigen Zeit zum vollgestellten Wuselbild aus dem Computer, schwelgt Nolan in majestätisch leeren, dafür aber umso luxuriöser produzierten Bildern: Wenn die Raumstation - wie es sich gehört: lautlos - am Saturn vorbei zieht, entwickelt die Schlichtheit des Bildes Erhabenheit. Wenn auf einem fernen Planeten ein Tsunami von kosmischen Ausmaßen dem gestrandeten Raumschiff entgegenbrandet, ist das zwar nichts im Vergleich zu den urbanen Kataklysmen aus den Marvel-Filmen, doch in seiner existenzialistischen Komponente allemal dringlicher und effektiver. Und die fernen Planeten, die zu erkunden sind? Der eine ist eine Wasserwelt - eine kleine Hommage an Lems "Solaris" -, der andere eine in Island fotografierte Gletscherwelt. Unter den Bedingungen von 70mm sind beide aufregender anzusehen als jeder heranklotzende Strampelhosen-Superheldenfilm.
Zwar konnte Kubrick noch minutenlang in aller Stille durchs All driften, während bei Nolan die Einstellungsdauer wesentlich kürzer ist, doch zeigt sich auch hier die melancholische Trauer um abhanden gekommene Formen, die Nolan dafür mit umso hartnäckigerer Insistenz zurück ins Hier und Jetzt holt. Von hier aus mag es schließlich - das ist am Ende das Schönste an diesem trotz aller Wucht erstaunlich zärtlichen Film - weitergehen.
° ° °
kommentare dazu:
...bereits 7067 x gelesen