Thema: Filmtagebuch
schon vor einiger Zeit, Hackesche Höfe
Ist nun schon eine Weile her und eigentlich müsste man zu diesem (schönen) Film wirklich viel schreiben. Das erlaubt mir wohl meine Zeit (ein bisschen auch gerade meine Schreib-Unlust) nicht, aber so ganz unerwähnt will ich den Film dennoch nicht lassen. Also nur ein paar Noten, die mich wer weiß wohin führen.
Er war nämlich wirklich sehr groß, ja großartig. Wobei man vielleicht schon ein Freund der Filme von Werner Herzog sein muss, um das nachzuempfinden. Alle anderen werden kopfschüttelnd von dannen ziehen, aber so war das bei Herzog wohl schon immer.
 Nach dem etwas orientierungslos geratenen Rad der Zeit ist The White Diamond nichts anderes als eine Rückkehr zu den besten Zeiten Herzogs. In der Wahl seines Sujets zeigt er sich, wie gewohnt, treffsicher, auch bezüglich der Positionierung desselben in sein eigenes Werk (Herzog meinte ja mal, er drehe eigentlich nicht immer den selben Film, sondern eigentlich einen einzigen großen Film und er würde diesen gerne mal aus allen seinen Filmen zusammensetzen: Mit The White Diamond ist er an dieser Aussage verdammt nahe dran.). Zum Teil fügt sich die Thematik - ein Aero-Wissenschaftler baut einen Mini-Zeppelin, um das Dach des Regenwaldes mit Kameras zu untersuchen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein vergleichbarer Vorstoß vor vielen Jahren seinem Freund, ein Dokumentarfilmer, das Leben gekostet hatte - schon so nahtlos in den Herzog-Kosmos ein, dass man bisweilen zweifelt, ob das Ganze nicht insgesamt ein Spielfilm mit Drehbuch ist (ein Drehbuch, das vielleicht im Scherz Little Werner needs to fly genannt wurde, den es geht um genau das: Das kindliche Staunen, das Wissenschaft, Fliegerei und Cinephilie zugrunde liegt und in diesem Film ist Werner Herzog es selbst vor allem, auf den das alles zutrifft).
Nach dem etwas orientierungslos geratenen Rad der Zeit ist The White Diamond nichts anderes als eine Rückkehr zu den besten Zeiten Herzogs. In der Wahl seines Sujets zeigt er sich, wie gewohnt, treffsicher, auch bezüglich der Positionierung desselben in sein eigenes Werk (Herzog meinte ja mal, er drehe eigentlich nicht immer den selben Film, sondern eigentlich einen einzigen großen Film und er würde diesen gerne mal aus allen seinen Filmen zusammensetzen: Mit The White Diamond ist er an dieser Aussage verdammt nahe dran.). Zum Teil fügt sich die Thematik - ein Aero-Wissenschaftler baut einen Mini-Zeppelin, um das Dach des Regenwaldes mit Kameras zu untersuchen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein vergleichbarer Vorstoß vor vielen Jahren seinem Freund, ein Dokumentarfilmer, das Leben gekostet hatte - schon so nahtlos in den Herzog-Kosmos ein, dass man bisweilen zweifelt, ob das Ganze nicht insgesamt ein Spielfilm mit Drehbuch ist (ein Drehbuch, das vielleicht im Scherz Little Werner needs to fly genannt wurde, den es geht um genau das: Das kindliche Staunen, das Wissenschaft, Fliegerei und Cinephilie zugrunde liegt und in diesem Film ist Werner Herzog es selbst vor allem, auf den das alles zutrifft).
Es finden sich die starken Bilder aus Herzogs Spielfilmen und dokumentarischen Arbeiten wieder, in immer neuen Kontexten, oft schon als Zitationen, als Verweise innerhalb des eigenen Werkes. Dass dem Wissenschaftler, dessen kindliches Staunen über die Welt der Aerodynamik sich, durch Herzogs Kameraauge betrachtet, 1:1 übertragt, einige Finger an der Hand fehlen, dass er, wie Reinhold Messner in Gasherbrom, an einigen Stellen in Tränen ausbricht, ist für den Kenner nur erwartbar gewesen. Gleichzeitig weiß Herzog aber darum: The White Diamond ist, bei aller Ernsthaftigkeit, von einem subtilen Witz durchzogen, einer altersweisen Ironie, die sich nie konkret in den Vordergrund schiebt, aber stets im Hintergrund erahnbar bleibt.
Natürlich geht es, wie immer bei Herzog, vor allem auch um Bildproduktion. Das ganze Projekt - Kameras aus der Luft in die Dachkrone des Regenwalds, einer der letzten Sphären des Unbekannten unserer heutigen Tage, vergleichbar vielleicht mit dem Grund des Meers zu Beginn des 19. Jahrhunderts - ist davon getragen, Dinge sichtbar zu machen. Folgerichtig lässt Herzog The White Diamond mit Bildern aus der Frühzei der Filmgeschichte beginnen, die die Geschichte der Fliegerei verdeutlichen sollen. Die ersten Antriebe aber, überhaupt so etwas wie Film zu erdenken, entstanden aus der Problematik mangelnder Sichtbarkeit: Eadweard Muybridge ging Mitte des 19. Jahrhunderts eine Wette ein, ob das Pferd beim Galopp alle Hufe gleichzeitig in der Luft habe. Eine Anordnung von 24 Fotokameras, die mit Fäden ausgelöst werden konnten, ergaben schließlich einen parzellierten, fotografischen Bewegungsablauf. Das war noch nicht Kino, aber schon nicht mehr weit weg. An einer Stelle sagt Herzog in White Diamond: "In Celluloid we trust!" - und er erhebt sich in die Lüfte, um Bilder zu machen, die noch nie zuvor gesehen wurden.
An einer anderen Stelle wird hinter einen mächtigen Wasserfall geblickt. Hinter diesen verschwinden Millionen von Vögeln, die dort offenbar nisten. In der Legendenwelt der Dschungelbevölkerung verbirgt sich hier eine wunderbare Welt. Aus Respekt vor dieser Legende zeigt Herzog die Aufnahmen von hinter dem tosenden Wasser nicht. Herzog ist noch immer Anwalt der Verschiedenartigkeit der weltweiten Kulturen und er ist noch immer auf der Suche nach Bildern. Es ist schon gar nicht mehr nötig, sie zu zeigen. Ferner ist es der Traum einer aufgeklärten Wissenschaft, einer Wissenschaft, die aus dem 19. Jahrhundert herrührt, aus dem in die Ferne streifen, Werner Herzog eigentlich als Abenteurerfigur, die in die Peripherie streift, mit dem heutigen Wissen aber verbunden, dass es vor allem Demut vor dem, was vorgefunden wird, sein sollte, die das Handeln bestimmt. Ein vielleicht etwas naiver, im Kino aber rührend zu träumender Traum. Man folgt Herzog gerne auf seinen Pfaden.
Und doch gibt es, zum Ende, wenn alles in der Tat, nach vielen Rückschlägen, gelungen, das Trauma des Wissenschaftlers überwunden ist, Bilder von eigenartiger Schönheit zu sehen. Flora und Fauna aus dem Dach der Welt. Oft bizarr anmutend, weil man mit der Kamera durchs Blätterdach kracht, aber doch von Schönheit, ohne den Gegenstand zu verklären, weil klar ist, dies ist ein Bild, dies wurde gemacht. In dieser Organisation von Bildern, die nicht nur stumpf das Atemberaubende sucht, liegt Herzogs Gespür und Kraft.
Das Große und das Kleine, darauf hat Gilles Deleuze hingewiesen, sind bei Werner Herzog wichtige Säulen. In der Spannung der Größenverhältnisse spielen sich seine Filme ab. Und dann gibt es ein Bild in diesem Film, der Schärfebereich ist so schmal es nur geht: Ein Wassertropfen, der von einem Blatt hängt. In ihm spiegelt sich der ganze, großartige Wasserfall, der weiter hinten, im Bild selbst nicht mehr repräsentierbar, liegt. Seine ganze Größe ist zu sehen, auf dem Kopf stehend und fokussiert, in einem einzigen Wassertropfen. Herzog fragt den Rastafari, mit dem er an diesen Ort gekommen ist, ob er in diesem Tropfen ein Universum sehe. Dieser antwortet, er könne nichts sehen, wegen des Donners, der Herzog sei. Das Große und das Kleine ist in diesem Moment aufgehoben, fällt in eins. Die Romantik aus zahlreichen Filmen Herzogs wird mit sich selbst gebrochen. Herzog scheitert in diesem Moment und macht sich auf diese Weise selbst zur zentralen Figur seines ganzen Werkes, in diesem zentralen Moment desselben.
imdb ~ filmz.de ~ offizielle site
Ist nun schon eine Weile her und eigentlich müsste man zu diesem (schönen) Film wirklich viel schreiben. Das erlaubt mir wohl meine Zeit (ein bisschen auch gerade meine Schreib-Unlust) nicht, aber so ganz unerwähnt will ich den Film dennoch nicht lassen. Also nur ein paar Noten, die mich wer weiß wohin führen.
Er war nämlich wirklich sehr groß, ja großartig. Wobei man vielleicht schon ein Freund der Filme von Werner Herzog sein muss, um das nachzuempfinden. Alle anderen werden kopfschüttelnd von dannen ziehen, aber so war das bei Herzog wohl schon immer.
 Nach dem etwas orientierungslos geratenen Rad der Zeit ist The White Diamond nichts anderes als eine Rückkehr zu den besten Zeiten Herzogs. In der Wahl seines Sujets zeigt er sich, wie gewohnt, treffsicher, auch bezüglich der Positionierung desselben in sein eigenes Werk (Herzog meinte ja mal, er drehe eigentlich nicht immer den selben Film, sondern eigentlich einen einzigen großen Film und er würde diesen gerne mal aus allen seinen Filmen zusammensetzen: Mit The White Diamond ist er an dieser Aussage verdammt nahe dran.). Zum Teil fügt sich die Thematik - ein Aero-Wissenschaftler baut einen Mini-Zeppelin, um das Dach des Regenwaldes mit Kameras zu untersuchen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein vergleichbarer Vorstoß vor vielen Jahren seinem Freund, ein Dokumentarfilmer, das Leben gekostet hatte - schon so nahtlos in den Herzog-Kosmos ein, dass man bisweilen zweifelt, ob das Ganze nicht insgesamt ein Spielfilm mit Drehbuch ist (ein Drehbuch, das vielleicht im Scherz Little Werner needs to fly genannt wurde, den es geht um genau das: Das kindliche Staunen, das Wissenschaft, Fliegerei und Cinephilie zugrunde liegt und in diesem Film ist Werner Herzog es selbst vor allem, auf den das alles zutrifft).
Nach dem etwas orientierungslos geratenen Rad der Zeit ist The White Diamond nichts anderes als eine Rückkehr zu den besten Zeiten Herzogs. In der Wahl seines Sujets zeigt er sich, wie gewohnt, treffsicher, auch bezüglich der Positionierung desselben in sein eigenes Werk (Herzog meinte ja mal, er drehe eigentlich nicht immer den selben Film, sondern eigentlich einen einzigen großen Film und er würde diesen gerne mal aus allen seinen Filmen zusammensetzen: Mit The White Diamond ist er an dieser Aussage verdammt nahe dran.). Zum Teil fügt sich die Thematik - ein Aero-Wissenschaftler baut einen Mini-Zeppelin, um das Dach des Regenwaldes mit Kameras zu untersuchen, nicht zuletzt auch deshalb, weil ein vergleichbarer Vorstoß vor vielen Jahren seinem Freund, ein Dokumentarfilmer, das Leben gekostet hatte - schon so nahtlos in den Herzog-Kosmos ein, dass man bisweilen zweifelt, ob das Ganze nicht insgesamt ein Spielfilm mit Drehbuch ist (ein Drehbuch, das vielleicht im Scherz Little Werner needs to fly genannt wurde, den es geht um genau das: Das kindliche Staunen, das Wissenschaft, Fliegerei und Cinephilie zugrunde liegt und in diesem Film ist Werner Herzog es selbst vor allem, auf den das alles zutrifft). Es finden sich die starken Bilder aus Herzogs Spielfilmen und dokumentarischen Arbeiten wieder, in immer neuen Kontexten, oft schon als Zitationen, als Verweise innerhalb des eigenen Werkes. Dass dem Wissenschaftler, dessen kindliches Staunen über die Welt der Aerodynamik sich, durch Herzogs Kameraauge betrachtet, 1:1 übertragt, einige Finger an der Hand fehlen, dass er, wie Reinhold Messner in Gasherbrom, an einigen Stellen in Tränen ausbricht, ist für den Kenner nur erwartbar gewesen. Gleichzeitig weiß Herzog aber darum: The White Diamond ist, bei aller Ernsthaftigkeit, von einem subtilen Witz durchzogen, einer altersweisen Ironie, die sich nie konkret in den Vordergrund schiebt, aber stets im Hintergrund erahnbar bleibt.
Natürlich geht es, wie immer bei Herzog, vor allem auch um Bildproduktion. Das ganze Projekt - Kameras aus der Luft in die Dachkrone des Regenwalds, einer der letzten Sphären des Unbekannten unserer heutigen Tage, vergleichbar vielleicht mit dem Grund des Meers zu Beginn des 19. Jahrhunderts - ist davon getragen, Dinge sichtbar zu machen. Folgerichtig lässt Herzog The White Diamond mit Bildern aus der Frühzei der Filmgeschichte beginnen, die die Geschichte der Fliegerei verdeutlichen sollen. Die ersten Antriebe aber, überhaupt so etwas wie Film zu erdenken, entstanden aus der Problematik mangelnder Sichtbarkeit: Eadweard Muybridge ging Mitte des 19. Jahrhunderts eine Wette ein, ob das Pferd beim Galopp alle Hufe gleichzeitig in der Luft habe. Eine Anordnung von 24 Fotokameras, die mit Fäden ausgelöst werden konnten, ergaben schließlich einen parzellierten, fotografischen Bewegungsablauf. Das war noch nicht Kino, aber schon nicht mehr weit weg. An einer Stelle sagt Herzog in White Diamond: "In Celluloid we trust!" - und er erhebt sich in die Lüfte, um Bilder zu machen, die noch nie zuvor gesehen wurden.
An einer anderen Stelle wird hinter einen mächtigen Wasserfall geblickt. Hinter diesen verschwinden Millionen von Vögeln, die dort offenbar nisten. In der Legendenwelt der Dschungelbevölkerung verbirgt sich hier eine wunderbare Welt. Aus Respekt vor dieser Legende zeigt Herzog die Aufnahmen von hinter dem tosenden Wasser nicht. Herzog ist noch immer Anwalt der Verschiedenartigkeit der weltweiten Kulturen und er ist noch immer auf der Suche nach Bildern. Es ist schon gar nicht mehr nötig, sie zu zeigen. Ferner ist es der Traum einer aufgeklärten Wissenschaft, einer Wissenschaft, die aus dem 19. Jahrhundert herrührt, aus dem in die Ferne streifen, Werner Herzog eigentlich als Abenteurerfigur, die in die Peripherie streift, mit dem heutigen Wissen aber verbunden, dass es vor allem Demut vor dem, was vorgefunden wird, sein sollte, die das Handeln bestimmt. Ein vielleicht etwas naiver, im Kino aber rührend zu träumender Traum. Man folgt Herzog gerne auf seinen Pfaden.
Und doch gibt es, zum Ende, wenn alles in der Tat, nach vielen Rückschlägen, gelungen, das Trauma des Wissenschaftlers überwunden ist, Bilder von eigenartiger Schönheit zu sehen. Flora und Fauna aus dem Dach der Welt. Oft bizarr anmutend, weil man mit der Kamera durchs Blätterdach kracht, aber doch von Schönheit, ohne den Gegenstand zu verklären, weil klar ist, dies ist ein Bild, dies wurde gemacht. In dieser Organisation von Bildern, die nicht nur stumpf das Atemberaubende sucht, liegt Herzogs Gespür und Kraft.
Das Große und das Kleine, darauf hat Gilles Deleuze hingewiesen, sind bei Werner Herzog wichtige Säulen. In der Spannung der Größenverhältnisse spielen sich seine Filme ab. Und dann gibt es ein Bild in diesem Film, der Schärfebereich ist so schmal es nur geht: Ein Wassertropfen, der von einem Blatt hängt. In ihm spiegelt sich der ganze, großartige Wasserfall, der weiter hinten, im Bild selbst nicht mehr repräsentierbar, liegt. Seine ganze Größe ist zu sehen, auf dem Kopf stehend und fokussiert, in einem einzigen Wassertropfen. Herzog fragt den Rastafari, mit dem er an diesen Ort gekommen ist, ob er in diesem Tropfen ein Universum sehe. Dieser antwortet, er könne nichts sehen, wegen des Donners, der Herzog sei. Das Große und das Kleine ist in diesem Moment aufgehoben, fällt in eins. Die Romantik aus zahlreichen Filmen Herzogs wird mit sich selbst gebrochen. Herzog scheitert in diesem Moment und macht sich auf diese Weise selbst zur zentralen Figur seines ganzen Werkes, in diesem zentralen Moment desselben.
imdb ~ filmz.de ~ offizielle site
° ° °
Thema: Filmtagebuch
vor einigen Tagen, Heimkino; Inhalt.
Den amerikanischen Traum hat er schnell kapiert: Viktor Navorski (Tom Hanks als üblich hassenswerter Spitzbub), gestrandet im Airport JFK - im Film eine Art USA-Essenz auf kleinstem Raum -, sammelt wie blöde die verstreuten Gepäckkarren auf und bringt sie zur zentralen Sammelstelle zurück. Der Lohn: 25 Cent Pfand pro Karren. Und dieser Lohn lässt sich bei Burger King in eine leidlich nahrhafte Mahlzeit umsetzen. Vom Tellerwäscher zum, naja, Burger-Millionär immerhin.
Momente wie diese sind es, in denen Terminal funktionieren kann, nicht funktionieren muss. Man findet sie vorrangig im ersten Viertel, als das Chaos und der Trubel am Flughafen, die unzähligen Menschen, Zeichen, Möglichkeiten erst noch strukturiert werden müssen. Leichte Unterhaltung mit allenfalls einer Nuance zu sehr behauptetem Augenzwinkern als sich wirklich drin finden ließe. Aber es sind nette Schrulligkeiten, die kann man annehmen kann oder halt nicht (wenn man davon absieht, dass die Grundlage der hier beschwingt erscheinenden Geschichte eine reale, an sich recht tragische ist - dies im Hinterkopf ist das alles eigentlich nur Zynismus.). In diesem Sinne erfüllt Terminal sein zunächst angestrebtes Ziel: Zerstreuung und ein bisschen was fürs Herz.
Breiig wird es, ist das Arsenal der Figuren und deren Marotten etabliert, ihre Positionen innerhalb der Geschichte geklärt. Dann wird Herzschmerz beigemengt, viel Rührseligkeit, Navorksi ist der edle Wilde aus dem Ostblock, der sich das golden naive Herz noch bewahrt hat. Aber alles wirkt zusammengeschustert, hingebogen, dem Spielberg-Kosmos mit seinen üblichen Projektionen und Sehnsüchten mit aller Gewalt reingedrückt. Das zuweilen Leichte und Beschwingte, für das man Terminal zu Beginn noch schätzen kann, wird unter Sentiment und Unentschlossenheit begraben. Dieses seltsam Orientierungslose teilt er mit Catch me if you can, seinem Vorläufer im Werk, der ebenfalls schon nicht recht wusste wohin und dann doch mit Biegen und Brechen dem Werk seines Regisseurs angepasst werden musste.
imdb ~ filmz.de
Den amerikanischen Traum hat er schnell kapiert: Viktor Navorski (Tom Hanks als üblich hassenswerter Spitzbub), gestrandet im Airport JFK - im Film eine Art USA-Essenz auf kleinstem Raum -, sammelt wie blöde die verstreuten Gepäckkarren auf und bringt sie zur zentralen Sammelstelle zurück. Der Lohn: 25 Cent Pfand pro Karren. Und dieser Lohn lässt sich bei Burger King in eine leidlich nahrhafte Mahlzeit umsetzen. Vom Tellerwäscher zum, naja, Burger-Millionär immerhin.
Momente wie diese sind es, in denen Terminal funktionieren kann, nicht funktionieren muss. Man findet sie vorrangig im ersten Viertel, als das Chaos und der Trubel am Flughafen, die unzähligen Menschen, Zeichen, Möglichkeiten erst noch strukturiert werden müssen. Leichte Unterhaltung mit allenfalls einer Nuance zu sehr behauptetem Augenzwinkern als sich wirklich drin finden ließe. Aber es sind nette Schrulligkeiten, die kann man annehmen kann oder halt nicht (wenn man davon absieht, dass die Grundlage der hier beschwingt erscheinenden Geschichte eine reale, an sich recht tragische ist - dies im Hinterkopf ist das alles eigentlich nur Zynismus.). In diesem Sinne erfüllt Terminal sein zunächst angestrebtes Ziel: Zerstreuung und ein bisschen was fürs Herz.
Breiig wird es, ist das Arsenal der Figuren und deren Marotten etabliert, ihre Positionen innerhalb der Geschichte geklärt. Dann wird Herzschmerz beigemengt, viel Rührseligkeit, Navorksi ist der edle Wilde aus dem Ostblock, der sich das golden naive Herz noch bewahrt hat. Aber alles wirkt zusammengeschustert, hingebogen, dem Spielberg-Kosmos mit seinen üblichen Projektionen und Sehnsüchten mit aller Gewalt reingedrückt. Das zuweilen Leichte und Beschwingte, für das man Terminal zu Beginn noch schätzen kann, wird unter Sentiment und Unentschlossenheit begraben. Dieses seltsam Orientierungslose teilt er mit Catch me if you can, seinem Vorläufer im Werk, der ebenfalls schon nicht recht wusste wohin und dann doch mit Biegen und Brechen dem Werk seines Regisseurs angepasst werden musste.
imdb ~ filmz.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
Moonraker (Lewis Gilbert, GB 1979)
In schöner Regelmäßigkeit bezeichnet Georg Seeßlen die Phase des Kinos seit den 70er Jahren als "Implosion der Genres". Star Wars dient in der Regel als Kronzeuge: Hier fielen zahlreiche Genres ineinander und ergaben vielleicht soetwas wie die Essenz des Genrefilms. Moonraker entstand kurz nach George Lucas' Weltraum-Western-Märchen-Action-Fantasy-Nibelungen-Tolkien-Saga und ist als deutlicher Versuch, an diese anzuschließen, zu erkennen.
Will man nun die Rede von den implodierten Genres als gültig ansehen, ist Moonraker vielleicht soetwas wie der Beweis der allgemeinen Verwirrung, den diese Entwicklung in ihrer Frühzeit ausgelöst haben mag: Ganz und gar unbeholfen und geradewegs erstaunlich hilflos manövriert sich da ein Film, durch diverse Genrewelten und schielt dabei auf die neue Blockbuster-Form wie die eigenen Implikationen gleichermaßen. Dazu passt die vollkommen delirierende Story, die sich mit Kohärenz schon gar nicht mehr aufhält: Roger Moore springt als, mal genau besehen, sensationell ahnungsloser Horst durch eine internationale Kulisse, ohne dass die Sprünge als solche noch irgendwie in ein sinnstiftendes Gefüge eingepflegt würden. Ähnlich springt man von einer stupiden Westernszene, in der Moore als Eastwood als namenloser Leone-Held zu Pferde reichlich dämlich ausschauen darf, über Agentengimmick-Trash hin zu einer gnadenlos dümmlichen Space-Opera in den letzten Minuten, in der selbst Beißer noch eine trashige Liebesbeziehung eingehen und einer von den Guten werden darf.
Als Film für sich genommen ist das allenfalls inakzeptabel. Noch nicht einmal zum unterhaltsamen Trash - Marke: Gurke zwar, aber amüsant gegen die Wand gefahren - hat es hingereicht. Aber auf einer zweiten Ebene, filmgeschichtlich besehen, ist dieser Film dann doch bemerkenswert: Als Symptom einer Konfusion im Zeitalter des frühen Blockbusters.
Immerhin sehr bemerkenswert: Ken Adams Set-Arbeiten, die, zwischen üblicher Moderne-Gigantonomie und Pulp-Geekiness, sicherlich zu seinen besten gezählt werden dürfen, und eine sensationell inszenierte Actionszene über den Wolken recht früh im Film: Deren komplizierte Produktion wird im Bonusmaterial der DVD genau erläutert. [imdb ~ mrqe]
Wir (Martin Gypkens, Deutschland 2003)
Kennen Sie die peinliche Berührung des Mitschämens? Anhand von Wir kann man die sehr gut nachvollziehen: Da wird eine Art Zustandsbeschreibung versucht, die dann auch noch, nicht unbescheiden, über den Titel zum Bild einer ganzen Generation stilisiert wird: Das also, das sind "wir". Wir, die wir in den 90ern nach Berlin und dann noch durch die Bars zogen, gefangen in schlechten Callcenter-Jobs, die wir uns abgrenzen wollten, von alten Freunden und alter Provinz. Neue Stadt, neue Leute, neue Probleme. Es klappt mit dem alten Freundeskreis nicht mehr so ganz. Man will künstlerisch aktiv sein, einen Film drehen. Das ist der Spirit von Prenzlberg '96. Bars und Clubs in Mitte. Liebesaffären. Retro-Wohnungen.
Ein Film, der sich mit Trivialitäten aufhält: Ja, der Umzug in die große Stadt ist ein großer Einschnitt in jede Biografie. What else is new? Ja, man kann unter den zahlreichen Eindrücken schon schnell einen Großstadtkoller erleiden. Where is the fuckin' beef in all of this? Was bleibt ist das Portrait einer heillos neurotischen, ungemein langweiligen selbsternannten "Generation Berlin", die schon in den 90ern nach einer postmodernen Wiederkehr der öden 80er roch. Warum sollte ich mir Deppen im Film anschauen, die ich privat noch nicht mal meiden müssen will, um dann auch noch plump vereinnahmt werden zu müssen? "Wir", allein dieses Wort schon: "Wir" - abschaffen bitte! "Wir" das hat Freddie Quinn penetrant im Refrain gesungen, als er gegen die "Gammler" lyrisch in den Krieg zog, und "wir" das singen heutzutage die spackdumme 2raumwohnung und das Duo Infernale der Popmusik, Heppner und Dyk. Kurzum: "Wir", das ist grundsätzlich dumme Scheiße und erinnert in diesem Fall sträflich an das "Kinder vom Bahnhof Zoo"-Gewese: Im Jugendalter kiffen und währenddessen das "Kinder"-Buch lesen, das strackdumme "Wir"-Gefühl eben... [imdb ~ filmz.de]
Anatomie / Anatomie 2 (Stefan Ruzowitzky, Deutschland 2000/2003)
Ruzowitzkys Siebtelbauern, den er vor diesen beiden Desastern der Horrorfilmgeschichte drehte, soll, dem Vernehmen nach, große Kunst sein. Diese beiden Filme sind nun allerdings nicht gerade geeignet, Lust auf ein Stöbern in dieser Filmografie zu machen.
Beide Filme sind so irgendwie "Filme von und für Mediengestalter": Jedes Bild sitzt, ist handwerklich perfekt. Das Licht stimmt genau, die Einstellungsgrößen sind prima, gute Bilder für den Schnitt - das freut jeden Azubi-Prüfer und im Fernsehen, wo solche Perfektion gefragt ist, können es alle Beteiligten, die nun ein perfektes Portfolio vorweisen können, bestimmt noch weit bringen. Doch ein Horrorfilm braucht in erster Linie keine handwerkliche Gelacktheit, sondern Seele. Und wenn die fehlt, dann ist alles andere hinfällig, samt und sonders für die Katz'. Über die sorgfältige, handwerkliche Gestaltung hat man - in beiden Auflagen des Stoffes - den Charme vergessen und spult stattdessen eine lieblose Ansammlung von üblichen Versatzstücken aus dem Arsenal ab, das die Welt der Groschenromane von Bastei Lübbe bildet: Etwas Verschwörungstheorie, ein unheimliches Institut, im zweiten Teil ein wenig Nazi-Trash, ein bisschen Krimi und unbeholfenes "Urangst"-Triggern. Dabei ist man sich, seitens der Produktion, nie ganz im Klaren, ob das jetzt "cool", "spannend", "pulpig" oder öd ironisch "albern" sein soll. Entsprechend irrlichtern beide Filme durch sich selbst, verweilen gelegentlich an Spannungsmomenten, die als solche nur behauptet werden, und sind, im wesentlichen, nur dafür da, eine Ansammlung handwerklich gut gemachter Bilder abzuliefern. Ein Horrorfilm von Leuten, die vom Horror nichts verstanden haben, für Leute, die Horrorfilme ansonsten nicht schauen, aber bei "uns Franka" mal fünfe gerade sein lassen. Ein liebloses Machwerk in doppelter Ausführung.
[imdb] ~ [imdb ~ filmz.de]
Catwoman (Pitof, USA 2004)
Pitof hatte zuvor in Frankreich den außerordentlich schönen Vidocq gedreht, früher hat er bei Jeunet die Visuals überwacht. Der Mann weiß also, wie "gut aussehen" geht. In Catwoman darf er dann auch mit der Kamera schnörkeln und schnörkeln und schnörkeln. Und in die Katzen, die heimlichen Hauptdarsteller, hat er sich augenscheinlich voll und ganz verliebt.
Bringt aber alles nichts, denn jenseits aller Künststückchen plätschert der Film uninspiriert durch eine mäßig spannende Story, die zudem - was fatal für einen Superheldenfilm ist, zumal für den ersten eines Franchise - langweilig wird, sobald sie erst in Fahrt kommt. Damit ist Catwoman wohl in der Tat die erste Origin Story, die vor der Heldenwerdung amüsanter ist als danach. Spannungsfreies Lack-und-Leder-Einerlei.
[imdb ~ mrqe ~ filmz.de ~ angelaufen.de]
In schöner Regelmäßigkeit bezeichnet Georg Seeßlen die Phase des Kinos seit den 70er Jahren als "Implosion der Genres". Star Wars dient in der Regel als Kronzeuge: Hier fielen zahlreiche Genres ineinander und ergaben vielleicht soetwas wie die Essenz des Genrefilms. Moonraker entstand kurz nach George Lucas' Weltraum-Western-Märchen-Action-Fantasy-Nibelungen-Tolkien-Saga und ist als deutlicher Versuch, an diese anzuschließen, zu erkennen.
Will man nun die Rede von den implodierten Genres als gültig ansehen, ist Moonraker vielleicht soetwas wie der Beweis der allgemeinen Verwirrung, den diese Entwicklung in ihrer Frühzeit ausgelöst haben mag: Ganz und gar unbeholfen und geradewegs erstaunlich hilflos manövriert sich da ein Film, durch diverse Genrewelten und schielt dabei auf die neue Blockbuster-Form wie die eigenen Implikationen gleichermaßen. Dazu passt die vollkommen delirierende Story, die sich mit Kohärenz schon gar nicht mehr aufhält: Roger Moore springt als, mal genau besehen, sensationell ahnungsloser Horst durch eine internationale Kulisse, ohne dass die Sprünge als solche noch irgendwie in ein sinnstiftendes Gefüge eingepflegt würden. Ähnlich springt man von einer stupiden Westernszene, in der Moore als Eastwood als namenloser Leone-Held zu Pferde reichlich dämlich ausschauen darf, über Agentengimmick-Trash hin zu einer gnadenlos dümmlichen Space-Opera in den letzten Minuten, in der selbst Beißer noch eine trashige Liebesbeziehung eingehen und einer von den Guten werden darf.
Als Film für sich genommen ist das allenfalls inakzeptabel. Noch nicht einmal zum unterhaltsamen Trash - Marke: Gurke zwar, aber amüsant gegen die Wand gefahren - hat es hingereicht. Aber auf einer zweiten Ebene, filmgeschichtlich besehen, ist dieser Film dann doch bemerkenswert: Als Symptom einer Konfusion im Zeitalter des frühen Blockbusters.
Immerhin sehr bemerkenswert: Ken Adams Set-Arbeiten, die, zwischen üblicher Moderne-Gigantonomie und Pulp-Geekiness, sicherlich zu seinen besten gezählt werden dürfen, und eine sensationell inszenierte Actionszene über den Wolken recht früh im Film: Deren komplizierte Produktion wird im Bonusmaterial der DVD genau erläutert. [imdb ~ mrqe]
Wir (Martin Gypkens, Deutschland 2003)
Kennen Sie die peinliche Berührung des Mitschämens? Anhand von Wir kann man die sehr gut nachvollziehen: Da wird eine Art Zustandsbeschreibung versucht, die dann auch noch, nicht unbescheiden, über den Titel zum Bild einer ganzen Generation stilisiert wird: Das also, das sind "wir". Wir, die wir in den 90ern nach Berlin und dann noch durch die Bars zogen, gefangen in schlechten Callcenter-Jobs, die wir uns abgrenzen wollten, von alten Freunden und alter Provinz. Neue Stadt, neue Leute, neue Probleme. Es klappt mit dem alten Freundeskreis nicht mehr so ganz. Man will künstlerisch aktiv sein, einen Film drehen. Das ist der Spirit von Prenzlberg '96. Bars und Clubs in Mitte. Liebesaffären. Retro-Wohnungen.
Ein Film, der sich mit Trivialitäten aufhält: Ja, der Umzug in die große Stadt ist ein großer Einschnitt in jede Biografie. What else is new? Ja, man kann unter den zahlreichen Eindrücken schon schnell einen Großstadtkoller erleiden. Where is the fuckin' beef in all of this? Was bleibt ist das Portrait einer heillos neurotischen, ungemein langweiligen selbsternannten "Generation Berlin", die schon in den 90ern nach einer postmodernen Wiederkehr der öden 80er roch. Warum sollte ich mir Deppen im Film anschauen, die ich privat noch nicht mal meiden müssen will, um dann auch noch plump vereinnahmt werden zu müssen? "Wir", allein dieses Wort schon: "Wir" - abschaffen bitte! "Wir" das hat Freddie Quinn penetrant im Refrain gesungen, als er gegen die "Gammler" lyrisch in den Krieg zog, und "wir" das singen heutzutage die spackdumme 2raumwohnung und das Duo Infernale der Popmusik, Heppner und Dyk. Kurzum: "Wir", das ist grundsätzlich dumme Scheiße und erinnert in diesem Fall sträflich an das "Kinder vom Bahnhof Zoo"-Gewese: Im Jugendalter kiffen und währenddessen das "Kinder"-Buch lesen, das strackdumme "Wir"-Gefühl eben... [imdb ~ filmz.de]
Anatomie / Anatomie 2 (Stefan Ruzowitzky, Deutschland 2000/2003)
Ruzowitzkys Siebtelbauern, den er vor diesen beiden Desastern der Horrorfilmgeschichte drehte, soll, dem Vernehmen nach, große Kunst sein. Diese beiden Filme sind nun allerdings nicht gerade geeignet, Lust auf ein Stöbern in dieser Filmografie zu machen.
Beide Filme sind so irgendwie "Filme von und für Mediengestalter": Jedes Bild sitzt, ist handwerklich perfekt. Das Licht stimmt genau, die Einstellungsgrößen sind prima, gute Bilder für den Schnitt - das freut jeden Azubi-Prüfer und im Fernsehen, wo solche Perfektion gefragt ist, können es alle Beteiligten, die nun ein perfektes Portfolio vorweisen können, bestimmt noch weit bringen. Doch ein Horrorfilm braucht in erster Linie keine handwerkliche Gelacktheit, sondern Seele. Und wenn die fehlt, dann ist alles andere hinfällig, samt und sonders für die Katz'. Über die sorgfältige, handwerkliche Gestaltung hat man - in beiden Auflagen des Stoffes - den Charme vergessen und spult stattdessen eine lieblose Ansammlung von üblichen Versatzstücken aus dem Arsenal ab, das die Welt der Groschenromane von Bastei Lübbe bildet: Etwas Verschwörungstheorie, ein unheimliches Institut, im zweiten Teil ein wenig Nazi-Trash, ein bisschen Krimi und unbeholfenes "Urangst"-Triggern. Dabei ist man sich, seitens der Produktion, nie ganz im Klaren, ob das jetzt "cool", "spannend", "pulpig" oder öd ironisch "albern" sein soll. Entsprechend irrlichtern beide Filme durch sich selbst, verweilen gelegentlich an Spannungsmomenten, die als solche nur behauptet werden, und sind, im wesentlichen, nur dafür da, eine Ansammlung handwerklich gut gemachter Bilder abzuliefern. Ein Horrorfilm von Leuten, die vom Horror nichts verstanden haben, für Leute, die Horrorfilme ansonsten nicht schauen, aber bei "uns Franka" mal fünfe gerade sein lassen. Ein liebloses Machwerk in doppelter Ausführung.
[imdb] ~ [imdb ~ filmz.de]
Catwoman (Pitof, USA 2004)
Pitof hatte zuvor in Frankreich den außerordentlich schönen Vidocq gedreht, früher hat er bei Jeunet die Visuals überwacht. Der Mann weiß also, wie "gut aussehen" geht. In Catwoman darf er dann auch mit der Kamera schnörkeln und schnörkeln und schnörkeln. Und in die Katzen, die heimlichen Hauptdarsteller, hat er sich augenscheinlich voll und ganz verliebt.
Bringt aber alles nichts, denn jenseits aller Künststückchen plätschert der Film uninspiriert durch eine mäßig spannende Story, die zudem - was fatal für einen Superheldenfilm ist, zumal für den ersten eines Franchise - langweilig wird, sobald sie erst in Fahrt kommt. Damit ist Catwoman wohl in der Tat die erste Origin Story, die vor der Heldenwerdung amüsanter ist als danach. Spannungsfreies Lack-und-Leder-Einerlei.
[imdb ~ mrqe ~ filmz.de ~ angelaufen.de]
° ° °
Thema: Filmtagebuch
21.03.2005, Kino Arsenal
Wer sich Vampyr von der Warte des heutigen, am populären Kino geschulten Filmfreundes erschließt, könnte vielleicht wirklich dem ersten Reflex gehorchen und behaupten: „Fühlt sich an wie ein Film von David Lynch.“ Natürlich täte man Dreyer wie Lynch damit Unrecht (von der Filmgeschichte mal ganz zu schweigen). Doch ein klein wenig wäre damit schon über das Befremden, das diese kontingente Welt auslöst, über die Methode des Entrückens einer der Alltagsempfindung eigentlich nahe stehenden Welt hinein ins entfremdet Artifizielle, die beide Filmkosmen aneinanderrückt, ausgesagt.
 Spannend ist es, wie der Film sich zur eigenen Position in der Filmgeschichte verhält. Zahlreiche Texttafeln – von der Erläuterung des allgemeinen Hintergrunds bis zu versunkenen Blicken in das Buch der „Geschichte der Vampyre“ – sowie lange Sequenzen, in denen kein Wort über die Lippen der „Gestalten“ (wie sie der Vorspann nennt und ja, „Figuren“ oder gar „Menschen“ sind das wirklich nicht) kommt, weisen ihn eigentlich als Stummfilm aus. Doch dann sind die wenigen Momente, in denen gesprochen wird (meist Knappes, Einsilbiges, nicht selten sinnentleert Anmutendes), von ungemeiner Relevanz für die (entgegen der Erwartungen ob des Films) nicht etwa schauderhafte, sondern entfremdete Atmosphäre: Die monoton, oft in unwirklichen Stimmlagen rezitierten Sätzlein umgibt etwas Leichenhaftes, das auf den Filmraum selbst zu wirken scheint. Etwa die Szene gleich zu Beginn, als Allan Grey im Gasthaus angekommen ist, und plötzlich das Murmeln eines Greises von einem Stock höher einsetzt: Mit einem Male zeigt sich der Raum im anderen Bilde, mit minimalstem Aufwand ergibt sich ein Irrealis des Settings, das durch den Auftritt schließlich des grotesk anzusehenden alten Mann, dem das gebetsmühlenartige Gemurmel entspringt, noch verstärkt wird. Oder der Auftritt des alten Mannes, der dann im späteren Verlauf von dem Vampyr hörigen Schatten erschossen wird und dessen Spukgestalt Grey nächtens in seinem Zimmer besucht und ihn um Hilfe anfleht. Das klägliche „Sie darf nicht sterben“ – narrativ zunächst durch nichts gestützt - wird nicht nur aufgrund seines rätselhaften Inhalts, sondern vor allem auch durch die Form der medialen Darbietung zum wichtigen Faktor des Filmgelingens. Aus dieser bewusst eingesetzten Klangästhetik spricht ein hohes Gespür für die Wirkung von Ton im Film: Vampyr ist deshalb kein Zwitterwesen aus Stumm- und Tonfilm, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Tonfilm ganz und gar, der den Weg „illustrierenden Geschwätzes“ nicht gegangen ist.
Spannend ist es, wie der Film sich zur eigenen Position in der Filmgeschichte verhält. Zahlreiche Texttafeln – von der Erläuterung des allgemeinen Hintergrunds bis zu versunkenen Blicken in das Buch der „Geschichte der Vampyre“ – sowie lange Sequenzen, in denen kein Wort über die Lippen der „Gestalten“ (wie sie der Vorspann nennt und ja, „Figuren“ oder gar „Menschen“ sind das wirklich nicht) kommt, weisen ihn eigentlich als Stummfilm aus. Doch dann sind die wenigen Momente, in denen gesprochen wird (meist Knappes, Einsilbiges, nicht selten sinnentleert Anmutendes), von ungemeiner Relevanz für die (entgegen der Erwartungen ob des Films) nicht etwa schauderhafte, sondern entfremdete Atmosphäre: Die monoton, oft in unwirklichen Stimmlagen rezitierten Sätzlein umgibt etwas Leichenhaftes, das auf den Filmraum selbst zu wirken scheint. Etwa die Szene gleich zu Beginn, als Allan Grey im Gasthaus angekommen ist, und plötzlich das Murmeln eines Greises von einem Stock höher einsetzt: Mit einem Male zeigt sich der Raum im anderen Bilde, mit minimalstem Aufwand ergibt sich ein Irrealis des Settings, das durch den Auftritt schließlich des grotesk anzusehenden alten Mann, dem das gebetsmühlenartige Gemurmel entspringt, noch verstärkt wird. Oder der Auftritt des alten Mannes, der dann im späteren Verlauf von dem Vampyr hörigen Schatten erschossen wird und dessen Spukgestalt Grey nächtens in seinem Zimmer besucht und ihn um Hilfe anfleht. Das klägliche „Sie darf nicht sterben“ – narrativ zunächst durch nichts gestützt - wird nicht nur aufgrund seines rätselhaften Inhalts, sondern vor allem auch durch die Form der medialen Darbietung zum wichtigen Faktor des Filmgelingens. Aus dieser bewusst eingesetzten Klangästhetik spricht ein hohes Gespür für die Wirkung von Ton im Film: Vampyr ist deshalb kein Zwitterwesen aus Stumm- und Tonfilm, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Tonfilm ganz und gar, der den Weg „illustrierenden Geschwätzes“ nicht gegangen ist.
Dies hat Methode, die sich auf den ganzen Film erstreckt: Der Topos des Vampirs steht unter anderem auch für eine Auflösung der Gegensätze des Alten und des Neuen in eine synthetisierte neue Form: Meist ist er ein Wiedergänger, der seine Zeitsphäre – das Alte – verlassen hat. Zur Zeit der Emanzipation des Bürgertums tritt er auf als der wiedergekommene Aristokrat. Gleichzeitig weist er sich auch als der Überwinder des biologischen Verfalls wie der sexuellen Moralvorstellungen des Bürgertums als ein Menschenentwurf der Zukunft aus, für den zudem die klassische Lohnarbeit als Option nicht mehr in Frage kommt. Diese Hybridität spiegelt sich im Film nicht nur in seiner Synthese von Ton- und Stummfilm, sondern auch in seiner Verhandlung des Vampirs selbst, die hier nicht in die filmische Schauderromantik als vermeintlich authentische Illustration einer Geisteswelt des 19. Jahrhunderts hineingleitet, sondern hier eher den Blick des 20. auf das 19. Jahrhundert (das selbst wiederum ins 18. blickte) im Sinn hat: Der „Vampyr“ des Films wird erst durch ein Buch aus dem 19. Jahrhundert erkennbar und auch nur, als der im Vorspann ausgewiesene „Phantast“ Allan Grey sich darin versenkt. Allan Grey ist dabei anhand seiner Erscheinung – Anzug und Krawatte - deutlich als Mensch des 20. Jahrhunderts zu erkennen, den nostalgische Sehnsüchte nach bestaunenswerter Romantik und Spuk bestimmen. Vermutlich nicht ganz von ungefähr erinnert er auch in manchen Momenten rein äußerlich ein wenig an H.P. Lovecraft, der den eigenen verklärten Blick auf die Kultur und Literatur vergangener Dekaden zur eigenen Methode erhoben hat. In dieser Hinsicht ist Vampyr deshalb ein kluger (Vampir-)Film: Weil er nicht Altes vermeintlich authentisch illustrieren will (vgl. etwa die frühen Gruselfilme der Hammer Studios, gegen die ich damit im übrigen nichts gesagt haben will), sondern weil er seine Vampirgeschichte zur Geschichte vom Verhältnis des Blicks auf seinen Gegenstand erklärt.
Klug ist auch die Inszenierung des Raumes. Wie kaum ein anderes Filmgenre thematisiert der Horrorfilm seinen Raum, respektive dessen Destabilisierung. In kaum einem anderen Genre ist deshalb das Verhältnis von Kamera und Erzählraum so wichtig: Der Horrorfilm ist ein Genre des Close-Ups und des „unmöglichen Winkels“, die Totale findet man indes nur selten und kaum ein Horrorfilm kommt ohne Momente aus, in denen der Raum und seine Stabilität infrage gestellt werden (man denke nur an den berühmten zugezogenen Duschvorhang und was sich wohl dahinter verbergen könnte): Wer im Horrorfilm überlebt und wer nicht, ist meistens, wenn nicht immer, eine Frage dessen, wer sich in welchem Raum wie verhält, wem Macht ihn souverän zu durchqueren zugemessen wird: Deshalb überlebt das Mädchen am Ende von Texas Chain Saw Massacre: Weil sie über den Sprung durch das Fenster ihren Raum zu erweitern weiß und in ihm neue Vektoren auszumachen in der Lage ist, wohingegen dem plumpen Leatherface nur der Gang durchs Treppenhaus einfällt. In Vampyr ist der Raum ebenfalls von Belang: Die Kamera folgt den Figuren erstaunlich behände, zahlreiche Plansequenzen lassen den Raum erkunden, Kreisfahrten bieten Übersichten auf der Horizontalen, denen häufige Detailansichten gegenüber stehen. Dennoch: Ein souveräner Überblick über das komplex konstruierte räumliche Gefüge ist in der Tat kaum möglich. Ganz im Gegenteil stellt sich das Gefühl eines „Durchschwebens“ ein: Wie Allan Grey staunend durch seinen mutmaßlichen „Traumraum“ schreitet, wird auch der Zuschauer vom Verständnis des Raumes als einem authentischen methodisch entrückt.
Die hohe Beweglichkeit der Kamera und die dadurch entstehende Nähe zum Raumgeschehen bedingen dabei einen zusätzlich befremdlichen Effekt: Eigentlich wirkt dieser Film an keiner Stelle wie aus den frühen 30er Jahren. Ganz im Gegenteil meint man sich mindestens in den 60er Jahren zu bewegen. Erinnerungen an Night of the Living Dead werden wach und man hat auch in den folgenden Jahren noch manchen statisch erstarrten Film gesehen. Dies nun lässt den Film vollends ins Surreale kippen: Dass ein Film aus scheinbar späteren Jahrzehnten in eine synthetisierten Form aus Stumm- und Tonfilm in den frühen 30er Jahren auftritt und vom Verhältnis von Gegenwärtigkeit und Vergangenheit handelt, in dem alle Personen selbst schon aus dem Zustand des post mortem heraus zu agieren scheinen (in der Tat: Allan Grey wird an einer Stelle beerdigt, in einer anderen, mittels Doppelbelichtung bewerkstelligten Sequenz löst sich ein durchscheinendes Abbild seiner Selbst von seiner physischen Gestalt und irrlichtert durch die Welt, wie alle Figuren sprechen als seien sie schon nicht mehr lebendig, wie überhaupt alles so wirkt, als sei es die Phantasie eines bereits Gestorbenen), all dies lässt das Filmerleben selbst zu einer Art Trance geraten: In Mitternachtskino haben Hoberman und Rosenbaum auf die religiöse Tradition und kultische Nähe der Zeremonien des cinephilen Mitternachtspublikums der 70er Jahre hingewiesen. Wer Vampyr im Kino sieht – ein Mitternachtsfilm avant la lettre - kann nachempfinden, was diese Bewegung Nacht für Nacht ins Kino gezogen hat, um dort, mittels der Mechanik der Moderne, die jedem Filmbild grundlegende Bedingung zur Möglichkeit ist, die Risse im Gefüge von Raum und Zeit zu erkunden. Dass Vampyr dies in seiner klausulierten Narration spiegelt, ist dabei nur obligatorisch.

imdb ~ senses of cinema ~ kinoeye ~ masterofcinema.org mit einem scan des originalen dänischen filmprogramms.
Weitere Sichtungen aus der Magical History Tour im Weblog hier.
Wer sich Vampyr von der Warte des heutigen, am populären Kino geschulten Filmfreundes erschließt, könnte vielleicht wirklich dem ersten Reflex gehorchen und behaupten: „Fühlt sich an wie ein Film von David Lynch.“ Natürlich täte man Dreyer wie Lynch damit Unrecht (von der Filmgeschichte mal ganz zu schweigen). Doch ein klein wenig wäre damit schon über das Befremden, das diese kontingente Welt auslöst, über die Methode des Entrückens einer der Alltagsempfindung eigentlich nahe stehenden Welt hinein ins entfremdet Artifizielle, die beide Filmkosmen aneinanderrückt, ausgesagt.
 Spannend ist es, wie der Film sich zur eigenen Position in der Filmgeschichte verhält. Zahlreiche Texttafeln – von der Erläuterung des allgemeinen Hintergrunds bis zu versunkenen Blicken in das Buch der „Geschichte der Vampyre“ – sowie lange Sequenzen, in denen kein Wort über die Lippen der „Gestalten“ (wie sie der Vorspann nennt und ja, „Figuren“ oder gar „Menschen“ sind das wirklich nicht) kommt, weisen ihn eigentlich als Stummfilm aus. Doch dann sind die wenigen Momente, in denen gesprochen wird (meist Knappes, Einsilbiges, nicht selten sinnentleert Anmutendes), von ungemeiner Relevanz für die (entgegen der Erwartungen ob des Films) nicht etwa schauderhafte, sondern entfremdete Atmosphäre: Die monoton, oft in unwirklichen Stimmlagen rezitierten Sätzlein umgibt etwas Leichenhaftes, das auf den Filmraum selbst zu wirken scheint. Etwa die Szene gleich zu Beginn, als Allan Grey im Gasthaus angekommen ist, und plötzlich das Murmeln eines Greises von einem Stock höher einsetzt: Mit einem Male zeigt sich der Raum im anderen Bilde, mit minimalstem Aufwand ergibt sich ein Irrealis des Settings, das durch den Auftritt schließlich des grotesk anzusehenden alten Mann, dem das gebetsmühlenartige Gemurmel entspringt, noch verstärkt wird. Oder der Auftritt des alten Mannes, der dann im späteren Verlauf von dem Vampyr hörigen Schatten erschossen wird und dessen Spukgestalt Grey nächtens in seinem Zimmer besucht und ihn um Hilfe anfleht. Das klägliche „Sie darf nicht sterben“ – narrativ zunächst durch nichts gestützt - wird nicht nur aufgrund seines rätselhaften Inhalts, sondern vor allem auch durch die Form der medialen Darbietung zum wichtigen Faktor des Filmgelingens. Aus dieser bewusst eingesetzten Klangästhetik spricht ein hohes Gespür für die Wirkung von Ton im Film: Vampyr ist deshalb kein Zwitterwesen aus Stumm- und Tonfilm, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Tonfilm ganz und gar, der den Weg „illustrierenden Geschwätzes“ nicht gegangen ist.
Spannend ist es, wie der Film sich zur eigenen Position in der Filmgeschichte verhält. Zahlreiche Texttafeln – von der Erläuterung des allgemeinen Hintergrunds bis zu versunkenen Blicken in das Buch der „Geschichte der Vampyre“ – sowie lange Sequenzen, in denen kein Wort über die Lippen der „Gestalten“ (wie sie der Vorspann nennt und ja, „Figuren“ oder gar „Menschen“ sind das wirklich nicht) kommt, weisen ihn eigentlich als Stummfilm aus. Doch dann sind die wenigen Momente, in denen gesprochen wird (meist Knappes, Einsilbiges, nicht selten sinnentleert Anmutendes), von ungemeiner Relevanz für die (entgegen der Erwartungen ob des Films) nicht etwa schauderhafte, sondern entfremdete Atmosphäre: Die monoton, oft in unwirklichen Stimmlagen rezitierten Sätzlein umgibt etwas Leichenhaftes, das auf den Filmraum selbst zu wirken scheint. Etwa die Szene gleich zu Beginn, als Allan Grey im Gasthaus angekommen ist, und plötzlich das Murmeln eines Greises von einem Stock höher einsetzt: Mit einem Male zeigt sich der Raum im anderen Bilde, mit minimalstem Aufwand ergibt sich ein Irrealis des Settings, das durch den Auftritt schließlich des grotesk anzusehenden alten Mann, dem das gebetsmühlenartige Gemurmel entspringt, noch verstärkt wird. Oder der Auftritt des alten Mannes, der dann im späteren Verlauf von dem Vampyr hörigen Schatten erschossen wird und dessen Spukgestalt Grey nächtens in seinem Zimmer besucht und ihn um Hilfe anfleht. Das klägliche „Sie darf nicht sterben“ – narrativ zunächst durch nichts gestützt - wird nicht nur aufgrund seines rätselhaften Inhalts, sondern vor allem auch durch die Form der medialen Darbietung zum wichtigen Faktor des Filmgelingens. Aus dieser bewusst eingesetzten Klangästhetik spricht ein hohes Gespür für die Wirkung von Ton im Film: Vampyr ist deshalb kein Zwitterwesen aus Stumm- und Tonfilm, wie man vielleicht meinen könnte, sondern Tonfilm ganz und gar, der den Weg „illustrierenden Geschwätzes“ nicht gegangen ist.Dies hat Methode, die sich auf den ganzen Film erstreckt: Der Topos des Vampirs steht unter anderem auch für eine Auflösung der Gegensätze des Alten und des Neuen in eine synthetisierte neue Form: Meist ist er ein Wiedergänger, der seine Zeitsphäre – das Alte – verlassen hat. Zur Zeit der Emanzipation des Bürgertums tritt er auf als der wiedergekommene Aristokrat. Gleichzeitig weist er sich auch als der Überwinder des biologischen Verfalls wie der sexuellen Moralvorstellungen des Bürgertums als ein Menschenentwurf der Zukunft aus, für den zudem die klassische Lohnarbeit als Option nicht mehr in Frage kommt. Diese Hybridität spiegelt sich im Film nicht nur in seiner Synthese von Ton- und Stummfilm, sondern auch in seiner Verhandlung des Vampirs selbst, die hier nicht in die filmische Schauderromantik als vermeintlich authentische Illustration einer Geisteswelt des 19. Jahrhunderts hineingleitet, sondern hier eher den Blick des 20. auf das 19. Jahrhundert (das selbst wiederum ins 18. blickte) im Sinn hat: Der „Vampyr“ des Films wird erst durch ein Buch aus dem 19. Jahrhundert erkennbar und auch nur, als der im Vorspann ausgewiesene „Phantast“ Allan Grey sich darin versenkt. Allan Grey ist dabei anhand seiner Erscheinung – Anzug und Krawatte - deutlich als Mensch des 20. Jahrhunderts zu erkennen, den nostalgische Sehnsüchte nach bestaunenswerter Romantik und Spuk bestimmen. Vermutlich nicht ganz von ungefähr erinnert er auch in manchen Momenten rein äußerlich ein wenig an H.P. Lovecraft, der den eigenen verklärten Blick auf die Kultur und Literatur vergangener Dekaden zur eigenen Methode erhoben hat. In dieser Hinsicht ist Vampyr deshalb ein kluger (Vampir-)Film: Weil er nicht Altes vermeintlich authentisch illustrieren will (vgl. etwa die frühen Gruselfilme der Hammer Studios, gegen die ich damit im übrigen nichts gesagt haben will), sondern weil er seine Vampirgeschichte zur Geschichte vom Verhältnis des Blicks auf seinen Gegenstand erklärt.
Klug ist auch die Inszenierung des Raumes. Wie kaum ein anderes Filmgenre thematisiert der Horrorfilm seinen Raum, respektive dessen Destabilisierung. In kaum einem anderen Genre ist deshalb das Verhältnis von Kamera und Erzählraum so wichtig: Der Horrorfilm ist ein Genre des Close-Ups und des „unmöglichen Winkels“, die Totale findet man indes nur selten und kaum ein Horrorfilm kommt ohne Momente aus, in denen der Raum und seine Stabilität infrage gestellt werden (man denke nur an den berühmten zugezogenen Duschvorhang und was sich wohl dahinter verbergen könnte): Wer im Horrorfilm überlebt und wer nicht, ist meistens, wenn nicht immer, eine Frage dessen, wer sich in welchem Raum wie verhält, wem Macht ihn souverän zu durchqueren zugemessen wird: Deshalb überlebt das Mädchen am Ende von Texas Chain Saw Massacre: Weil sie über den Sprung durch das Fenster ihren Raum zu erweitern weiß und in ihm neue Vektoren auszumachen in der Lage ist, wohingegen dem plumpen Leatherface nur der Gang durchs Treppenhaus einfällt. In Vampyr ist der Raum ebenfalls von Belang: Die Kamera folgt den Figuren erstaunlich behände, zahlreiche Plansequenzen lassen den Raum erkunden, Kreisfahrten bieten Übersichten auf der Horizontalen, denen häufige Detailansichten gegenüber stehen. Dennoch: Ein souveräner Überblick über das komplex konstruierte räumliche Gefüge ist in der Tat kaum möglich. Ganz im Gegenteil stellt sich das Gefühl eines „Durchschwebens“ ein: Wie Allan Grey staunend durch seinen mutmaßlichen „Traumraum“ schreitet, wird auch der Zuschauer vom Verständnis des Raumes als einem authentischen methodisch entrückt.
Die hohe Beweglichkeit der Kamera und die dadurch entstehende Nähe zum Raumgeschehen bedingen dabei einen zusätzlich befremdlichen Effekt: Eigentlich wirkt dieser Film an keiner Stelle wie aus den frühen 30er Jahren. Ganz im Gegenteil meint man sich mindestens in den 60er Jahren zu bewegen. Erinnerungen an Night of the Living Dead werden wach und man hat auch in den folgenden Jahren noch manchen statisch erstarrten Film gesehen. Dies nun lässt den Film vollends ins Surreale kippen: Dass ein Film aus scheinbar späteren Jahrzehnten in eine synthetisierten Form aus Stumm- und Tonfilm in den frühen 30er Jahren auftritt und vom Verhältnis von Gegenwärtigkeit und Vergangenheit handelt, in dem alle Personen selbst schon aus dem Zustand des post mortem heraus zu agieren scheinen (in der Tat: Allan Grey wird an einer Stelle beerdigt, in einer anderen, mittels Doppelbelichtung bewerkstelligten Sequenz löst sich ein durchscheinendes Abbild seiner Selbst von seiner physischen Gestalt und irrlichtert durch die Welt, wie alle Figuren sprechen als seien sie schon nicht mehr lebendig, wie überhaupt alles so wirkt, als sei es die Phantasie eines bereits Gestorbenen), all dies lässt das Filmerleben selbst zu einer Art Trance geraten: In Mitternachtskino haben Hoberman und Rosenbaum auf die religiöse Tradition und kultische Nähe der Zeremonien des cinephilen Mitternachtspublikums der 70er Jahre hingewiesen. Wer Vampyr im Kino sieht – ein Mitternachtsfilm avant la lettre - kann nachempfinden, was diese Bewegung Nacht für Nacht ins Kino gezogen hat, um dort, mittels der Mechanik der Moderne, die jedem Filmbild grundlegende Bedingung zur Möglichkeit ist, die Risse im Gefüge von Raum und Zeit zu erkunden. Dass Vampyr dies in seiner klausulierten Narration spiegelt, ist dabei nur obligatorisch.

imdb ~ senses of cinema ~ kinoeye ~ masterofcinema.org mit einem scan des originalen dänischen filmprogramms.
Weitere Sichtungen aus der Magical History Tour im Weblog hier.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
18. März 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
17.03.2005, Heimkino

Nach der „entfesselten Kamera“ in Der letzte Mann gibt sich Tartüff im gemeinsamen Werk Murnaus und Freunds zuweilen den Anschein einer Rückkehr zur statischen Einstellung. In der Tat gibt es nur einen sehr pointierten Einsatz von Kamerabewegung zu verzeichnen: Wenn die besorgte Elmire ihren Gatten Orgon bittet, heimlich Tartüffs Reaktionen zu beobachten, wenn sie diesen zum Zwecke der Enttarnung umgarnt, fährt die Kamera parallel zur Achse zwischen den Darstellern vom alleine am Fenster stehenden Orgon nach links und erweitert auf diese Weise das zunächst etwas melancholisch-versunken erscheinende Bild um einen eher üblichen dialogischen Raum. Als Tartüff sich zum fingierten Rendezvous einfindet, bewegt sich die Kamera auf ähnliche Weise von Elmire weg und erfasst in einer kreishaften Bewegung den anschließend parzellierten Spielort der folgenden Komödie mit Tartüff als Endansicht ihrer Bewegung. Und als gegen Ende die einzelnen Figuren durchs Treppenhaus des Anwesens schleichen, tastet die Kamera in einer langen Kranfahrt die Kulisse ab und erlaubt so eine finale Übersicht über die Lokalität.
Solche Raumerweiterungen über die Kamerabewegung stehen konträr zu den häufigen Sprüngen ins Detail der Szenerie, die den Film auszeichnen. Vor allem die beiden Verführungsszenen, in denen Tartüff als Heuchler enthüllt werden soll, sind in einer Abfolge spannungssteigernder, oft aus „unmöglichen Winkeln“ geschossener Detailaufnahmen aufgelöst, die das Geschehen in kleine, im Bezug zueinander sinnstiftende Handlungspartikel zerlegt. Gerade mittels dieser häufigen Detailansichten gelingt es Tartüff, das Topos des Heuchlers adäquat zu repräsentieren: Es wird hierdurch eine Sphäre des Heimlichen und Versteckten geschaffen, anhand derer der Zuschauer nach und nach seine Schlüsse über das wahre Wesen des Tartüff ziehen kann.
Diesem analytischen Mikrokosmos steht die formale Sphäre der ansonsten vorherrschenden, üblichen Einstellungen gegenüber, in der das erhellende Detail verloren geht und die Heuchelei also effizient in ihrem Sinne wird. Den besagten Raumerweiterungen durch Kamerabewegungen wiederum kommt eine erhellende Funktion dahingehend zu, dass sie dem ersten (Film-)Anschein selbst trügerische Qualitäten zuspricht. Mit der narrativen Rahmung, die die Adaption der Molièrekomödie selbst als Film-im-Film ausweist und in der sie - über den Umweg einer fingierten, also selbst geheuchelten Kinovorstellung im privaten Kreis - aufklärerische Wirkung zeitigt, ergibt sich insgesamt betrachtet eine Art Telescopage der Heuchelei, der Grundlage des erzählenden Kinos selbst. Der Tartüff ist als Begriff für eine heuchlerische Person in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen - dass der Film selbst den gleichen Titel trägt, ist das letzte Augenzwinkern dieser Parodie.
imdb ~ filmportal.de (mit einigen zeitgenössischen Kritiken!)

Nach der „entfesselten Kamera“ in Der letzte Mann gibt sich Tartüff im gemeinsamen Werk Murnaus und Freunds zuweilen den Anschein einer Rückkehr zur statischen Einstellung. In der Tat gibt es nur einen sehr pointierten Einsatz von Kamerabewegung zu verzeichnen: Wenn die besorgte Elmire ihren Gatten Orgon bittet, heimlich Tartüffs Reaktionen zu beobachten, wenn sie diesen zum Zwecke der Enttarnung umgarnt, fährt die Kamera parallel zur Achse zwischen den Darstellern vom alleine am Fenster stehenden Orgon nach links und erweitert auf diese Weise das zunächst etwas melancholisch-versunken erscheinende Bild um einen eher üblichen dialogischen Raum. Als Tartüff sich zum fingierten Rendezvous einfindet, bewegt sich die Kamera auf ähnliche Weise von Elmire weg und erfasst in einer kreishaften Bewegung den anschließend parzellierten Spielort der folgenden Komödie mit Tartüff als Endansicht ihrer Bewegung. Und als gegen Ende die einzelnen Figuren durchs Treppenhaus des Anwesens schleichen, tastet die Kamera in einer langen Kranfahrt die Kulisse ab und erlaubt so eine finale Übersicht über die Lokalität.
Solche Raumerweiterungen über die Kamerabewegung stehen konträr zu den häufigen Sprüngen ins Detail der Szenerie, die den Film auszeichnen. Vor allem die beiden Verführungsszenen, in denen Tartüff als Heuchler enthüllt werden soll, sind in einer Abfolge spannungssteigernder, oft aus „unmöglichen Winkeln“ geschossener Detailaufnahmen aufgelöst, die das Geschehen in kleine, im Bezug zueinander sinnstiftende Handlungspartikel zerlegt. Gerade mittels dieser häufigen Detailansichten gelingt es Tartüff, das Topos des Heuchlers adäquat zu repräsentieren: Es wird hierdurch eine Sphäre des Heimlichen und Versteckten geschaffen, anhand derer der Zuschauer nach und nach seine Schlüsse über das wahre Wesen des Tartüff ziehen kann.
Diesem analytischen Mikrokosmos steht die formale Sphäre der ansonsten vorherrschenden, üblichen Einstellungen gegenüber, in der das erhellende Detail verloren geht und die Heuchelei also effizient in ihrem Sinne wird. Den besagten Raumerweiterungen durch Kamerabewegungen wiederum kommt eine erhellende Funktion dahingehend zu, dass sie dem ersten (Film-)Anschein selbst trügerische Qualitäten zuspricht. Mit der narrativen Rahmung, die die Adaption der Molièrekomödie selbst als Film-im-Film ausweist und in der sie - über den Umweg einer fingierten, also selbst geheuchelten Kinovorstellung im privaten Kreis - aufklärerische Wirkung zeitigt, ergibt sich insgesamt betrachtet eine Art Telescopage der Heuchelei, der Grundlage des erzählenden Kinos selbst. Der Tartüff ist als Begriff für eine heuchlerische Person in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen - dass der Film selbst den gleichen Titel trägt, ist das letzte Augenzwinkern dieser Parodie.
imdb ~ filmportal.de (mit einigen zeitgenössischen Kritiken!)
° ° °
Thema: Filmtagebuch
26. Februar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Wrap Up meiner jüngsten Filmsichtungen, natürlich wieder ganz ohne Anspruch auf Vollständigkeit ...
Mindhunters (Renny Harlin, USA 2004); Inhalt
Allenfalls solides Versteckspiel mit dem Drehbuch um eine Gruppe FBI-Azubis, die zu Ausbildungszwecken auf einer Insel mit einem simulierten Mörderszenario ausgesetzt werden, um gemeinsam ein Profile zu erstellen. Als der erste von ihnen drastisch ins Gras zu beißen hat, dämmert ihnen, dass hier nicht nur simuliert wird; Psychodynamiken bilden sich innerhalb der Gruppe. Gelegentliche Videoclipspielereien sollen darüber hinwegtäuschen, dass hier mit Logiklöchern durchsetzte Gymnastik mit dem Drehbuchautor durchgeführt wird. Deshalb leidlich spannend, zumal der Whodunnit-Aspekt nur beliebiges Mitraten ermöglicht.
[imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de ~ mrqe]
Ginger Snaps 2 - Unleashed (Brett Sullivan, USA 2004)
Etwas blöd, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Ich bezweifle aber, dass mir die Kenntnis um diesen das Sequel lustvoller gestaltet hätte. Jedenfalls bisweilen ganz netter, zum großen Teil trotz mancher Spannungssequenz paradox entspannt vor sich hinplätschernder Neo-Werwolfstoff, der die im Horrorfilm der letzten Jahre übliche Szientifizierung des Halbwesens nun auch dem Werwolfkomplex erschließt, ohne dabei Bezüge zu traditionellen Erklärungsmustern aufzugeben. Wäre wohl gerne ideenreicher gewesen als er in Wirklichkeit ist.
[imdb]
Wishing Stairs (Jae-yeon Yun, Korea 2003)
Geistergeschichte aus Korea vor zeitgenössischer Kulisse. In einer Mädchenschule erfüllt eine Treppe den beim Überschreiten der letzten Stufe geäußerten Wunsch. Intrigen und Verlust ergeben manch eigennützlichen Wunsch, der den Mädchen schwer zu stehen kommt. Im Kern gibt sich der Film schon damit zufrieden, übliche Schockmomente abzuspulen, die dergestalt zur beliebigen Revue verkommen. Am Ende ist alles ganz traditionell Ghost Story, Möglichkeiten zur Variation werden sträflich ungenutzt verstreichen lassen.
[imdb]
Coogan's großer Bluff (Don Siegel, USA 1968)
Schön routinierte frühe Zusammenarbeit zwischen Siegel und Eastwood, die sich weniger durch Grandezza sondern durch gekonnte Erzählmanöver auszeichnet. Jedes Element sitzt am richtigen Platz und wird später wieder aufgegriffen, ohne dass der Zuschauer mit solchen Bogenspannungen vordergründig belästigt würde. Manches mag noch wie eine Skizze wirken, als rohes Experiment, das Maßgebliches für den später entstandenen Dirty Harry erschließt, aber gerade dieses teils recht rohe, ungeschlachte des Films gefällt mir außerordentlich gut. Ganz famose Sequenzen, bei denen man gerne hinschaut: Coogan im Beat Club und, natürlich, die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Überhaupt sind die Actionsequenzen sehr beeindruckend und geradewegs physisch roh inszeniert.
[imdb ~ mrqe]
Die fetten Jahre sind vorbei (Hans Weingartner, Deutschland 2004); Inhalt
Das also ist der große deutsche Konsensfilm 2004. "Unser Film in Cannes". Ach herrje. Was soll ich sagen? Ein katastrophal an die Wand gefahrener Karren, der sämtliche Möglichkeiten, die sich in der ersten Hälfte noch ergeben, zugunsten reiner Schmonzettenhaftigkeit im zweiten Teil verschenkt. Ein Film von und für Leute(n), die schon während ihrer Anti-Bullenzeit versteckte Sozis waren und es heute dann erst recht sind, sich das dann aber auch wiederum überhaupt nicht eingestehen wollen. Ganz penetrant dann auch, wie einem politsch extreme Weisheiten, die schon in den 80ern Juckreiz verursachten (nicht, weil sie so antibürgerlich gewesen wären, ganz im Gegenteil...), als Manifest für kommende Jahre um die Ohren gehauen und sich am Ende dann in deutschtümelnde Südseeromantik geflüchtet wird. Ein schrecklicher, langweiliger, dummer Film.
[imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de ~ mrqe]
Mindhunters (Renny Harlin, USA 2004); Inhalt
Allenfalls solides Versteckspiel mit dem Drehbuch um eine Gruppe FBI-Azubis, die zu Ausbildungszwecken auf einer Insel mit einem simulierten Mörderszenario ausgesetzt werden, um gemeinsam ein Profile zu erstellen. Als der erste von ihnen drastisch ins Gras zu beißen hat, dämmert ihnen, dass hier nicht nur simuliert wird; Psychodynamiken bilden sich innerhalb der Gruppe. Gelegentliche Videoclipspielereien sollen darüber hinwegtäuschen, dass hier mit Logiklöchern durchsetzte Gymnastik mit dem Drehbuchautor durchgeführt wird. Deshalb leidlich spannend, zumal der Whodunnit-Aspekt nur beliebiges Mitraten ermöglicht.
[imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de ~ mrqe]
Ginger Snaps 2 - Unleashed (Brett Sullivan, USA 2004)
Etwas blöd, wenn man den ersten Teil nicht kennt. Ich bezweifle aber, dass mir die Kenntnis um diesen das Sequel lustvoller gestaltet hätte. Jedenfalls bisweilen ganz netter, zum großen Teil trotz mancher Spannungssequenz paradox entspannt vor sich hinplätschernder Neo-Werwolfstoff, der die im Horrorfilm der letzten Jahre übliche Szientifizierung des Halbwesens nun auch dem Werwolfkomplex erschließt, ohne dabei Bezüge zu traditionellen Erklärungsmustern aufzugeben. Wäre wohl gerne ideenreicher gewesen als er in Wirklichkeit ist.
[imdb]
Wishing Stairs (Jae-yeon Yun, Korea 2003)
Geistergeschichte aus Korea vor zeitgenössischer Kulisse. In einer Mädchenschule erfüllt eine Treppe den beim Überschreiten der letzten Stufe geäußerten Wunsch. Intrigen und Verlust ergeben manch eigennützlichen Wunsch, der den Mädchen schwer zu stehen kommt. Im Kern gibt sich der Film schon damit zufrieden, übliche Schockmomente abzuspulen, die dergestalt zur beliebigen Revue verkommen. Am Ende ist alles ganz traditionell Ghost Story, Möglichkeiten zur Variation werden sträflich ungenutzt verstreichen lassen.
[imdb]
Coogan's großer Bluff (Don Siegel, USA 1968)
Schön routinierte frühe Zusammenarbeit zwischen Siegel und Eastwood, die sich weniger durch Grandezza sondern durch gekonnte Erzählmanöver auszeichnet. Jedes Element sitzt am richtigen Platz und wird später wieder aufgegriffen, ohne dass der Zuschauer mit solchen Bogenspannungen vordergründig belästigt würde. Manches mag noch wie eine Skizze wirken, als rohes Experiment, das Maßgebliches für den später entstandenen Dirty Harry erschließt, aber gerade dieses teils recht rohe, ungeschlachte des Films gefällt mir außerordentlich gut. Ganz famose Sequenzen, bei denen man gerne hinschaut: Coogan im Beat Club und, natürlich, die Verfolgungsjagd auf dem Motorrad. Überhaupt sind die Actionsequenzen sehr beeindruckend und geradewegs physisch roh inszeniert.
[imdb ~ mrqe]
Die fetten Jahre sind vorbei (Hans Weingartner, Deutschland 2004); Inhalt
Das also ist der große deutsche Konsensfilm 2004. "Unser Film in Cannes". Ach herrje. Was soll ich sagen? Ein katastrophal an die Wand gefahrener Karren, der sämtliche Möglichkeiten, die sich in der ersten Hälfte noch ergeben, zugunsten reiner Schmonzettenhaftigkeit im zweiten Teil verschenkt. Ein Film von und für Leute(n), die schon während ihrer Anti-Bullenzeit versteckte Sozis waren und es heute dann erst recht sind, sich das dann aber auch wiederum überhaupt nicht eingestehen wollen. Ganz penetrant dann auch, wie einem politsch extreme Weisheiten, die schon in den 80ern Juckreiz verursachten (nicht, weil sie so antibürgerlich gewesen wären, ganz im Gegenteil...), als Manifest für kommende Jahre um die Ohren gehauen und sich am Ende dann in deutschtümelnde Südseeromantik geflüchtet wird. Ein schrecklicher, langweiliger, dummer Film.
[imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de ~ mrqe]
° ° °
Thema: Filmtagebuch
06. Februar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
01.02.2005, Filmkunsthaus Babylon; in Anwesenheit des Regisseurs.
»Kapitän Gustav will sich mit seinem Schneckenschiff zur wohlverdienten Ruhe setzen. Mit seiner bunt zusammen gewürfelten Mannschaft aus Mensch und Tier - zu der neben zahlreichen Eingeborenen auch ein Bär, eine Eule und fünf Frösche gehören - strandet er an einer geheimnisvollen Insel. Voller Freude auf den Vorruhestand bereitet er sich auf den Landgang vor. Noch ahnt niemand an Bord, dass im Herzen der Insel ein böser König haust. König Knuffi regiert im Zeichen des Teppichklopfers.« (Wenzel Storch über seinen Film)

» ›So ist unser Geschmack, das wird die Welt nach unserem Gusto sein. Demiurgos gefiel sich in ausgewählten, vollkommenen und komplizierten Materialien, wir geben dem Trödel den Vorrang. Uns entzückt und ergreift einfach das Billige, das Minderwertige, das Trödlerhafte des Materials. Versteht ihr‹, fragte mein Vater, ›den tiefen Sinn dieser Schwäche, dieser Leidenschaft für für buntes Dekorationspapier, für Pappmaché, für Lackfarbe, für Werg und Sägespäne? Das ist‹, sprach er mit schmerzlichem Lächeln, ›unsere Liebe für die Materie als solche, für ihre Flaumigkeit und Durchlässigkeit, für ihre einzigartige mystische Konsistenz. Demiurgos, dieser große Meister und Künstler, macht sie unsichtbar, läßt sie aus dem Spiel des Lebens verschwinden. Wir dagegen lieben ihr Knirschen, ihren Widerstand, ihre klotzige Unzierlichkeit. Uns gefällt es, in jeder Geste, in jeder Bewegung ihre schwerfällige Anstrengung, ihre Ohnmacht, ihre süße Bärenhaftigkeit zu sehen.‹ «
Bruno Scholz: Traktat über die Mannequins oder das zweite Buch Genesis. (in: Die Zimtläden.)

Ein schöner, reicher Film, ein Werk der reinsten Liebe zur Kunst. Wer hier von Trash und Provokation spricht, sich allein am Seltsamen aufzieht, der spricht dabei in zweiter Ordnung doch nur von dem Klotz, der seine Sensoren verklemmt, von seiner Lust an miefiger Durchschnittlichkeit, die die Welt unterteilt ins geliebte Übliche und das nun eigentlich verabscheut, was dessen Sphäre verlässt, dieses nicht fassen kann und also über dünkelhaftes Amüsement seins Platzes verweist. Hier, in diesem Film, liegen Schönheiten verborgen, die noch im Banalsten das Liebreizende betonen, die vom Willen, eine bestaunenswerte Welt zu kreieren, künden. Kino zum Staunen, ganz und gar.
imdb | wenzelstorch.de | filmz.de | angelaufen.de
»Kapitän Gustav will sich mit seinem Schneckenschiff zur wohlverdienten Ruhe setzen. Mit seiner bunt zusammen gewürfelten Mannschaft aus Mensch und Tier - zu der neben zahlreichen Eingeborenen auch ein Bär, eine Eule und fünf Frösche gehören - strandet er an einer geheimnisvollen Insel. Voller Freude auf den Vorruhestand bereitet er sich auf den Landgang vor. Noch ahnt niemand an Bord, dass im Herzen der Insel ein böser König haust. König Knuffi regiert im Zeichen des Teppichklopfers.« (Wenzel Storch über seinen Film)

» ›So ist unser Geschmack, das wird die Welt nach unserem Gusto sein. Demiurgos gefiel sich in ausgewählten, vollkommenen und komplizierten Materialien, wir geben dem Trödel den Vorrang. Uns entzückt und ergreift einfach das Billige, das Minderwertige, das Trödlerhafte des Materials. Versteht ihr‹, fragte mein Vater, ›den tiefen Sinn dieser Schwäche, dieser Leidenschaft für für buntes Dekorationspapier, für Pappmaché, für Lackfarbe, für Werg und Sägespäne? Das ist‹, sprach er mit schmerzlichem Lächeln, ›unsere Liebe für die Materie als solche, für ihre Flaumigkeit und Durchlässigkeit, für ihre einzigartige mystische Konsistenz. Demiurgos, dieser große Meister und Künstler, macht sie unsichtbar, läßt sie aus dem Spiel des Lebens verschwinden. Wir dagegen lieben ihr Knirschen, ihren Widerstand, ihre klotzige Unzierlichkeit. Uns gefällt es, in jeder Geste, in jeder Bewegung ihre schwerfällige Anstrengung, ihre Ohnmacht, ihre süße Bärenhaftigkeit zu sehen.‹ «
Bruno Scholz: Traktat über die Mannequins oder das zweite Buch Genesis. (in: Die Zimtläden.)

Ein schöner, reicher Film, ein Werk der reinsten Liebe zur Kunst. Wer hier von Trash und Provokation spricht, sich allein am Seltsamen aufzieht, der spricht dabei in zweiter Ordnung doch nur von dem Klotz, der seine Sensoren verklemmt, von seiner Lust an miefiger Durchschnittlichkeit, die die Welt unterteilt ins geliebte Übliche und das nun eigentlich verabscheut, was dessen Sphäre verlässt, dieses nicht fassen kann und also über dünkelhaftes Amüsement seins Platzes verweist. Hier, in diesem Film, liegen Schönheiten verborgen, die noch im Banalsten das Liebreizende betonen, die vom Willen, eine bestaunenswerte Welt zu kreieren, künden. Kino zum Staunen, ganz und gar.
imdb | wenzelstorch.de | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
04.02.2005, Heimkino
Ich habe auf diese Sichtung fast zwei Jahre gewartet. Erwartungen: keine. Die beste Haltung, einem Film zu begegnen, dessen man lange nicht habhaft wurde. Hoffnungen? Zugegeben, viele. Ich halte Buffalo '66 für ein begnadetes Stück eigenbrötlerisches Independent-Kino und Gallo selbst, bei allen politischen Differenzen, für eines der letzten exzentrischen Künstlerwesen, die sich diesen Status noch erlauben dürfen. Natürlich waren da die Kontroversen in Cannes. Die waren abzusehen und an sich auch nicht aussagekräftig. Dann kam eine begeisterte Kritik eines geschätzten Filmfreundes zur letzten Berlinale, wo der Film nur im mir nicht zugänglichen Filmmarkt zu sehen war, und dann natürlich tauchte der Film auf vielen, geschätzten Top-2004-Listen auf. Sogar auf denen mancher Kritiker, die sich in Cannes nicht einkriegen konnten mit ihren Schmähreden. Gestern dann, endlich, war es soweit.
*

Langverweilende Bilder und Einstellungen. Nicht so sehr erzählende, eher zeigende. Understatementhaft, zumal nach dem ästhetisch hoch- und durchkonzipierten Buffalo '66. Eine Leere, die sich in der Weite und oft Relieflosigkeit der Landschaft spiegelt und, wie zu sehen sein wird, mit der im Protagonisten, Gallo selbst, korresondiert. Eine Leere, die schuldzerfressen ist.
*

Bud Clay ist Motorradrennfahrer. Er zieht durch's Land, von Rennen zu Rennen. Versuche von Affären am Straßenrand. Charisma und höllisch gutes Aussehen (der Mann ist 41!) hat er für zwei. Küsse, dann Tränen. Die Intimitäten zerbrechen, bevor sie überhaupt beginnen. Weiter durch's Land. Am Ende der Verlust, "mono-dialogisch" gezeigt, eine Rückblende noch darin selbst. Standbild, aus.
*

Lichtstrahlen fallen ins Bild, ergeben Flächen, Punkte, Spiele im Bild. Immer wieder der Blick nach vorne aus dem Buick, durch die Scheibe, auf der sich Schmutz und tote Insekten ausmachen lassen. Die Sonne blitzt noch kurz auf, bevor sie hinter dem Berg verschwindet. Karge Landschaften, Musik wie aus anderen Zeiten (und natürlich geht es auch hier, wie bei Buffalo '66 immer um das, was nicht mehr im Nostalgiebild zu fassen zu kriegen ist, wie also das Bild, das von Vergangenheit durchtränkt ist, Wesentliches der Vergangenheit eigentlich verdrängt, ungreifbar macht. Es ist ein instinktiv kluger, kein konzeptionell-intellektueller Umgang mit dem Bild in der Geschichte seines Protagonisten, den Gallo hier an den Tag legt.). Man könnte kurz an einen Western denken, dem Genre, das von der Landschadt maßgeblich lebt. Doch wo im Western die Landschaft und die Frau bezwungen werden muss, ist Gallos Held kein Westerner. Er ist vielmehr einer, der die bereits endlos durchmessene, unendlich oft eroberte Landschaft einmal mehr durchreist, immer auf der Suche nach dem, was noch jenseits dessen liegen könnte, dabei aber immer in der Landschaft, im Bild, in seinem Leben bleiben muss. Ein Tableauartiges Bild in der Salzwüste, bestimmt von der Horizontlinie, davor der Buick, das Motorrad, Gallo, dessen Kopf milimetergenau die Horizontlinie tangiert, wie auch die Oberkante des Wagens dies tut. Er fährt hinaus in das Weiß der Wüste, verschwimmmt, wird Teil von ihr, erreicht aber nichts Neues. Melancholisches Folgebild: Der Wagen, wie er enttäuscht sich von dieser Sphäre abwendet, nicht aber verlässt.

*
Narzismus, Moralität? Nein. Und wenn schon.

*
An einer Stelle erinnert mich der Film an Two-Lane Blacktop. Und natürlich an Gerry. Auch wenn alle drei nur wenig eint, streichen ihre Membrane an manchen Stellen aneinander.
*
Keine Geschichte im klassischen Sinne. Und vor allem: Keine Psychologie. Zumindest nicht im Narrativ. Wohl aber in den Bildern und ihrer Organisation. Die Leerstelle, das Trauma, ist anwesend durch Abwesenheit. Die mangelnde pathologische Ebene des Films ist dabei klarer Vorteil, ein weiteres Indiz für seine Klugheit.
*
Ich liebte es, diesen schönen Film im großen Kino zu sehen. Das ist mein Wunsch für die nächsten Jahre.
imdb | offizielle Website | vincentgallo.com | galloappreciation.com

Ich habe auf diese Sichtung fast zwei Jahre gewartet. Erwartungen: keine. Die beste Haltung, einem Film zu begegnen, dessen man lange nicht habhaft wurde. Hoffnungen? Zugegeben, viele. Ich halte Buffalo '66 für ein begnadetes Stück eigenbrötlerisches Independent-Kino und Gallo selbst, bei allen politischen Differenzen, für eines der letzten exzentrischen Künstlerwesen, die sich diesen Status noch erlauben dürfen. Natürlich waren da die Kontroversen in Cannes. Die waren abzusehen und an sich auch nicht aussagekräftig. Dann kam eine begeisterte Kritik eines geschätzten Filmfreundes zur letzten Berlinale, wo der Film nur im mir nicht zugänglichen Filmmarkt zu sehen war, und dann natürlich tauchte der Film auf vielen, geschätzten Top-2004-Listen auf. Sogar auf denen mancher Kritiker, die sich in Cannes nicht einkriegen konnten mit ihren Schmähreden. Gestern dann, endlich, war es soweit.
*

Langverweilende Bilder und Einstellungen. Nicht so sehr erzählende, eher zeigende. Understatementhaft, zumal nach dem ästhetisch hoch- und durchkonzipierten Buffalo '66. Eine Leere, die sich in der Weite und oft Relieflosigkeit der Landschaft spiegelt und, wie zu sehen sein wird, mit der im Protagonisten, Gallo selbst, korresondiert. Eine Leere, die schuldzerfressen ist.
*

Bud Clay ist Motorradrennfahrer. Er zieht durch's Land, von Rennen zu Rennen. Versuche von Affären am Straßenrand. Charisma und höllisch gutes Aussehen (der Mann ist 41!) hat er für zwei. Küsse, dann Tränen. Die Intimitäten zerbrechen, bevor sie überhaupt beginnen. Weiter durch's Land. Am Ende der Verlust, "mono-dialogisch" gezeigt, eine Rückblende noch darin selbst. Standbild, aus.
*

Lichtstrahlen fallen ins Bild, ergeben Flächen, Punkte, Spiele im Bild. Immer wieder der Blick nach vorne aus dem Buick, durch die Scheibe, auf der sich Schmutz und tote Insekten ausmachen lassen. Die Sonne blitzt noch kurz auf, bevor sie hinter dem Berg verschwindet. Karge Landschaften, Musik wie aus anderen Zeiten (und natürlich geht es auch hier, wie bei Buffalo '66 immer um das, was nicht mehr im Nostalgiebild zu fassen zu kriegen ist, wie also das Bild, das von Vergangenheit durchtränkt ist, Wesentliches der Vergangenheit eigentlich verdrängt, ungreifbar macht. Es ist ein instinktiv kluger, kein konzeptionell-intellektueller Umgang mit dem Bild in der Geschichte seines Protagonisten, den Gallo hier an den Tag legt.). Man könnte kurz an einen Western denken, dem Genre, das von der Landschadt maßgeblich lebt. Doch wo im Western die Landschaft und die Frau bezwungen werden muss, ist Gallos Held kein Westerner. Er ist vielmehr einer, der die bereits endlos durchmessene, unendlich oft eroberte Landschaft einmal mehr durchreist, immer auf der Suche nach dem, was noch jenseits dessen liegen könnte, dabei aber immer in der Landschaft, im Bild, in seinem Leben bleiben muss. Ein Tableauartiges Bild in der Salzwüste, bestimmt von der Horizontlinie, davor der Buick, das Motorrad, Gallo, dessen Kopf milimetergenau die Horizontlinie tangiert, wie auch die Oberkante des Wagens dies tut. Er fährt hinaus in das Weiß der Wüste, verschwimmmt, wird Teil von ihr, erreicht aber nichts Neues. Melancholisches Folgebild: Der Wagen, wie er enttäuscht sich von dieser Sphäre abwendet, nicht aber verlässt.

*
Narzismus, Moralität? Nein. Und wenn schon.

*
An einer Stelle erinnert mich der Film an Two-Lane Blacktop. Und natürlich an Gerry. Auch wenn alle drei nur wenig eint, streichen ihre Membrane an manchen Stellen aneinander.
*
Keine Geschichte im klassischen Sinne. Und vor allem: Keine Psychologie. Zumindest nicht im Narrativ. Wohl aber in den Bildern und ihrer Organisation. Die Leerstelle, das Trauma, ist anwesend durch Abwesenheit. Die mangelnde pathologische Ebene des Films ist dabei klarer Vorteil, ein weiteres Indiz für seine Klugheit.
*
Ich liebte es, diesen schönen Film im großen Kino zu sehen. Das ist mein Wunsch für die nächsten Jahre.
imdb | offizielle Website | vincentgallo.com | galloappreciation.com

° ° °
Thema: Filmtagebuch
05. Februar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
In About Schmidt (filmz.de) warf Alexander Payne einen kompromittierenden Blick auf Jack Nicholsons Hinterteil und ließ – zur Belustigung der Insassen diverser Internetforen – Kathy Bates nackend zu Nicholson in den Pool steigen. Die Reise, die dem Film das narrative Rückgrat bot, war, nicht nur dahingehend, eine hinter die Fassaden des bürgerlichen Lebens, die einen Blick ermöglichte hinter die nur vorgeblich sinnstiftenden Strukturierungen der absurden Zustände, unter denen der ins Alter gekommene Mensch des frühen 21. Jahrhunderts sein Dasein einrichtet. Das buchstäblich „pein-liche“ dieser Ansichten und Begebenheiten regulierte About Schmidt durch einen Gestus der liebenswerten Schrulligkeit und eine Lakonie, die auch das würdelose Sterben von Schmidts Frau während Küchenarbeiten – und eben die dargebotenen Nuditäten – dem Zuschauer erträglich machten. Sideways, Paynes neuer Film und nach sehr euphorischen Kritiken in den USA nun auch einer der großen Oscarfavoriten des Jahres, erscheint da als in mancherlei Hinsicht deckungsgleich. Wieder steht eine Reise im Mittelpunkt des Geschehens, wieder geht es um Menschen, die ihre Blüte schon hinter sich gelassen haben und, natürlich, darf man auch wieder einen peinlich entblößten Arsch sehen, diesmal noch narrativ verdoppelt ertappt: Beim Vögeln durch einen unversehens ins Geschehen Hineinplatzenden erwischt. Ein Unterschied ist diesmal doch gegeben: Payne macht das pein-liche der Bilder diesmal oft schmerzhaft spürbar, der Blick, so scheint es zumindest zunächst, ist diesmal schärfer (doch der Schein ist oft trügerisch).

Im Zentrum stehen zwei alte alte College-Freunde, Miles (Paul Giamatti, der bereits in dem wunderbaren American Splendor (filmz.de) den im Leben Gestrandeten bot), ein erfolgloser, weil unveröffentlichter Schriftsteller und Englischlehrer mitten in der schmerbäuchigen Midlife Crisis, der seine Scheidung vor zwei Jahren nicht verwinden kann, und der abgetakelte, dennoch fast schmerzlich lebensheitere und darin reichlich tumbe Fernsehseriendarsteller Jack (Thomas Haden Church), der in einer Woche heiraten wird. Die Zeit dahin nutzen die beiden für eine Junggesellenabschied in Form einer einwöchigen Autofahrt durch die kalifornischen Weinanbaugebiete: Während Miles, ganz Connaisseur, die Woche vor allem auf Weinverköstigungen zubringen und seinen Gaumen erfreuen möchte, steht Jack der Sinn in erster Linie nach billigem Vergnügen mit leichten Frauen, um die Zeit vor der Eheschließung noch effizient zu nutzen, wie er ganz unzweideutig zu erkennen gibt. Mit der melancholischen Schwermut seines Reisebegleiters kann er hingegen nichts anfangen. Ganz im Gegenteil will er Miles von dieser durch allerlei Animationen, es ihm doch gleich zu tun, kurieren.
Die Gelegenheit bietet sich, als beide Bekanntschaft mit der Kellnerin Maja (Virgina Madsen), die sich ebenfalls als respektable Weinkennerin entpuppt, und Stephanie (Sarah Oh) schließen. Während Miles’ Komplexe das Anbandeln mit Maja eigentlich schon sabotieren, vögelt sich Jack derweil mit Sarah quer durch die Hotelzimmer. Konflikte, weinschwangere Gespräche, allerlei Slapstick und Verwechslungen sind da vorprogrammiert.
Sideways entblößt ebenfalls nicht Maskeraden, sondern Eigentlichkeiten des Menschen. Wenn kurz vor Aufbruch zur Reise noch Miles’ Mutter – sie hat Geburtstag – besucht werden muss, wird die Glückwunschkarte wenige Meter von der Tür entfernt kurz und bündig beschrieben: Eine Farce, wenn man bedenkt, dass Miles Schriftsteller ist. Natürlich ist die Mutter – wie offenbar alle älteren Damen bei Payne – eine abgetakelte, eher skurrile Schnepfe mit vogelnestartigem Haarwuchs und morgenmantelfreigelegten blassen Hühnerbeinen, die zur Feier des Tages dann auch noch groteskes Make-Up auflegt. Selbstredend klaut Miles heimlich der Mutter Geld aus der Sparbüchse, wenn sie mit Jack konversiert. Eine Boshaftigkeit wie bei Todd Solondz, der regelmäßig menschliche Scheußlichkeiten aus- und bloßstellt, stellt sich hier hingegen nicht ein. Dafür wiederum will Sideways doch zu sehr die selbsternannten Connaisseurs jenseits der 40 im Publikum umschmeicheln, die sich selbst auf der Leinwand gespiegelt sehen wollen. Und weil ein Roadmovie immer auch eine Entwicklung der Hauptfigur zum Thema hat, ist es, auch wenn das Roadmovie als solches schon bald ins Stocken gerät, kein Wunder, dass nun Miles, der selbst eigentlich, trotz aller literarischer Tiefsinnigkeit (oder: vielleicht ja gerade deswegen), ein Unsympath ist, am Ende, nach allen Konflikten und Missverständnissen, in die vor allem Jacks frohselig-dumpfe Art ihn manövriert, sein Scheidungstrauma vermutlich überwindet und das ihm narrativ zugestandene Mädchen ergattern kann (der Film selbst impliziert’s jedenfalls). Gerade in dieser Versöhnlichkeit, in die der Film immer wieder, nachdem er manche menschliche Verfehlung bis zur Grenze an die physische Nachempfindbarkeit durchdekliniert hat, liegt letzten Endes auch seine Schwäche, die in der allgemein jubilatorisch ausgefallenen Kritik gerne unterschlagen wird: Er macht den Zuschauer zum Komplizen, bis dahin sogar – und das ist durchaus gruselig -, dass er Jacks Lebenswandel und dessen Konsequenzen derart mit Lust aufbauscht, dass sich regelrechte Rachegelüste einstellen, die auch prompt bedient werden, wenn er nun endlich, ja endlich seinen nicht zu knapp ausfallenden Rüffel erhält, unter johlendem Applaus des Publikums, versteht sich (und ich nehme mich da gar nicht aus).

Dies ist - neben der stellenweise arg übertriebenen Redseligkeit, die doch kaum zu was führt - eigentlich schade, denn auf der anderen Seite ist Sideways auch ein keineswegs schlechter oder scheußlicher Film. Vor allem die darstellerischen Leistungen sind bemerkenswert: Man nimmt sich zurück, grimassiert sich nicht, legt Wert auf Nuancen und Details und kann dieses Niveau auch im Zusammenspiel konsequent halten. Fernerhin gibt es selbstredend auch Momente, die bezaubern, nett anzusehen sind. Dass der Film dabei nie, in welche Richtung auch immer, konsequent bleibt, dass er den Kuchen essen und behalten will, ist indes ein trauriges Indiz für die, letzten Endes, Durchkalkuliertheit eines Films, der ganz offensichtlich mit Blick auf den Goldjungen hininszeniert wurde, zu Lasten anderer Ambitionen, leider.
imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de

Im Zentrum stehen zwei alte alte College-Freunde, Miles (Paul Giamatti, der bereits in dem wunderbaren American Splendor (filmz.de) den im Leben Gestrandeten bot), ein erfolgloser, weil unveröffentlichter Schriftsteller und Englischlehrer mitten in der schmerbäuchigen Midlife Crisis, der seine Scheidung vor zwei Jahren nicht verwinden kann, und der abgetakelte, dennoch fast schmerzlich lebensheitere und darin reichlich tumbe Fernsehseriendarsteller Jack (Thomas Haden Church), der in einer Woche heiraten wird. Die Zeit dahin nutzen die beiden für eine Junggesellenabschied in Form einer einwöchigen Autofahrt durch die kalifornischen Weinanbaugebiete: Während Miles, ganz Connaisseur, die Woche vor allem auf Weinverköstigungen zubringen und seinen Gaumen erfreuen möchte, steht Jack der Sinn in erster Linie nach billigem Vergnügen mit leichten Frauen, um die Zeit vor der Eheschließung noch effizient zu nutzen, wie er ganz unzweideutig zu erkennen gibt. Mit der melancholischen Schwermut seines Reisebegleiters kann er hingegen nichts anfangen. Ganz im Gegenteil will er Miles von dieser durch allerlei Animationen, es ihm doch gleich zu tun, kurieren.
Die Gelegenheit bietet sich, als beide Bekanntschaft mit der Kellnerin Maja (Virgina Madsen), die sich ebenfalls als respektable Weinkennerin entpuppt, und Stephanie (Sarah Oh) schließen. Während Miles’ Komplexe das Anbandeln mit Maja eigentlich schon sabotieren, vögelt sich Jack derweil mit Sarah quer durch die Hotelzimmer. Konflikte, weinschwangere Gespräche, allerlei Slapstick und Verwechslungen sind da vorprogrammiert.
Sideways entblößt ebenfalls nicht Maskeraden, sondern Eigentlichkeiten des Menschen. Wenn kurz vor Aufbruch zur Reise noch Miles’ Mutter – sie hat Geburtstag – besucht werden muss, wird die Glückwunschkarte wenige Meter von der Tür entfernt kurz und bündig beschrieben: Eine Farce, wenn man bedenkt, dass Miles Schriftsteller ist. Natürlich ist die Mutter – wie offenbar alle älteren Damen bei Payne – eine abgetakelte, eher skurrile Schnepfe mit vogelnestartigem Haarwuchs und morgenmantelfreigelegten blassen Hühnerbeinen, die zur Feier des Tages dann auch noch groteskes Make-Up auflegt. Selbstredend klaut Miles heimlich der Mutter Geld aus der Sparbüchse, wenn sie mit Jack konversiert. Eine Boshaftigkeit wie bei Todd Solondz, der regelmäßig menschliche Scheußlichkeiten aus- und bloßstellt, stellt sich hier hingegen nicht ein. Dafür wiederum will Sideways doch zu sehr die selbsternannten Connaisseurs jenseits der 40 im Publikum umschmeicheln, die sich selbst auf der Leinwand gespiegelt sehen wollen. Und weil ein Roadmovie immer auch eine Entwicklung der Hauptfigur zum Thema hat, ist es, auch wenn das Roadmovie als solches schon bald ins Stocken gerät, kein Wunder, dass nun Miles, der selbst eigentlich, trotz aller literarischer Tiefsinnigkeit (oder: vielleicht ja gerade deswegen), ein Unsympath ist, am Ende, nach allen Konflikten und Missverständnissen, in die vor allem Jacks frohselig-dumpfe Art ihn manövriert, sein Scheidungstrauma vermutlich überwindet und das ihm narrativ zugestandene Mädchen ergattern kann (der Film selbst impliziert’s jedenfalls). Gerade in dieser Versöhnlichkeit, in die der Film immer wieder, nachdem er manche menschliche Verfehlung bis zur Grenze an die physische Nachempfindbarkeit durchdekliniert hat, liegt letzten Endes auch seine Schwäche, die in der allgemein jubilatorisch ausgefallenen Kritik gerne unterschlagen wird: Er macht den Zuschauer zum Komplizen, bis dahin sogar – und das ist durchaus gruselig -, dass er Jacks Lebenswandel und dessen Konsequenzen derart mit Lust aufbauscht, dass sich regelrechte Rachegelüste einstellen, die auch prompt bedient werden, wenn er nun endlich, ja endlich seinen nicht zu knapp ausfallenden Rüffel erhält, unter johlendem Applaus des Publikums, versteht sich (und ich nehme mich da gar nicht aus).

Dies ist - neben der stellenweise arg übertriebenen Redseligkeit, die doch kaum zu was führt - eigentlich schade, denn auf der anderen Seite ist Sideways auch ein keineswegs schlechter oder scheußlicher Film. Vor allem die darstellerischen Leistungen sind bemerkenswert: Man nimmt sich zurück, grimassiert sich nicht, legt Wert auf Nuancen und Details und kann dieses Niveau auch im Zusammenspiel konsequent halten. Fernerhin gibt es selbstredend auch Momente, die bezaubern, nett anzusehen sind. Dass der Film dabei nie, in welche Richtung auch immer, konsequent bleibt, dass er den Kuchen essen und behalten will, ist indes ein trauriges Indiz für die, letzten Endes, Durchkalkuliertheit eines Films, der ganz offensichtlich mit Blick auf den Goldjungen hininszeniert wurde, zu Lasten anderer Ambitionen, leider.
imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
31. Januar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
30.01.2005, Heimkino
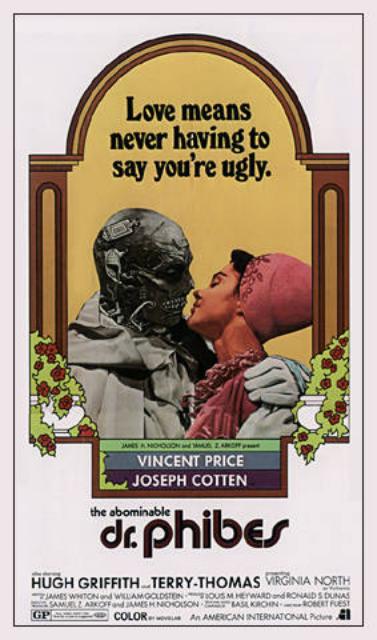
»Der nach einem Unglück geheimnisvoll am Leben gebliebene Musiker und Theologe Dr. Phibes nimmt an neun Personen, die er fälschlich des Mordes an seiner Frau bezichtigt, auf bizarre Weise, nach Art der ägyptischen Plagen, tödliche "Rache".« (Lexikon des internationalen Films)
- Das hat Methode!
(Inspector Trout im Film)
Wieder ein Film, der unverdient in den unteren Schubladen der offiziellen Filmgeschichtsschreibung vor sich hindarbt, ohne näher oder gar jenseits von dünkelnder Trash-Haltung beachtet zu werden. Ganz im Gegenteil aber ein Film, der aufregend ist, bisweilen amüsant und immer konzentriert bei sich. An einem Punkt der Geschichte entstanden, an dem der klassische Gruselfilm eine Scheitelstelle erreicht hatte, an der das baldige Umkippen in Ausstattungstrash bereits deutlich in der Luft lag, ist er sich dessen voll bewusst und leistet nicht weniger als den rückblickenden Beschluss seiner Tradition durch sie selbst, indem er sie in eine merkwürdig flirrende Zusammenfassung final umreißt, archiviert und umfassend erschließt. Der Film ist so voll von Vernetzungen, Verweisen und diskursiven Verhandlungen nicht nur allein zitierender Art, dass ich fast von einem Meta-Gruselfilm sprechen möchte. Trotzdem er stets unter dieser Fülle zu bersten droht, behält er ganz bemerkenswert alle Fäden (zahlreiche!) in der Hand, dabei nie verkopft vor den Kopf stoßend, stets das Publikum im Auge. Diese Fülle an mal angetipptem, mal verhandeltem Material lässt, neben der auffällig die Etablierung einer Narration sabotierenden Exposition, darauf schließen, dass dies durchaus im Sinne der Macher stand, hier nicht so sehr "Spannnugskino", sondern "Meta-Kino" zu gestalten.
Eine Groteske, wie alle altmodischen Gruselfilme auch morbider Liebesfilm und selbstredend auch Kommentar zur Mediengeschichte und wie die im Zusammenhang steht mit Film und Horrorfilm, wie ja fast jedes Beispiel dieser Gattung zu den Medien eine ganz besondere Affinität pflegt.
Es ist, wie so oft, ein Kreuz: Man müsste viel, sehr viel, zu diesem wunderbaren Film schreiben, allein, es fehlt wieder an der Zeit, an der Muse. Doch kann kein Text die ästhetische Erfahrung selbst ersetzen: Verstehen Sie das als dringende Empfehlung, diesen morbiden, schrägen, schönen, klugen Film selbst einmal zu sichten.
imdb | mrqe | media@mgm | vincent price im tv
filmtagebuch: vincent price
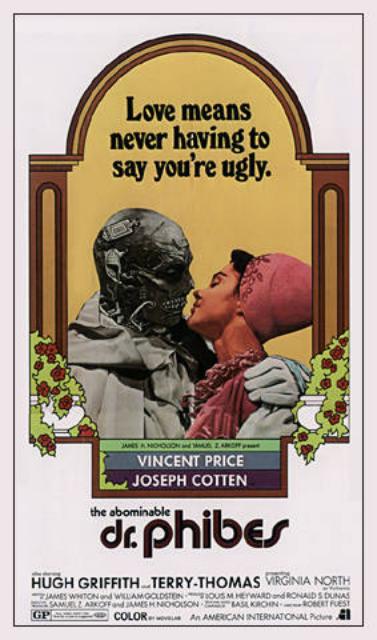
»Der nach einem Unglück geheimnisvoll am Leben gebliebene Musiker und Theologe Dr. Phibes nimmt an neun Personen, die er fälschlich des Mordes an seiner Frau bezichtigt, auf bizarre Weise, nach Art der ägyptischen Plagen, tödliche "Rache".« (Lexikon des internationalen Films)
- Das hat Methode!
(Inspector Trout im Film)
Wieder ein Film, der unverdient in den unteren Schubladen der offiziellen Filmgeschichtsschreibung vor sich hindarbt, ohne näher oder gar jenseits von dünkelnder Trash-Haltung beachtet zu werden. Ganz im Gegenteil aber ein Film, der aufregend ist, bisweilen amüsant und immer konzentriert bei sich. An einem Punkt der Geschichte entstanden, an dem der klassische Gruselfilm eine Scheitelstelle erreicht hatte, an der das baldige Umkippen in Ausstattungstrash bereits deutlich in der Luft lag, ist er sich dessen voll bewusst und leistet nicht weniger als den rückblickenden Beschluss seiner Tradition durch sie selbst, indem er sie in eine merkwürdig flirrende Zusammenfassung final umreißt, archiviert und umfassend erschließt. Der Film ist so voll von Vernetzungen, Verweisen und diskursiven Verhandlungen nicht nur allein zitierender Art, dass ich fast von einem Meta-Gruselfilm sprechen möchte. Trotzdem er stets unter dieser Fülle zu bersten droht, behält er ganz bemerkenswert alle Fäden (zahlreiche!) in der Hand, dabei nie verkopft vor den Kopf stoßend, stets das Publikum im Auge. Diese Fülle an mal angetipptem, mal verhandeltem Material lässt, neben der auffällig die Etablierung einer Narration sabotierenden Exposition, darauf schließen, dass dies durchaus im Sinne der Macher stand, hier nicht so sehr "Spannnugskino", sondern "Meta-Kino" zu gestalten.
Eine Groteske, wie alle altmodischen Gruselfilme auch morbider Liebesfilm und selbstredend auch Kommentar zur Mediengeschichte und wie die im Zusammenhang steht mit Film und Horrorfilm, wie ja fast jedes Beispiel dieser Gattung zu den Medien eine ganz besondere Affinität pflegt.
Es ist, wie so oft, ein Kreuz: Man müsste viel, sehr viel, zu diesem wunderbaren Film schreiben, allein, es fehlt wieder an der Zeit, an der Muse. Doch kann kein Text die ästhetische Erfahrung selbst ersetzen: Verstehen Sie das als dringende Empfehlung, diesen morbiden, schrägen, schönen, klugen Film selbst einmal zu sichten.
imdb | mrqe | media@mgm | vincent price im tv
filmtagebuch: vincent price
° ° °
lol