Thema: Filmtagebuch
05. Juni 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
01.06.2005, Kino Arsenal
Eine entlegene Insel im Pazifik als Ort schrecklicher Experimente: Ein hervorragend spielender Charles Laughton (Simon hat hier eine sehr schöne Beobachtung festgehalten, die es ziemlich genau auf den Punkt trifft) gibt den Dr. Moreau, der im „House of Pain“, einem Schreckenskabinett von OP, das den Mengele bereits erahnen lässt, mit plastisch-chirurgischen Eingriffen die Tiere sukzessive zum Menschen macht. Doch ist der Eingriff nicht allein biologischer Natur: Auf wundersame Weise erlangen diese Bastarde der Evolution auch Intelligenz und Artikulationsvermögen, wenn auch beides im eingeschränkten Maße. In den umliegenden Dschungeln hausen bereits die Ape Men in Siedlungen nach indigener Art, sie sind wild anzusehende, von der Kamera im vollen Bewusstsein des grellen Effekts inszenierte Kreaturen, die sich im steten Widerstreit zwischen animalischer Natur und zivilisatorischem Befriedungsprozess befinden. An ihrer Spitze: Ein zunächst nur an seinem bewusst eingesetzten Akzent erkennbarer (und in den Credits übergangener) Béla Lugosi, der seine Schicksalsgenossen wiederholt zu Kultur und Ethik aufruft, zum Ende hin aber, wenn die Wesen den Aufstand gegen ihren Herren wagen, als Rädelsführer auftritt.
Dieses Laborexperiment unter natürlichen Umständen mit den Mechanismen der Evolution wird durch den Aufritt eines Fremden jäh erschüttert. Parker ist ein Schiffbrüchiger, den es unter etwas verzwickten Umständen, für deren Schilderung die Exposition sich zunächst lange Zeit nimmt, auf die Insel verschlägt. Doch Moreau wittert seine große Chance: Sein ganzer Stolz ist Luta, eine bereits ansehnlich vollendete Pantherfrau, die er mit Parker konfrontiert, um zu sehen, ob ihre Menschwerdung bereits dahingelangt sei, dass sich auch leidenschaftliche und nicht zuletzt sexuelle Gelüste zur frisch beigetretenen Spezies einstellen. Und es gelingt: Zwar bleibt der adrette und leider Gottes eben auch verlobte Parker auf Distanz – die Kopulation und der erhoffte Nachwuchs stellen sich nicht ein –, doch ist das bemitleidenswerte Wesen dem jungen Mann vom ersten Anblick an hoffnungslos verfallen. Unterdessen trifft auch Parkers Verlobte samt Rettungsteam auf der Insel ein. Doch Moreaus Pläne erweisen sich als flexibel ...
Island of Lost Souls ist ein in mancher Hinsicht vielleicht krude, aber höchst effektiv inszenierter Film. Wie so oft im Horror- und Gruselkino ist auch hier der hermetisch geschlossene Eindruck nachrangig, es zählen vor allem jene Momentinseln, die den Zuschauer regelrecht anspringen. Momente der empfundenen Leere mögen dabei nur Wegbereiter für die Qualität des Bruchs mit der im klassischen Kino auf innere Geschlossenheit abzielenden Diegese darstellen. In seinem vielzitierten Aufsatz „Kino der Attraktionen“ hat der Filmwissenschaftler Tom Gunning diese Geschlossenheit als konstituierenden Aspekt des klassisch-narrativen Films hervorgehoben. In Island of Lost Souls wird diese in schöner Regelmäßigkeit und mit viel Gewinn durchbrochen: Seien es Dialoge zwischen Moreau und Parker, die in härtester Form des Schuss-/Gegenschussverfahrens – in zwei direkte Gegenüberstellungen mit dem direkten Blick in die Kamera – aufgelöst werden, oder aber das „Erstürmen der Kamera“ durch die Ape Men am Ende des Films: In schöner Regelmäßigkeit begeht der Film den Übergriffe auf den Zuschauer, der oft genug ob der direkten Ausrichtung der Bilder gegen ihn selbst sich in den Sessel drückt. Das Grobe der schrecklichen Fratzen wird dabei durch die konsequent schattierende Ausleuchtung hervorgehoben – mag Island oft grobschlächtig wirken (vor allem auch aufgrund zahlreicher unterschlagener Geräusche der Diegese; man war seinerzeit noch nah am Stummfilm), so erweist sich doch gerade in dieser formalen Gestaltung das vielleicht nicht intellektuell motivierte, aber intuitive Gespür für Effizienz.
Wie viele andere Horrorfilme jener Zeit ist auch Island natürlich nahe ans Melodram geschmiegt. Die These vom Gruselkino als Simulationsraum für das Eintreten des "Anderen" ins Gefüge, das aus rein ideologischen Gründen aus jenem wieder zu bannen sei, ist zumindest für das frühe klassische Horrorkino in dieser rigorosen Form nicht haltbar. Wie in Freaks, wie in Frankenstein, ein bisschen auch wie in King Kong gilt auch hier die solidarische Empathie vorrangig den Ausgestoßenen, geradewegs romantische Wehmut löst die Mensch gewordene Pantherfrau aus, die an ihren Zurückweisungen zugrunde geht und am Ende das Selbstopfer wagt, nicht nur um dem Geliebten die Flucht zu ermöglichen, sondern auch, um ihrer eigenen Tragödie zu entkommen. Gerade auch im überdeutlich inszenierten Kontrast der ausgestellten Kolonialherren-Zivilisiertheit des Dr. Moreau zu den anthropomorphisierten Kreaturen eröffnet der Film ein weites Feld an weiterführenden Diskursen, die nicht allein auf das Gruselkino beschränkt bleiben. Die Allegorie zu kommunistischen Erhebungen, zumal in jenen politisch unsicheren Tagen, drängt sich förmlich auf und wird von den Dialogen entschieden grundiert. Ein Plädoyer ist Island of Lost Souls dennoch nicht, im Gegenteil positioniert er sich zwar resignativ, doch auch nicht konservativ. Sein Ausblick ist düster, die schlechte Kopie des Films, die hier gezeigt wurde, unterstrich dies noch im Optischen.
imdb
Eine entlegene Insel im Pazifik als Ort schrecklicher Experimente: Ein hervorragend spielender Charles Laughton (Simon hat hier eine sehr schöne Beobachtung festgehalten, die es ziemlich genau auf den Punkt trifft) gibt den Dr. Moreau, der im „House of Pain“, einem Schreckenskabinett von OP, das den Mengele bereits erahnen lässt, mit plastisch-chirurgischen Eingriffen die Tiere sukzessive zum Menschen macht. Doch ist der Eingriff nicht allein biologischer Natur: Auf wundersame Weise erlangen diese Bastarde der Evolution auch Intelligenz und Artikulationsvermögen, wenn auch beides im eingeschränkten Maße. In den umliegenden Dschungeln hausen bereits die Ape Men in Siedlungen nach indigener Art, sie sind wild anzusehende, von der Kamera im vollen Bewusstsein des grellen Effekts inszenierte Kreaturen, die sich im steten Widerstreit zwischen animalischer Natur und zivilisatorischem Befriedungsprozess befinden. An ihrer Spitze: Ein zunächst nur an seinem bewusst eingesetzten Akzent erkennbarer (und in den Credits übergangener) Béla Lugosi, der seine Schicksalsgenossen wiederholt zu Kultur und Ethik aufruft, zum Ende hin aber, wenn die Wesen den Aufstand gegen ihren Herren wagen, als Rädelsführer auftritt.
Dieses Laborexperiment unter natürlichen Umständen mit den Mechanismen der Evolution wird durch den Aufritt eines Fremden jäh erschüttert. Parker ist ein Schiffbrüchiger, den es unter etwas verzwickten Umständen, für deren Schilderung die Exposition sich zunächst lange Zeit nimmt, auf die Insel verschlägt. Doch Moreau wittert seine große Chance: Sein ganzer Stolz ist Luta, eine bereits ansehnlich vollendete Pantherfrau, die er mit Parker konfrontiert, um zu sehen, ob ihre Menschwerdung bereits dahingelangt sei, dass sich auch leidenschaftliche und nicht zuletzt sexuelle Gelüste zur frisch beigetretenen Spezies einstellen. Und es gelingt: Zwar bleibt der adrette und leider Gottes eben auch verlobte Parker auf Distanz – die Kopulation und der erhoffte Nachwuchs stellen sich nicht ein –, doch ist das bemitleidenswerte Wesen dem jungen Mann vom ersten Anblick an hoffnungslos verfallen. Unterdessen trifft auch Parkers Verlobte samt Rettungsteam auf der Insel ein. Doch Moreaus Pläne erweisen sich als flexibel ...
Island of Lost Souls ist ein in mancher Hinsicht vielleicht krude, aber höchst effektiv inszenierter Film. Wie so oft im Horror- und Gruselkino ist auch hier der hermetisch geschlossene Eindruck nachrangig, es zählen vor allem jene Momentinseln, die den Zuschauer regelrecht anspringen. Momente der empfundenen Leere mögen dabei nur Wegbereiter für die Qualität des Bruchs mit der im klassischen Kino auf innere Geschlossenheit abzielenden Diegese darstellen. In seinem vielzitierten Aufsatz „Kino der Attraktionen“ hat der Filmwissenschaftler Tom Gunning diese Geschlossenheit als konstituierenden Aspekt des klassisch-narrativen Films hervorgehoben. In Island of Lost Souls wird diese in schöner Regelmäßigkeit und mit viel Gewinn durchbrochen: Seien es Dialoge zwischen Moreau und Parker, die in härtester Form des Schuss-/Gegenschussverfahrens – in zwei direkte Gegenüberstellungen mit dem direkten Blick in die Kamera – aufgelöst werden, oder aber das „Erstürmen der Kamera“ durch die Ape Men am Ende des Films: In schöner Regelmäßigkeit begeht der Film den Übergriffe auf den Zuschauer, der oft genug ob der direkten Ausrichtung der Bilder gegen ihn selbst sich in den Sessel drückt. Das Grobe der schrecklichen Fratzen wird dabei durch die konsequent schattierende Ausleuchtung hervorgehoben – mag Island oft grobschlächtig wirken (vor allem auch aufgrund zahlreicher unterschlagener Geräusche der Diegese; man war seinerzeit noch nah am Stummfilm), so erweist sich doch gerade in dieser formalen Gestaltung das vielleicht nicht intellektuell motivierte, aber intuitive Gespür für Effizienz.
Wie viele andere Horrorfilme jener Zeit ist auch Island natürlich nahe ans Melodram geschmiegt. Die These vom Gruselkino als Simulationsraum für das Eintreten des "Anderen" ins Gefüge, das aus rein ideologischen Gründen aus jenem wieder zu bannen sei, ist zumindest für das frühe klassische Horrorkino in dieser rigorosen Form nicht haltbar. Wie in Freaks, wie in Frankenstein, ein bisschen auch wie in King Kong gilt auch hier die solidarische Empathie vorrangig den Ausgestoßenen, geradewegs romantische Wehmut löst die Mensch gewordene Pantherfrau aus, die an ihren Zurückweisungen zugrunde geht und am Ende das Selbstopfer wagt, nicht nur um dem Geliebten die Flucht zu ermöglichen, sondern auch, um ihrer eigenen Tragödie zu entkommen. Gerade auch im überdeutlich inszenierten Kontrast der ausgestellten Kolonialherren-Zivilisiertheit des Dr. Moreau zu den anthropomorphisierten Kreaturen eröffnet der Film ein weites Feld an weiterführenden Diskursen, die nicht allein auf das Gruselkino beschränkt bleiben. Die Allegorie zu kommunistischen Erhebungen, zumal in jenen politisch unsicheren Tagen, drängt sich förmlich auf und wird von den Dialogen entschieden grundiert. Ein Plädoyer ist Island of Lost Souls dennoch nicht, im Gegenteil positioniert er sich zwar resignativ, doch auch nicht konservativ. Sein Ausblick ist düster, die schlechte Kopie des Films, die hier gezeigt wurde, unterstrich dies noch im Optischen.
imdb
° ° °
Thema: Filmtagebuch
23. Mai 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
20.05.2005, Heimkino
Für ein Jahr lang galt der Biologe Dr. Decker nach einem Flugzeugabsturz mitten im Herzen der Finsternis als perdu, als er plötzlich munter und heiter aus dem Busch kriecht und von gar mirakulösen Entdeckungen erzählt, die er gemacht haben und nun im Sinne der Wissenschaft erkunden will. Und wie es sich für einen mad scientist gehört, der seinen Faust und Frankenstein griffbereit hat, dreht er auch schon, kaum im heimischen Labor wieder angekommen, nach Strich und Faden durch. Konga selbst, ein mitgebrachtes Schimpansenäffchen, wird ihm zum Experimentierfeld für teuflische Vermischungen von pflanzlicher und animalischer Substanz. Das Resultat ist enorm und kann sich sehen lassen: Aus dem Schimpansen wird ein mannshoher Gorilla von erfreulicherweise soldatischem Gehorsam gegenüber seinem Herrn, den dieser sich sogleich zunutze macht: An der Fakultät wird das Genie vom Dekan zwar verlacht, doch hat eine wuchtige Affenpranke beizeiten noch jedes höhnische Professorenhaupt gespalten. Nicht anders geht’s der wissenschaftlichen Konkurrenz, die auf ähnlichen Pfaden forscht wie Decker selbst.

Für ein Jahr lang galt der Biologe Dr. Decker nach einem Flugzeugabsturz mitten im Herzen der Finsternis als perdu, als er plötzlich munter und heiter aus dem Busch kriecht und von gar mirakulösen Entdeckungen erzählt, die er gemacht haben und nun im Sinne der Wissenschaft erkunden will. Und wie es sich für einen mad scientist gehört, der seinen Faust und Frankenstein griffbereit hat, dreht er auch schon, kaum im heimischen Labor wieder angekommen, nach Strich und Faden durch. Konga selbst, ein mitgebrachtes Schimpansenäffchen, wird ihm zum Experimentierfeld für teuflische Vermischungen von pflanzlicher und animalischer Substanz. Das Resultat ist enorm und kann sich sehen lassen: Aus dem Schimpansen wird ein mannshoher Gorilla von erfreulicherweise soldatischem Gehorsam gegenüber seinem Herrn, den dieser sich sogleich zunutze macht: An der Fakultät wird das Genie vom Dekan zwar verlacht, doch hat eine wuchtige Affenpranke beizeiten noch jedes höhnische Professorenhaupt gespalten. Nicht anders geht’s der wissenschaftlichen Konkurrenz, die auf ähnlichen Pfaden forscht wie Decker selbst.

Zum Skandal kommt’s schließlich, als Decker im Gewächshaus einer Studentin lüsterne Avancen macht. Die bisherige Assistentin, die den Doktor schon vor längerem als gute Partie ausgemacht hat, zeigt sich brüskiert, gibt dem Affen Zucker und will ihn für eigene, üble Zwecke missbrauchen. Es tritt ein, was der Zuschauer längst hat kommen sehen: Von erneuter Injektion gestärkt, bricht Konga durch das Dach, wächst noch weiter in den Himmel und zeigt auch vorerst keine Anstalten, mit dem Wachstum einzuhalten. Panik bricht aus, die nahe Weltstadt London wird zum Schlachtfeld, Militär rückt an! Einmal mehr zeigt das leichtsinnige Menschenspiel mit der Natur ein grässliches (Plaste-)Gesicht...
Trotz gelegentlicher Längen ist Konga in erster Linie ein herrlich sympathischer Trash-Film mit allen wichtigen Zutaten: Abstruse Story, morsche Dialoge, aberwitzige Spezialeffekte im Rahmen eines Hartz-IV-tauglichen Budgets, ein Mann im Falten werfenden Plastik-Fellkostüm, der böse mit den Augen rollen kann, seltsame fleischfressende Pflanzen aus animierten Pappmaché und viel seltsam anmutender Exotismus. Besonders schön ist auch die mit den emotionalen Extremen spielende Performance von Michael Gough als Dr. Decker, den manch aufmerksames Auge vielleicht auch als den mimisch weit weniger facettenreichen Butler Alfred aus den Batman-Blockbustern der vergangenen Jahre wiedererkennt.
Weiteres Bildmaterial:



imdb ~ british horror films ~ monstrula (tipp!)
Trotz gelegentlicher Längen ist Konga in erster Linie ein herrlich sympathischer Trash-Film mit allen wichtigen Zutaten: Abstruse Story, morsche Dialoge, aberwitzige Spezialeffekte im Rahmen eines Hartz-IV-tauglichen Budgets, ein Mann im Falten werfenden Plastik-Fellkostüm, der böse mit den Augen rollen kann, seltsame fleischfressende Pflanzen aus animierten Pappmaché und viel seltsam anmutender Exotismus. Besonders schön ist auch die mit den emotionalen Extremen spielende Performance von Michael Gough als Dr. Decker, den manch aufmerksames Auge vielleicht auch als den mimisch weit weniger facettenreichen Butler Alfred aus den Batman-Blockbustern der vergangenen Jahre wiedererkennt.
Weiteres Bildmaterial:



imdb ~ british horror films ~ monstrula (tipp!)
° ° °
Thema: Filmtagebuch
15. Mai 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
15.05.2005, Heimkino
 Inhalt (Covertext der DVD):
Inhalt (Covertext der DVD):
John Person, Schauspieler mit Geldproblemen, hat keinen Schimmer, ob er verrückt geworden ist oder von Irren umgeben – oder ob hier einfach jemand ein fröhliches Verwirrspiel mit ihm treibt. Nur eines weiß John: Der Botendienst, den er für seinen wunderlichen Nachbarn übernommen hat, könnte ihn von allen Schulden befreien.
So wartet er nun mitten in der Wüste, in einem Motel im Schatten des längsten Thermometers der Welt. Er wartet darauf, dass der mysteriöse "Cowboy" einen ebenso mysteriösen Koffer abholt. Reisegepäck für einen Trip zu den Außerirdischen? Das würde jedenfalls zu ganzen Freaks passen, die John im Umkreis des Motels trifft...
The Big Empty ist im Stil der Kultfilm der Neunziger Jahre gehalten - Backwood-Cool- und Weirdness, irgendwo im Niemandsland der us-amerikanischen Wüste. Bars nahe der Grenze zu Mexiko, mysteriöse Figuren wie eben jener wortkarge Cowboy, Rednecks mit Hang zu Area-51-Stories, die entweder mehr wissen als sie vorgeben, oder einfach nur dim in the head sind. Doch The Big Empty verirrt sich keineswegs in die Zynismen der Oberfläche, sondern mischt seine Videotheken-Mixtur noch zusätzlich mit dem Lebenslauf-Blues, der wehmütigen Tristesse eines American Beauty an, dessen Soundtrack im hier Verwendung findenden deutlich zitiert wird. Und waren die Neunziger nicht zuletzt auch das Jahrzehnt der Mystery-Serien - von Twin Peaks angefangen, bis hin zu Akte X?

Man könnte deshalb sagen: Abgehangen, um Jahre zu spät. Gewissermaßen das Crime is King-Syndrom, hier kurzerhand benannt nach jenem penetrant nervigen Film von vor wenigen Jahren, der die 90er mit Kevin Costner und Kurt Russell als Elvis-Inkarnationen nur technisch verstärken und in dieses Jahrzehnt hinüber retten wollte (gescheitert auf ganzer Linie). Doch irgendwie schafft es The Big Empty vielleicht nicht gerade zu begeistern, aber eben doch als ungemein sympathischer Film für das Frühstück an einem verregneten Sonntagmorgen positiv verbucht zu werden.
Dies mag schon alleine daran liegen, dass er sich gar nicht erst an optischen Überbietungsspielchen versucht, sondern völlig relaxed im Offbeat-Tempo daherkommt. Seine Skurrilitäten sind nicht mit Blick auf die Bilanz auf schrullig hinkalkuliert, sondern spulen sich entspannt und mit Liebe modelliert ab. Der latente TV-Look der Produktion unterstützt die selbstgewählte, keineswegs uneffiziente Behäbigkeit zudem. Die Figuren sind nicht bloße Abziehbildchen, die durch die beständigen Loops einer längst schon solipsistisch werkelnden Zitierungsmaschine, wie sie das derzeitige Geek-Kino mittlerweile darstellt, durchscheinend geworden sind (auch sind sie keine Figuren aus Fleisch und Blut, gewiss), sondern ganz bewusst und mit etwas Hintersich so hingetupft wie sie sind. Man verfolgt das als Zuschauer entspannt und verfällt in ein heimeliges Vertrauen: Einfach nur hinschauen und sich überraschen lassen von dem, was als nächstes kommen mag (ohne dass die Überraschungen im Sinne von Überwältigung sich abspulen würden), ohne dass man viel mitdenken oder gar mitraten müsste. Hier geht es nicht um den ewig öden "Smarter than you"-Wettstreit zwischen Drehbuchautor und Zuschauer.
Maßgeblich zum Gelingen trägt sicherlich auch die Besetzung bei. Für eine Low-Budget-Produktion findet sich hier manch bekanntes Gesicht wieder, das den formalästhetisch nicht sonderlich anspruchsvollen Film mithin zu tragen weiß: Neben dem Hauptdarsteller - Jon Favreau, den man ansonsten nur als ewigen Nebendarsteller und face without a name kennt - sind vor allem auch die Nebenrollen geschickt besetzt: Sean Bean (Boromir im Lord of the Rings, Odysseus in Troy) gibt den lakonischen Cowboy mit angeratenem mimischen Understatement. Daryl Hannah brilliert als Barbesitzerin unter Perücke und Bud Cort - Harold aus Harold & Maude - als paranoider Nachbar ist ein stets gern gesehenes Gesicht am Rande. Auch die übrigen Figuren sind mit Herz dabei.
Wie gesagt, The Big Empty ist weit davon entfernt, großartig zu sein. Aber er ist charmant und solide, mit einigen schönen Momenten zwischen auch dem einen oder anderen Leerlauf. Und so ein bisschen ist das Ganze auch ein wehmütiger Blick zurück in das coole Indie-Kino der 90er. Man merkt, dass hier jemand mit Reife zu Werke gegangen ist, vielleicht ein Geek, der erwachsen geworden ist und dies seinem Film auch anmerken lässt. Besser als das kindisch-regressive Einerlei, aus dessen Repertoire sich das Fantasy Filmfest (wo The Big Empty im letzten Jahr zu sehen war) mittlerweile zu einem nicht unerheblichen Teil speist, ist das allemal. Steve Anderson, der hier sein Debüt als Regisseur vorlegte, wird vorerst im Auge behalten.

imdb ~ trailer ~ offizielle website ~ Zuschauer-Reviews vom Fantasy Filmfest ~ Infosite des deutschen Anbieters
 Inhalt (Covertext der DVD):
Inhalt (Covertext der DVD):John Person, Schauspieler mit Geldproblemen, hat keinen Schimmer, ob er verrückt geworden ist oder von Irren umgeben – oder ob hier einfach jemand ein fröhliches Verwirrspiel mit ihm treibt. Nur eines weiß John: Der Botendienst, den er für seinen wunderlichen Nachbarn übernommen hat, könnte ihn von allen Schulden befreien.
So wartet er nun mitten in der Wüste, in einem Motel im Schatten des längsten Thermometers der Welt. Er wartet darauf, dass der mysteriöse "Cowboy" einen ebenso mysteriösen Koffer abholt. Reisegepäck für einen Trip zu den Außerirdischen? Das würde jedenfalls zu ganzen Freaks passen, die John im Umkreis des Motels trifft...
The Big Empty ist im Stil der Kultfilm der Neunziger Jahre gehalten - Backwood-Cool- und Weirdness, irgendwo im Niemandsland der us-amerikanischen Wüste. Bars nahe der Grenze zu Mexiko, mysteriöse Figuren wie eben jener wortkarge Cowboy, Rednecks mit Hang zu Area-51-Stories, die entweder mehr wissen als sie vorgeben, oder einfach nur dim in the head sind. Doch The Big Empty verirrt sich keineswegs in die Zynismen der Oberfläche, sondern mischt seine Videotheken-Mixtur noch zusätzlich mit dem Lebenslauf-Blues, der wehmütigen Tristesse eines American Beauty an, dessen Soundtrack im hier Verwendung findenden deutlich zitiert wird. Und waren die Neunziger nicht zuletzt auch das Jahrzehnt der Mystery-Serien - von Twin Peaks angefangen, bis hin zu Akte X?

Man könnte deshalb sagen: Abgehangen, um Jahre zu spät. Gewissermaßen das Crime is King-Syndrom, hier kurzerhand benannt nach jenem penetrant nervigen Film von vor wenigen Jahren, der die 90er mit Kevin Costner und Kurt Russell als Elvis-Inkarnationen nur technisch verstärken und in dieses Jahrzehnt hinüber retten wollte (gescheitert auf ganzer Linie). Doch irgendwie schafft es The Big Empty vielleicht nicht gerade zu begeistern, aber eben doch als ungemein sympathischer Film für das Frühstück an einem verregneten Sonntagmorgen positiv verbucht zu werden.
Dies mag schon alleine daran liegen, dass er sich gar nicht erst an optischen Überbietungsspielchen versucht, sondern völlig relaxed im Offbeat-Tempo daherkommt. Seine Skurrilitäten sind nicht mit Blick auf die Bilanz auf schrullig hinkalkuliert, sondern spulen sich entspannt und mit Liebe modelliert ab. Der latente TV-Look der Produktion unterstützt die selbstgewählte, keineswegs uneffiziente Behäbigkeit zudem. Die Figuren sind nicht bloße Abziehbildchen, die durch die beständigen Loops einer längst schon solipsistisch werkelnden Zitierungsmaschine, wie sie das derzeitige Geek-Kino mittlerweile darstellt, durchscheinend geworden sind (auch sind sie keine Figuren aus Fleisch und Blut, gewiss), sondern ganz bewusst und mit etwas Hintersich so hingetupft wie sie sind. Man verfolgt das als Zuschauer entspannt und verfällt in ein heimeliges Vertrauen: Einfach nur hinschauen und sich überraschen lassen von dem, was als nächstes kommen mag (ohne dass die Überraschungen im Sinne von Überwältigung sich abspulen würden), ohne dass man viel mitdenken oder gar mitraten müsste. Hier geht es nicht um den ewig öden "Smarter than you"-Wettstreit zwischen Drehbuchautor und Zuschauer.
Maßgeblich zum Gelingen trägt sicherlich auch die Besetzung bei. Für eine Low-Budget-Produktion findet sich hier manch bekanntes Gesicht wieder, das den formalästhetisch nicht sonderlich anspruchsvollen Film mithin zu tragen weiß: Neben dem Hauptdarsteller - Jon Favreau, den man ansonsten nur als ewigen Nebendarsteller und face without a name kennt - sind vor allem auch die Nebenrollen geschickt besetzt: Sean Bean (Boromir im Lord of the Rings, Odysseus in Troy) gibt den lakonischen Cowboy mit angeratenem mimischen Understatement. Daryl Hannah brilliert als Barbesitzerin unter Perücke und Bud Cort - Harold aus Harold & Maude - als paranoider Nachbar ist ein stets gern gesehenes Gesicht am Rande. Auch die übrigen Figuren sind mit Herz dabei.
Wie gesagt, The Big Empty ist weit davon entfernt, großartig zu sein. Aber er ist charmant und solide, mit einigen schönen Momenten zwischen auch dem einen oder anderen Leerlauf. Und so ein bisschen ist das Ganze auch ein wehmütiger Blick zurück in das coole Indie-Kino der 90er. Man merkt, dass hier jemand mit Reife zu Werke gegangen ist, vielleicht ein Geek, der erwachsen geworden ist und dies seinem Film auch anmerken lässt. Besser als das kindisch-regressive Einerlei, aus dessen Repertoire sich das Fantasy Filmfest (wo The Big Empty im letzten Jahr zu sehen war) mittlerweile zu einem nicht unerheblichen Teil speist, ist das allemal. Steve Anderson, der hier sein Debüt als Regisseur vorlegte, wird vorerst im Auge behalten.

imdb ~ trailer ~ offizielle website ~ Zuschauer-Reviews vom Fantasy Filmfest ~ Infosite des deutschen Anbieters
° ° °
Thema: Filmtagebuch
13. Mai 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Danke, George.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
28. April 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
25.04.2005, Kino Intimes; Inhalt.
 Eastwood ist ein Regisseur der Schwärze. Mit ungemeiner Sanftheit schält er immer wieder aus der schwarzen Fläche Konturen, Gesichter, Personen heraus, um sie darin wieder verschwinden zu lassen. Ein Gespür, das sich in Unforgiven ankündigte, in Mystic River wiederkehrte und nun Vollendung gefunden hat. Überhaupt ist das Licht in Million Dollar Baby von entscheidender Bedeutung für die an sich recht strikt den Formalien der Genres des Boxerfilms und (später) des Dramas folgende Geschichte. Die biografische Tiefe, die die Figuren zwar bewusst nicht aufweisen, aber dennoch immer im Raum steht, findet im Wiederstreit zwischen Überbeleuchtung und vollkommener De-Illumination einen Ausgleich. Alle haben sie schwer an Vergangenheit zu tragen, doch keine Biografie erhält sonderliche Repräsentation im dramatischen Gefüge; von einzelnen Spitzen - kurzen Ausbrüchen, und auch die nur in Form von knappen Dialogen - abgesehen, könnte man glatt sagen, dass die Vergangenheit zwar über allem liegt, aber an sich vollkommen ausgeblendet bleibt. Die Vergangenheit benötigt keinen direkten Ausdruck, sie ist in der Schwärze, aus denen die Figuren immer wieder herausragen, in die sie immer wieder zurückgedrängt werden, ästhetisch voll nachempfindbar geworden. Auch die Gesichter - Eastwood hier, wie mir scheint, erstmals nicht als alter Mann, der es nochmal allen beweist, sondern eben wirklich im Alter angekommen, mit allen Furchen, Falten, Verhärmungen, die das mit sich bringt - sprechen viel, ohne dass es deutlicherer Artikulation bedarf. Die Vergangenheit von Eastwoods Figur selbst bleibt sogar völlig ungeklärt, aber dass er schwer daran zu tragen hat, wird überdeutlich.
Eastwood ist ein Regisseur der Schwärze. Mit ungemeiner Sanftheit schält er immer wieder aus der schwarzen Fläche Konturen, Gesichter, Personen heraus, um sie darin wieder verschwinden zu lassen. Ein Gespür, das sich in Unforgiven ankündigte, in Mystic River wiederkehrte und nun Vollendung gefunden hat. Überhaupt ist das Licht in Million Dollar Baby von entscheidender Bedeutung für die an sich recht strikt den Formalien der Genres des Boxerfilms und (später) des Dramas folgende Geschichte. Die biografische Tiefe, die die Figuren zwar bewusst nicht aufweisen, aber dennoch immer im Raum steht, findet im Wiederstreit zwischen Überbeleuchtung und vollkommener De-Illumination einen Ausgleich. Alle haben sie schwer an Vergangenheit zu tragen, doch keine Biografie erhält sonderliche Repräsentation im dramatischen Gefüge; von einzelnen Spitzen - kurzen Ausbrüchen, und auch die nur in Form von knappen Dialogen - abgesehen, könnte man glatt sagen, dass die Vergangenheit zwar über allem liegt, aber an sich vollkommen ausgeblendet bleibt. Die Vergangenheit benötigt keinen direkten Ausdruck, sie ist in der Schwärze, aus denen die Figuren immer wieder herausragen, in die sie immer wieder zurückgedrängt werden, ästhetisch voll nachempfindbar geworden. Auch die Gesichter - Eastwood hier, wie mir scheint, erstmals nicht als alter Mann, der es nochmal allen beweist, sondern eben wirklich im Alter angekommen, mit allen Furchen, Falten, Verhärmungen, die das mit sich bringt - sprechen viel, ohne dass es deutlicherer Artikulation bedarf. Die Vergangenheit von Eastwoods Figur selbst bleibt sogar völlig ungeklärt, aber dass er schwer daran zu tragen hat, wird überdeutlich.

Der Boxerfilm erzählt nun davon, dass man nur an sich glauben muss, um alles hinter sich zu lassen, um zu erreichen was man will, um über das Dispositiv der eigenen, nachteiligen Herkunft und Biografie hinauszuwachsen. Anfangs bestätigt Million Dollar Baby dies auch scheinbar, doch liegt hier schon Trug unter der Erfolgsgeschichte: Die Siege gehen zu glatt, dutzende K.O.s in der ersten Minute der ersten Runde - eine komplette Ausblendung üblicher Boxdramatik. Gebremst wird diese Aufstiegsstory schließlich durch eine Lappalie, durch eine Laune des Schicksals, durch etwas, was durch Begriffe wie Schuld und Kausalität nicht hinreichend beschrieben wäre. Um Schuld wird es deshalb im weiteren Verlauf auch niemals gehen - eine Stärke und nicht zuletzt Kommentar zur Selbstverwirklichungsideologie, die einem an allen Ecken und Enden um die Ohren gehauen wird.
Million Dollar Baby ist dabei nicht das, was nach dem Oscarregen zu erwarten gewesen wäre. Genialisches, Übertrumpfendes, Tränenrühriges, Mitreißendes, Visionäres, was immer man auch von einem Oscar-Liebling erwarten würde, findet hier nicht statt (und eben deshalb verwundert der Academytriumph auch etwas). Den Film zeichnet vielmehr das aus, was ich an Eastwood generell schätze: Er ist ein Klassiker des Kinos und übt sich weniger darin, neue Wege zu beschreiten, neue Ausdrucksformen zu erschließen; vielmehr setzt er das Erschlossene feinkalibriert um. Bei Eastwood im Kino sitzen heißt Kino-wie-es-ist zu beobachten und keine künstlerische wie kommerzielle Übertrumpfungsshow (wie manch andere Filme anmuten). Es ist die leichte Unzeitgemäßheit, ein vielleicht nicht altersweises, zumindest aber -kluges Sich-Verlassen auf Routiniertheit und Bewährtheit, die aber eben doch nichts mit dem Handwerk des Routiniers zu tun haben, vor dem man gemeinhin scheut, was ich an Eastwood im Allgemeinen, an diesem Film im Besonderen schätze. Dabei kommt nie das Großartige schlechthin heraus (und schon gar nicht das Meisterhafte, das Million Dollar Baby gerne nachgesagt wird), sondern eher eine gewisse Verlässlichkeit, eine Üblichkeit, die jedoch nicht in Langeweile umschlägt.

Gut gefallen hat mir auch der Balanceakt des Films, der einem zwar oft genug Härten vorführt, in denen man einschreiten möchte oder in denen man Tränen vergießen könnte, dabei aber nie ins Rührselige oder plump Empörte umschlägt. Die vielleicht dann doch große Kunst des Films besteht darin, die Augen zwar feucht werden, die entscheidende Träne aber nie vergießen zu lassen. Dass er bisweilen in der Tat auch zur Überdeutlichkeit neigt, sei dabei nicht verschwiegen - andererseits, so scheint mir, gehorcht Eastwood hier auch streng den Vorgaben des Dramas mit seinen ineinandergreifenden Zahnrädern, wo jedes Detail schließlich im Gesamtgefüge seinen Platz einnimmt.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
 Eastwood ist ein Regisseur der Schwärze. Mit ungemeiner Sanftheit schält er immer wieder aus der schwarzen Fläche Konturen, Gesichter, Personen heraus, um sie darin wieder verschwinden zu lassen. Ein Gespür, das sich in Unforgiven ankündigte, in Mystic River wiederkehrte und nun Vollendung gefunden hat. Überhaupt ist das Licht in Million Dollar Baby von entscheidender Bedeutung für die an sich recht strikt den Formalien der Genres des Boxerfilms und (später) des Dramas folgende Geschichte. Die biografische Tiefe, die die Figuren zwar bewusst nicht aufweisen, aber dennoch immer im Raum steht, findet im Wiederstreit zwischen Überbeleuchtung und vollkommener De-Illumination einen Ausgleich. Alle haben sie schwer an Vergangenheit zu tragen, doch keine Biografie erhält sonderliche Repräsentation im dramatischen Gefüge; von einzelnen Spitzen - kurzen Ausbrüchen, und auch die nur in Form von knappen Dialogen - abgesehen, könnte man glatt sagen, dass die Vergangenheit zwar über allem liegt, aber an sich vollkommen ausgeblendet bleibt. Die Vergangenheit benötigt keinen direkten Ausdruck, sie ist in der Schwärze, aus denen die Figuren immer wieder herausragen, in die sie immer wieder zurückgedrängt werden, ästhetisch voll nachempfindbar geworden. Auch die Gesichter - Eastwood hier, wie mir scheint, erstmals nicht als alter Mann, der es nochmal allen beweist, sondern eben wirklich im Alter angekommen, mit allen Furchen, Falten, Verhärmungen, die das mit sich bringt - sprechen viel, ohne dass es deutlicherer Artikulation bedarf. Die Vergangenheit von Eastwoods Figur selbst bleibt sogar völlig ungeklärt, aber dass er schwer daran zu tragen hat, wird überdeutlich.
Eastwood ist ein Regisseur der Schwärze. Mit ungemeiner Sanftheit schält er immer wieder aus der schwarzen Fläche Konturen, Gesichter, Personen heraus, um sie darin wieder verschwinden zu lassen. Ein Gespür, das sich in Unforgiven ankündigte, in Mystic River wiederkehrte und nun Vollendung gefunden hat. Überhaupt ist das Licht in Million Dollar Baby von entscheidender Bedeutung für die an sich recht strikt den Formalien der Genres des Boxerfilms und (später) des Dramas folgende Geschichte. Die biografische Tiefe, die die Figuren zwar bewusst nicht aufweisen, aber dennoch immer im Raum steht, findet im Wiederstreit zwischen Überbeleuchtung und vollkommener De-Illumination einen Ausgleich. Alle haben sie schwer an Vergangenheit zu tragen, doch keine Biografie erhält sonderliche Repräsentation im dramatischen Gefüge; von einzelnen Spitzen - kurzen Ausbrüchen, und auch die nur in Form von knappen Dialogen - abgesehen, könnte man glatt sagen, dass die Vergangenheit zwar über allem liegt, aber an sich vollkommen ausgeblendet bleibt. Die Vergangenheit benötigt keinen direkten Ausdruck, sie ist in der Schwärze, aus denen die Figuren immer wieder herausragen, in die sie immer wieder zurückgedrängt werden, ästhetisch voll nachempfindbar geworden. Auch die Gesichter - Eastwood hier, wie mir scheint, erstmals nicht als alter Mann, der es nochmal allen beweist, sondern eben wirklich im Alter angekommen, mit allen Furchen, Falten, Verhärmungen, die das mit sich bringt - sprechen viel, ohne dass es deutlicherer Artikulation bedarf. Die Vergangenheit von Eastwoods Figur selbst bleibt sogar völlig ungeklärt, aber dass er schwer daran zu tragen hat, wird überdeutlich.
Der Boxerfilm erzählt nun davon, dass man nur an sich glauben muss, um alles hinter sich zu lassen, um zu erreichen was man will, um über das Dispositiv der eigenen, nachteiligen Herkunft und Biografie hinauszuwachsen. Anfangs bestätigt Million Dollar Baby dies auch scheinbar, doch liegt hier schon Trug unter der Erfolgsgeschichte: Die Siege gehen zu glatt, dutzende K.O.s in der ersten Minute der ersten Runde - eine komplette Ausblendung üblicher Boxdramatik. Gebremst wird diese Aufstiegsstory schließlich durch eine Lappalie, durch eine Laune des Schicksals, durch etwas, was durch Begriffe wie Schuld und Kausalität nicht hinreichend beschrieben wäre. Um Schuld wird es deshalb im weiteren Verlauf auch niemals gehen - eine Stärke und nicht zuletzt Kommentar zur Selbstverwirklichungsideologie, die einem an allen Ecken und Enden um die Ohren gehauen wird.
Million Dollar Baby ist dabei nicht das, was nach dem Oscarregen zu erwarten gewesen wäre. Genialisches, Übertrumpfendes, Tränenrühriges, Mitreißendes, Visionäres, was immer man auch von einem Oscar-Liebling erwarten würde, findet hier nicht statt (und eben deshalb verwundert der Academytriumph auch etwas). Den Film zeichnet vielmehr das aus, was ich an Eastwood generell schätze: Er ist ein Klassiker des Kinos und übt sich weniger darin, neue Wege zu beschreiten, neue Ausdrucksformen zu erschließen; vielmehr setzt er das Erschlossene feinkalibriert um. Bei Eastwood im Kino sitzen heißt Kino-wie-es-ist zu beobachten und keine künstlerische wie kommerzielle Übertrumpfungsshow (wie manch andere Filme anmuten). Es ist die leichte Unzeitgemäßheit, ein vielleicht nicht altersweises, zumindest aber -kluges Sich-Verlassen auf Routiniertheit und Bewährtheit, die aber eben doch nichts mit dem Handwerk des Routiniers zu tun haben, vor dem man gemeinhin scheut, was ich an Eastwood im Allgemeinen, an diesem Film im Besonderen schätze. Dabei kommt nie das Großartige schlechthin heraus (und schon gar nicht das Meisterhafte, das Million Dollar Baby gerne nachgesagt wird), sondern eher eine gewisse Verlässlichkeit, eine Üblichkeit, die jedoch nicht in Langeweile umschlägt.

Gut gefallen hat mir auch der Balanceakt des Films, der einem zwar oft genug Härten vorführt, in denen man einschreiten möchte oder in denen man Tränen vergießen könnte, dabei aber nie ins Rührselige oder plump Empörte umschlägt. Die vielleicht dann doch große Kunst des Films besteht darin, die Augen zwar feucht werden, die entscheidende Träne aber nie vergießen zu lassen. Dass er bisweilen in der Tat auch zur Überdeutlichkeit neigt, sei dabei nicht verschwiegen - andererseits, so scheint mir, gehorcht Eastwood hier auch streng den Vorgaben des Dramas mit seinen ineinandergreifenden Zahnrädern, wo jedes Detail schließlich im Gesamtgefüge seinen Platz einnimmt.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
23.04.2005, Heimkino
Zunächst ein schönes Beispiel, warum die 80er größtenteils ein ästhetisches Verbrechen darstellen. Der Film ertrinkt förmlich in seiner Zeitverhaftung und während noch fast jede Dekade seinen Filmen ein Gepräge mit auf den Weg gibt, das diesen, im Sinne des Charmes, zum Vorteil gereicht, ist bei den 80ern dahingehend kaum etwas zu holen. Nein, die Musik, die hier in großzügigen Dosen über alles und jedes gegossen wird, wird auch in Zukunft nicht gut klingen, vielmehr will man schreiend wegrennen. Die Klamotten, die alle anhaben, sind grundsätzlich Scheiße. Das gekünstelt Oberflächliche in jeder Einstellung ist nur mehr schale Hülle. Auch das Filmmaterial ist von selten ödem materialästhetischen Reiz, das post-homevideo-bedingte Bildformat macht vor allem die an sich sensationall inszenierte Autoverfolgungsjagd zum Trauerspiel, das vom abhanden gekommenen Scope kündet, und die typografische Gestaltung des Vorspanns verursacht bloßen physischen Schmerz.
Dem kann der Film zunächst kaum entkommen, zumal auch gerade die erste halbe Stunde seltsam unbalanciert vor sich hinstolpert und sich kaum für etwas handfestes entscheiden kann. Und immer wieder meint man einem verkrampften Versuch beizuwohnen, an den großartigen French Connection - der nun ebenfalls ganz und gar im Sud seiner Zeit kocht, aber nun, ganz im Gegensatz zu diesem Friedkinfilm, dadurch punkten kann - anzuschließen, diesen künstlerisch überrragenden Erfolg gar zu wiederholen.
Gut wird's dann später, als der Fokus endlich gefunden ist, die Ungelenkigkeiten in der grundsätzlichen Orientierung abnehmen und auch die "Greatest" Hits of the 80's-CD im hohen Bogen aus dem Tonstudio geschmissen wurde. Wenn diese beiden Polizisten, um die sich mal wieder alles dreht, endlich aus dem offiziellen Behördengang ausscheren - der eine, weil er ein Egomane sondergleichen ist, der andere, weil er an sich gegen seinen Willen mitgerissen wird - entwickelt To Live and Die in L.A. eine ungemeine Kraft, in der übliche hard boiled Zynismen der Copthriller aus den 70er Jahren mit leichter Hand noch übertroffen werden und ein selten düsteres Bild von Machtökonomien und ihren Verlockungen gezeichnet wird. Es ist nichts anderes als großartig, wenn diese beiden Cops selbst einen Diamantendeal unter Hehlern überfallen, um an jenen Geldbetrag zu kommen, der ihnen von offizieller Seite verweigert wird, um damit einen Geldfälscher - im übrigen großartig mit dem jungen Willem Dafoe besetzt - in die Falle zu locken. Ab hier zieht das eigene Verbrechen dann die weiten Kreise, die von einem solchen Schattenfilm zu wünschen sind, und natürlich stehen am Ende: Blut allenthalben und die verlorene Unschuld des vormaligen Idealisten. Das eigentliche Opfer indes: natürlich eine Frau, eine Person am Rande des Schauspiels nur, die von männlicher Egomanie aufs Neuerliche versklavt wird.
Ein ambivalentes Erlebnis. Bis an die Schmerzgrenze unsicher zu Beginn, dann atemberaubend, zum Ende hin schlicht genial - wann hätte ein Schuss in den Kopf den Zuschauer stärker vor den eigenen gestoßen? -, mit einem wiederum seltsam delierenden Beschluss, der einen nochmals am Verstand der Macher zweifeln lässt. Sei's drum: To Live and Die in L.A. ist eine Kost, an der man manchen Zahn verliert, aber schlußendlich gelohnt hat sich's dann doch.
imdb
Zunächst ein schönes Beispiel, warum die 80er größtenteils ein ästhetisches Verbrechen darstellen. Der Film ertrinkt förmlich in seiner Zeitverhaftung und während noch fast jede Dekade seinen Filmen ein Gepräge mit auf den Weg gibt, das diesen, im Sinne des Charmes, zum Vorteil gereicht, ist bei den 80ern dahingehend kaum etwas zu holen. Nein, die Musik, die hier in großzügigen Dosen über alles und jedes gegossen wird, wird auch in Zukunft nicht gut klingen, vielmehr will man schreiend wegrennen. Die Klamotten, die alle anhaben, sind grundsätzlich Scheiße. Das gekünstelt Oberflächliche in jeder Einstellung ist nur mehr schale Hülle. Auch das Filmmaterial ist von selten ödem materialästhetischen Reiz, das post-homevideo-bedingte Bildformat macht vor allem die an sich sensationall inszenierte Autoverfolgungsjagd zum Trauerspiel, das vom abhanden gekommenen Scope kündet, und die typografische Gestaltung des Vorspanns verursacht bloßen physischen Schmerz.
Dem kann der Film zunächst kaum entkommen, zumal auch gerade die erste halbe Stunde seltsam unbalanciert vor sich hinstolpert und sich kaum für etwas handfestes entscheiden kann. Und immer wieder meint man einem verkrampften Versuch beizuwohnen, an den großartigen French Connection - der nun ebenfalls ganz und gar im Sud seiner Zeit kocht, aber nun, ganz im Gegensatz zu diesem Friedkinfilm, dadurch punkten kann - anzuschließen, diesen künstlerisch überrragenden Erfolg gar zu wiederholen.
Gut wird's dann später, als der Fokus endlich gefunden ist, die Ungelenkigkeiten in der grundsätzlichen Orientierung abnehmen und auch die "Greatest" Hits of the 80's-CD im hohen Bogen aus dem Tonstudio geschmissen wurde. Wenn diese beiden Polizisten, um die sich mal wieder alles dreht, endlich aus dem offiziellen Behördengang ausscheren - der eine, weil er ein Egomane sondergleichen ist, der andere, weil er an sich gegen seinen Willen mitgerissen wird - entwickelt To Live and Die in L.A. eine ungemeine Kraft, in der übliche hard boiled Zynismen der Copthriller aus den 70er Jahren mit leichter Hand noch übertroffen werden und ein selten düsteres Bild von Machtökonomien und ihren Verlockungen gezeichnet wird. Es ist nichts anderes als großartig, wenn diese beiden Cops selbst einen Diamantendeal unter Hehlern überfallen, um an jenen Geldbetrag zu kommen, der ihnen von offizieller Seite verweigert wird, um damit einen Geldfälscher - im übrigen großartig mit dem jungen Willem Dafoe besetzt - in die Falle zu locken. Ab hier zieht das eigene Verbrechen dann die weiten Kreise, die von einem solchen Schattenfilm zu wünschen sind, und natürlich stehen am Ende: Blut allenthalben und die verlorene Unschuld des vormaligen Idealisten. Das eigentliche Opfer indes: natürlich eine Frau, eine Person am Rande des Schauspiels nur, die von männlicher Egomanie aufs Neuerliche versklavt wird.
Ein ambivalentes Erlebnis. Bis an die Schmerzgrenze unsicher zu Beginn, dann atemberaubend, zum Ende hin schlicht genial - wann hätte ein Schuss in den Kopf den Zuschauer stärker vor den eigenen gestoßen? -, mit einem wiederum seltsam delierenden Beschluss, der einen nochmals am Verstand der Macher zweifeln lässt. Sei's drum: To Live and Die in L.A. ist eine Kost, an der man manchen Zahn verliert, aber schlußendlich gelohnt hat sich's dann doch.
imdb
° ° °
Thema: Filmtagebuch
17. April 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Aktuelle Retrospektive im Kino Arsenal, hier der Programmtext.
Salome (Italien 1972)
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich. Was aber, wenn das Kamel den Reichtum gefressen hat? Christenheit, die vor dem Innern des Körpers, ihn verstanden auch als Träger, Behältnis, scheitert.
Seit Eisenstein hat vielleicht kein Filmemacher mehr den Zuschauer derart anhand des Formalen gegängelt. Der Film besteht aus 4500 Schnitten, heißt es. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Der Film dauert gerade mal 80 Minuten. Man wird beschossen von ihm, weil sein Raum - ein abstrakter, eher ein Theaterraum (aber kein Theaterfilm, weiß Gott nicht) - verborgen bleibt, in Naheinstellungen (die ist ihm die liebste) und einem Schnittstakkato, das in Bewegungen schneidet. Nicht zuletzt ein Farbenrausch, alles reinste Künstlichkeit und aber: Körperlichkeit. Salome ist eine körperliche Erfahrung und am Ende schließlich das vielleicht stärkste Bild: Der delirierende Herodes, von Bene selbst verkörpert, im gleißenden Licht, die Kamera dicht, ja am dichtesten bei ihm, zählt auf: Reichtümer, Ländereien, um ihn (ja, um ihn herum): Salome, mit hypnotischer Stimme: "La Testa! wiederholend, immer wieder: Sie will das Haupt des Propheten. Ihre dünnen Finger, spinnenartig, um ihn herum, Herodes blickt nach oben, sie zieht ihm eine Haut ab, nicht die Haut, sondern etwas darüber. Immer wieder La Testa und Schnitt um Schnitt um Schnitt.
Andere Bilder zuvor, zahlreiche. Ein Jesus kreuzigt sich selbst. Die Komik, dass er seine freie Hand nicht festnageln kann. Nichts wird vollendet, in diesem Film. Immer nur ist man mitten drin. In etwas, was Anfang und Ende nicht kennt. Der Tanz der Salome hingegen findet nicht statt, bleibt zwischen den Sequenzen verborgen. Dieses "zwischen den Sequenzen" scheint mir bei Bene wichtig zu sein - wo ein klassisch erzählender Film seinen Raum und seine Zeit auf das wesentliche verdichtet, scheint Bene gerade das in der Verdichtung betonte außen vor zu lassen und sich mit den Zwischenräumen und -zeitpunkten zu beschäftigen.
Ein erster Verdacht: Benes Film sind "reines Kino" in dem Sinne, dass sie sich gegen Verwörtlichung spreizen. Vielleicht wird auch deshalb in entscheidenden Momenten wenig geredet und wenn viel geredet wird, dann meist endlose Wiederholungen und Sätze, die so recht neben allem zu stehen scheinen. Auch ist da oft eine Ton-Bild-Schere: Der, der spricht, bewegt den Mund nicht, oder bewegt ihn zu lange, zu kurz.
Nostra Signora del Turchi (Italien 1968)
Der später gedrehte, in der Retrospektive aber eingangs gezeigte Salome war üblichen Räumen entzogenes Pop-Art-Delirium. Nostra Signora hingegen findet in Orten statt, die man kennen könnte (zu Beginn: lange Vorstellung einer Kapelle, die es augenscheinlich "in echt" gibt, durch verschmierte Linsen aber nur zu sehen, Bene erläutert viel und die Kamera träumt sich durch die Lokalität, in unmöglichen Winkeln). Kontingent erzählt wird hier nichts: Nostra Signora ist eine Abfolge von Bildern, die sich immer zu einem Crescendo hinreißen lassen und in episodisch rauschhafte Höhepunkte münden. Auch hier wieder das Gefühl, beschossen zu werden. Man spürt dem Film kaum nach, er überholt die Sensoren mit leichter Hand, entweder man verabscheut das oder man gibt sich dem hin, gleitet durch die Reinheit einer ästhetischen Erfahrung, die einem Bilder liefert, die man nicht verstehen muss, um sie stark erleben zu können. Wenn man diesen Punkt erreicht, entfaltete sich eine Sogkraft, die Welten erschließt, in denen alles möglich scheint, ein Gefühl, das nicht enden möge, in dem die Sphäre des Diesseitigen, des Alltagspolitischen, nicht zuletzt die Sphäre von Arbeit und Ökonomie Momente lang besiegt scheint und das Gehirn selbst von Bildern in eine Richtun massiert scheint, wo Kunstproduktion das einzige von Sinn ist. Der Fall daraus kann tief sein: Wie nach dem Kokain folgt dem Rausch die Depression, wenn man erwacht und das alte Gefüge einen wieder gefangen nimmt. Dabei ist das kein narzistisch-egozentrischer Hippie-Spiritualismus - der größte Feind von Kunstsinn überhaupt -, sondern erdig, hier, nicht intellektuell vielleicht, aber zumindest von einer Intuition, die zum Richtigen führt.
Erste Motive zeigen sich: Der verzweifelt derlierende Mann, der von einer Frau durch körperliche Nähe körperlich desintegriert wird. Blickachsen des Kameraauges, die die Frau als Ikone stilisieren, als, etwa, die übermächtige, liebende prä-ödipale Mutter, deren Bedeutung Gilles Deleuze betont hat. Die Aufspaltung der Figur. In Vater und Sohn, Lehrer und Lehrender (in einem der packendsten Momente: Der kochende Mönch, mit Bart, und sein Schüler, ohne Bart, beide von Bene gespielt, meist im Gegenschussverfahren aufgelöst, dann aber oft sogar im statischen Bild: Der Theaterbart wird heruntergerissen, um die Rolle zu wechseln). Wieder dieser Solipsismus in den Worten. Pferde und Essen, das in den Mund geführt wird, dort aber nicht bleibt. Immer die Nähe zum Slapstick und auch weiterhin das Verweilen in der Mitte einer Handlung.
Hie und da wirkt Bene wie eine Karikatur von Belmondo im Pierrotfilm.
Capricci (Italien 1969)
Das rote Telefon klingelt, wir sind bei Künstlern, die Dinge bemalen und sie ihn Rahmen setzen, als körperliches Stillleben. Fast schon Warhol-haft ist hier überall Hammer und Sichel auch auf Leinwänden zu sehen, es kommt zum Streit, der nur dazu dient, diese ganze Kunst zu zerstören. Hinfort damit. Bene hasste Week-End von Godard, er hasste das ganze versonnene Erstarren vor den Verführungen sozialistischer Ästhetik. Mehr noch als Nostra Signora ist dies ein Schuss aus der Hüfte in Richtung Frankreich.
Ein Schrottplatz mit Autos drauf. Ineinander verkeilt, immer wieder Karambolagen. Bene mitten drin als taumelnder Künstler, der Frauen anfährt, sie grotesk zu retten versucht. Auch hier die Nähe zu Belmondo-Figuren. Schöne Frauen in schönen Kleidungen, wie man sie auch aus Godards Filmen kennt. Gegen das Sonnenlicht geschossen, ein Irrealis im Bild. Am Ende die großen Explosionen, gestellte Todesszenen - wir liegen noch nich richtig, die Musik gehorcht, verstummt - und lauter Jugendliche in Gangsterposen rennen plötzlich über den Platz und sie schießen weiß Gott allein auf wen und wohin, im Schlepptau haben sie junge Frauen, sie haben Filme von Godard gesehen (und Godard wiederum hat amerikanische Filme gesehen) und sie rennen sie nun rum, Kopien ohne Saft und Kraft, und steigen in verbrannte Autos, die hinfort fahren, lächerlich. Harter Schnitt auf bemannte Pferde, es ist nacht, Großaufnahmen, alles viel zu nah, es ist grotesk, es ist lächerlich, es ist großartig, Rot, immer wieder alles rot, Abspann über dem Bild.
Dazwischen so viel mehr. Eifersuchtsgeschichten. Rezitationen aus Roland Barthes Texten, aus dem Off, während aufgetischt wird. Mahlzeiten aus Elle. Fahren wie nach London. Groteske Selbstbildnisse. Hier werden die Lenins und Stalins von morgen geboren. Der Polizist scheitert vor dem grotesken Transvestiten, in dem der Vater zur Mutter wurde, seine Rache schon fast, der Polizist erlebt den Regress fast körperlich schon nach. Zum Vater wird ihm ein überdimensionales Selbstbildnis des Künstlers, er kann es nicht tragen, die Tränen, Zusammenbruch, wie unter dem Kreuze fast, Infantiltität.
Ich beginne, die Filme zu verwechseln. Sie scheinen ineinander zu fließen.
Und dann immer wieder das Rot. Das große Gesicht des Pferdes am Ende. Ein Film voller Gewalt und Größenwahn. Rausch.
Salome (Italien 1972)
Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich. Was aber, wenn das Kamel den Reichtum gefressen hat? Christenheit, die vor dem Innern des Körpers, ihn verstanden auch als Träger, Behältnis, scheitert.
Seit Eisenstein hat vielleicht kein Filmemacher mehr den Zuschauer derart anhand des Formalen gegängelt. Der Film besteht aus 4500 Schnitten, heißt es. Eine Stunde hat 3600 Sekunden. Der Film dauert gerade mal 80 Minuten. Man wird beschossen von ihm, weil sein Raum - ein abstrakter, eher ein Theaterraum (aber kein Theaterfilm, weiß Gott nicht) - verborgen bleibt, in Naheinstellungen (die ist ihm die liebste) und einem Schnittstakkato, das in Bewegungen schneidet. Nicht zuletzt ein Farbenrausch, alles reinste Künstlichkeit und aber: Körperlichkeit. Salome ist eine körperliche Erfahrung und am Ende schließlich das vielleicht stärkste Bild: Der delirierende Herodes, von Bene selbst verkörpert, im gleißenden Licht, die Kamera dicht, ja am dichtesten bei ihm, zählt auf: Reichtümer, Ländereien, um ihn (ja, um ihn herum): Salome, mit hypnotischer Stimme: "La Testa! wiederholend, immer wieder: Sie will das Haupt des Propheten. Ihre dünnen Finger, spinnenartig, um ihn herum, Herodes blickt nach oben, sie zieht ihm eine Haut ab, nicht die Haut, sondern etwas darüber. Immer wieder La Testa und Schnitt um Schnitt um Schnitt.
Andere Bilder zuvor, zahlreiche. Ein Jesus kreuzigt sich selbst. Die Komik, dass er seine freie Hand nicht festnageln kann. Nichts wird vollendet, in diesem Film. Immer nur ist man mitten drin. In etwas, was Anfang und Ende nicht kennt. Der Tanz der Salome hingegen findet nicht statt, bleibt zwischen den Sequenzen verborgen. Dieses "zwischen den Sequenzen" scheint mir bei Bene wichtig zu sein - wo ein klassisch erzählender Film seinen Raum und seine Zeit auf das wesentliche verdichtet, scheint Bene gerade das in der Verdichtung betonte außen vor zu lassen und sich mit den Zwischenräumen und -zeitpunkten zu beschäftigen.
Ein erster Verdacht: Benes Film sind "reines Kino" in dem Sinne, dass sie sich gegen Verwörtlichung spreizen. Vielleicht wird auch deshalb in entscheidenden Momenten wenig geredet und wenn viel geredet wird, dann meist endlose Wiederholungen und Sätze, die so recht neben allem zu stehen scheinen. Auch ist da oft eine Ton-Bild-Schere: Der, der spricht, bewegt den Mund nicht, oder bewegt ihn zu lange, zu kurz.
Nostra Signora del Turchi (Italien 1968)
Der später gedrehte, in der Retrospektive aber eingangs gezeigte Salome war üblichen Räumen entzogenes Pop-Art-Delirium. Nostra Signora hingegen findet in Orten statt, die man kennen könnte (zu Beginn: lange Vorstellung einer Kapelle, die es augenscheinlich "in echt" gibt, durch verschmierte Linsen aber nur zu sehen, Bene erläutert viel und die Kamera träumt sich durch die Lokalität, in unmöglichen Winkeln). Kontingent erzählt wird hier nichts: Nostra Signora ist eine Abfolge von Bildern, die sich immer zu einem Crescendo hinreißen lassen und in episodisch rauschhafte Höhepunkte münden. Auch hier wieder das Gefühl, beschossen zu werden. Man spürt dem Film kaum nach, er überholt die Sensoren mit leichter Hand, entweder man verabscheut das oder man gibt sich dem hin, gleitet durch die Reinheit einer ästhetischen Erfahrung, die einem Bilder liefert, die man nicht verstehen muss, um sie stark erleben zu können. Wenn man diesen Punkt erreicht, entfaltete sich eine Sogkraft, die Welten erschließt, in denen alles möglich scheint, ein Gefühl, das nicht enden möge, in dem die Sphäre des Diesseitigen, des Alltagspolitischen, nicht zuletzt die Sphäre von Arbeit und Ökonomie Momente lang besiegt scheint und das Gehirn selbst von Bildern in eine Richtun massiert scheint, wo Kunstproduktion das einzige von Sinn ist. Der Fall daraus kann tief sein: Wie nach dem Kokain folgt dem Rausch die Depression, wenn man erwacht und das alte Gefüge einen wieder gefangen nimmt. Dabei ist das kein narzistisch-egozentrischer Hippie-Spiritualismus - der größte Feind von Kunstsinn überhaupt -, sondern erdig, hier, nicht intellektuell vielleicht, aber zumindest von einer Intuition, die zum Richtigen führt.
Erste Motive zeigen sich: Der verzweifelt derlierende Mann, der von einer Frau durch körperliche Nähe körperlich desintegriert wird. Blickachsen des Kameraauges, die die Frau als Ikone stilisieren, als, etwa, die übermächtige, liebende prä-ödipale Mutter, deren Bedeutung Gilles Deleuze betont hat. Die Aufspaltung der Figur. In Vater und Sohn, Lehrer und Lehrender (in einem der packendsten Momente: Der kochende Mönch, mit Bart, und sein Schüler, ohne Bart, beide von Bene gespielt, meist im Gegenschussverfahren aufgelöst, dann aber oft sogar im statischen Bild: Der Theaterbart wird heruntergerissen, um die Rolle zu wechseln). Wieder dieser Solipsismus in den Worten. Pferde und Essen, das in den Mund geführt wird, dort aber nicht bleibt. Immer die Nähe zum Slapstick und auch weiterhin das Verweilen in der Mitte einer Handlung.
Hie und da wirkt Bene wie eine Karikatur von Belmondo im Pierrotfilm.
Capricci (Italien 1969)
Das rote Telefon klingelt, wir sind bei Künstlern, die Dinge bemalen und sie ihn Rahmen setzen, als körperliches Stillleben. Fast schon Warhol-haft ist hier überall Hammer und Sichel auch auf Leinwänden zu sehen, es kommt zum Streit, der nur dazu dient, diese ganze Kunst zu zerstören. Hinfort damit. Bene hasste Week-End von Godard, er hasste das ganze versonnene Erstarren vor den Verführungen sozialistischer Ästhetik. Mehr noch als Nostra Signora ist dies ein Schuss aus der Hüfte in Richtung Frankreich.
Ein Schrottplatz mit Autos drauf. Ineinander verkeilt, immer wieder Karambolagen. Bene mitten drin als taumelnder Künstler, der Frauen anfährt, sie grotesk zu retten versucht. Auch hier die Nähe zu Belmondo-Figuren. Schöne Frauen in schönen Kleidungen, wie man sie auch aus Godards Filmen kennt. Gegen das Sonnenlicht geschossen, ein Irrealis im Bild. Am Ende die großen Explosionen, gestellte Todesszenen - wir liegen noch nich richtig, die Musik gehorcht, verstummt - und lauter Jugendliche in Gangsterposen rennen plötzlich über den Platz und sie schießen weiß Gott allein auf wen und wohin, im Schlepptau haben sie junge Frauen, sie haben Filme von Godard gesehen (und Godard wiederum hat amerikanische Filme gesehen) und sie rennen sie nun rum, Kopien ohne Saft und Kraft, und steigen in verbrannte Autos, die hinfort fahren, lächerlich. Harter Schnitt auf bemannte Pferde, es ist nacht, Großaufnahmen, alles viel zu nah, es ist grotesk, es ist lächerlich, es ist großartig, Rot, immer wieder alles rot, Abspann über dem Bild.
Dazwischen so viel mehr. Eifersuchtsgeschichten. Rezitationen aus Roland Barthes Texten, aus dem Off, während aufgetischt wird. Mahlzeiten aus Elle. Fahren wie nach London. Groteske Selbstbildnisse. Hier werden die Lenins und Stalins von morgen geboren. Der Polizist scheitert vor dem grotesken Transvestiten, in dem der Vater zur Mutter wurde, seine Rache schon fast, der Polizist erlebt den Regress fast körperlich schon nach. Zum Vater wird ihm ein überdimensionales Selbstbildnis des Künstlers, er kann es nicht tragen, die Tränen, Zusammenbruch, wie unter dem Kreuze fast, Infantiltität.
Ich beginne, die Filme zu verwechseln. Sie scheinen ineinander zu fließen.
Und dann immer wieder das Rot. Das große Gesicht des Pferdes am Ende. Ein Film voller Gewalt und Größenwahn. Rausch.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
15. April 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
13.04.2005, Heimkino; Inhalt.
Den ersten Teil kenne ich nicht, doch habe ich sachkundige Begleitung bei der Sichtung, die mich in Fällen, wo es dem Verständnis dienlich ist, aufklärt. Natürlich ist das ein Film, bei dem man sich an manchen Stellen amüsieren kann. Die Figur selbst lädt dazu geradewegs überoffensichtlich ein, zumal wenn man von der Absurdität des Daseins und einer allzu sehr bürgerlichen Vorgaben gehorchenden Vorstellung von Lebensführung überzeugt ist. Bridget Jones, und ein bisschen vielleicht auch Renee Zellweger selbst, ist jemand, bzw. die Figur eines Typs, über die man in diesem Falle gut lachen kann und der Film ist dabei Komplize, eigentlich.
Dabei ist jedoch bisweilen erschreckend, mit welchem Zynismus er, der Film, dann doch zu Werke geht und den Archetypus der modernen, auf ganz eigene Art und Weise benachteiligten Frau exponiert. Der Loop im Fernsehstudio von Bridget Jones' Hintern, der gerade mächtig aus der Luft auf eine Kamera hinunterkommt (sie ist, nicht an sich, aber in diesem Falle, Fallschirmspringerin) und damit die ganze Plumpheit der Person in die Endloswiederholung am Schneidetisch packt, ist dabei zwar bezeichnend genug, aber eigentlich noch das Mindeste. Das Potential dieser Szene wird willig erfüllt in anderen Szenen, dass man sich an den Kopf fasst, warum nun gerade Frauen in einer ähnlichen Position wie Bridget Jones selbst hier einen Film für sich gefunden haben. Es mag vielleicht auch etwas mit dem Märchen vom hässlichen Entlein zu tun haben oder von Aschenputtel meinethalben, das am Ende dann doch, wie, natürlich, Bridget Jones, einen Märchenprinzen kriegt (der allerdings so märchig gar nicht ist, eher schon ist er eigentlich nur ein fades Rindvieh mit zugegeben etwas Besitz; wieviel interessanter ist da doch eigentlich die von Hugh Grant personifizierte Figur, zugegeben ein liderliches Wesen mit Macken von Funkturmgröße - aber immerhin kein verbohrt-verspießter wandelnder Hirnriss).
Der Gipfel des ausgestellten Zynismus (der, meiner Meinung nach, schwerer wiegt als das versammelte Arsenal an Zynismen der Pulpkultur) ist schließlich eine Episode in einem thailändischen Frauengefängnis, wo Bridget Jones - unschuldig zwar, doch die Indizien wiegen schwer - wegen Drogenschmuggels festgehalten wird. Hier wird dann alles zum Tand, zum billigen narrative device, das sich für keine Dreistigkeit zu schade ist. Die Episode dient, im wesentlichen, dazu, Bridget Jones zu verdeutlichen, dass der arrogante Snob, dem sie hinterher rennt, eigentlich doch ein dufter Typ ist, im direkten Vergleich mit den Schrecknissen jedenfalls, die die inhaftierten Thailänderinnen - Zwangsprostitution, Schläge, Drogenabhängigkeiten - von ihren Kerlen erfahren müssen. Natürlich ist Bridget aber bald der Star in dieser Umgebung, verleiht BHs und bringt den Mädchen das Singen bei. Am Ende der Episode gibt's zum Abschied etwas Pralinen und all die kleinen Thai-Mädels hinter Gittern sind außer sich vor Freude. Eine Flockigkeit, die hier vor sehr real anmutenden Kulissen abgespielt wird, die einen nur noch grausen lässt.
Da sich zudem ansonsten nichts in dem Film findet, was eines weiteren Blickes bedürfte - man gibt sich in jeder Hinsicht als brav, altbacken, klassisch-egalem verpflichtet zu erkennen -, bleibt auch eigentlich nur recht diese politisch-soziale Dimension übrig, über die sich bezüglich dieses Films zu reden lohnt. Normalerweise bin ich ein großer Freund davon, der für gewöhnlich im allgemeinen Diskurs etwas überrepräsentierten Ideologiekritik weitere Themen zur Seite zu stellen, die andere Ebenen eines Filmes verhandeln lassen. Dem steht dieser Film jedoch selbst - gekonnt, möchte man fast sagen - im Wege. Gelacht zuweilen, ja, mit Grausen.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
Den ersten Teil kenne ich nicht, doch habe ich sachkundige Begleitung bei der Sichtung, die mich in Fällen, wo es dem Verständnis dienlich ist, aufklärt. Natürlich ist das ein Film, bei dem man sich an manchen Stellen amüsieren kann. Die Figur selbst lädt dazu geradewegs überoffensichtlich ein, zumal wenn man von der Absurdität des Daseins und einer allzu sehr bürgerlichen Vorgaben gehorchenden Vorstellung von Lebensführung überzeugt ist. Bridget Jones, und ein bisschen vielleicht auch Renee Zellweger selbst, ist jemand, bzw. die Figur eines Typs, über die man in diesem Falle gut lachen kann und der Film ist dabei Komplize, eigentlich.
Dabei ist jedoch bisweilen erschreckend, mit welchem Zynismus er, der Film, dann doch zu Werke geht und den Archetypus der modernen, auf ganz eigene Art und Weise benachteiligten Frau exponiert. Der Loop im Fernsehstudio von Bridget Jones' Hintern, der gerade mächtig aus der Luft auf eine Kamera hinunterkommt (sie ist, nicht an sich, aber in diesem Falle, Fallschirmspringerin) und damit die ganze Plumpheit der Person in die Endloswiederholung am Schneidetisch packt, ist dabei zwar bezeichnend genug, aber eigentlich noch das Mindeste. Das Potential dieser Szene wird willig erfüllt in anderen Szenen, dass man sich an den Kopf fasst, warum nun gerade Frauen in einer ähnlichen Position wie Bridget Jones selbst hier einen Film für sich gefunden haben. Es mag vielleicht auch etwas mit dem Märchen vom hässlichen Entlein zu tun haben oder von Aschenputtel meinethalben, das am Ende dann doch, wie, natürlich, Bridget Jones, einen Märchenprinzen kriegt (der allerdings so märchig gar nicht ist, eher schon ist er eigentlich nur ein fades Rindvieh mit zugegeben etwas Besitz; wieviel interessanter ist da doch eigentlich die von Hugh Grant personifizierte Figur, zugegeben ein liderliches Wesen mit Macken von Funkturmgröße - aber immerhin kein verbohrt-verspießter wandelnder Hirnriss).
Der Gipfel des ausgestellten Zynismus (der, meiner Meinung nach, schwerer wiegt als das versammelte Arsenal an Zynismen der Pulpkultur) ist schließlich eine Episode in einem thailändischen Frauengefängnis, wo Bridget Jones - unschuldig zwar, doch die Indizien wiegen schwer - wegen Drogenschmuggels festgehalten wird. Hier wird dann alles zum Tand, zum billigen narrative device, das sich für keine Dreistigkeit zu schade ist. Die Episode dient, im wesentlichen, dazu, Bridget Jones zu verdeutlichen, dass der arrogante Snob, dem sie hinterher rennt, eigentlich doch ein dufter Typ ist, im direkten Vergleich mit den Schrecknissen jedenfalls, die die inhaftierten Thailänderinnen - Zwangsprostitution, Schläge, Drogenabhängigkeiten - von ihren Kerlen erfahren müssen. Natürlich ist Bridget aber bald der Star in dieser Umgebung, verleiht BHs und bringt den Mädchen das Singen bei. Am Ende der Episode gibt's zum Abschied etwas Pralinen und all die kleinen Thai-Mädels hinter Gittern sind außer sich vor Freude. Eine Flockigkeit, die hier vor sehr real anmutenden Kulissen abgespielt wird, die einen nur noch grausen lässt.
Da sich zudem ansonsten nichts in dem Film findet, was eines weiteren Blickes bedürfte - man gibt sich in jeder Hinsicht als brav, altbacken, klassisch-egalem verpflichtet zu erkennen -, bleibt auch eigentlich nur recht diese politisch-soziale Dimension übrig, über die sich bezüglich dieses Films zu reden lohnt. Normalerweise bin ich ein großer Freund davon, der für gewöhnlich im allgemeinen Diskurs etwas überrepräsentierten Ideologiekritik weitere Themen zur Seite zu stellen, die andere Ebenen eines Filmes verhandeln lassen. Dem steht dieser Film jedoch selbst - gekonnt, möchte man fast sagen - im Wege. Gelacht zuweilen, ja, mit Grausen.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
13. April 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
12.04.2005, Kino Intimes; Inhalt
Es stirbt sich schön, im neuen Film von Jean-Pierre Jeunet. Und über allem schweben Badalamentis traurige Weisen, nur um wieder aufs Neue glaubhaft zu versichern, dass dies hier Melancholie sei, das große Drama und, nicht zu vergessen, die große Liebe. Was für's Herz (und immer: was für's, ach was, was aufs Auge).
Das steinere Gefühl, das einen bespringt, wenn man in einen saftig einladenden Apfel zu beißen meint und es stellt sich heraus: Er ist aus Wachs. In Mathilde ist alles Wachs. Und dann stapft Jodie Foster durch's Bild - "Aber das ist doch..."-Getuschel im Saal begleitet den Auftritt -, dann wird sie irgendwann besprungen und ist wieder weg. Und so verhält sich das mit jedem Stück nostalgischer Klebrigkeit, das Jeunet hier in zähe Langeweile packt: Eine Ausschmückerei noch bis ins Pittoreske hinein, aber alles so wurscht, abgespult, reines Programm. Und Audrey Tatous Hintern zerren wir auch noch ins Bild. Wie niedlich er ist. So müde nach dem Film.
Ich bin nun weiß Gott keiner, den im Kino zu sentimentalen Emotionen hinzumobilisieren es viel Aufwands benötigte. Dass ich am Ende nur ein verwirrtes So where's the beef? im Kopf hatte ist vor diesem Hintergrund bezeichnend. Mathilde schaut und schaut und schaut. Diesseits des Bildes ich im Saal und mach's genauso. Und schaue und schaue und schaue. Vektoren, die ins Nichts führen, in geschmolzenes Wachs allenfalls.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
Es stirbt sich schön, im neuen Film von Jean-Pierre Jeunet. Und über allem schweben Badalamentis traurige Weisen, nur um wieder aufs Neue glaubhaft zu versichern, dass dies hier Melancholie sei, das große Drama und, nicht zu vergessen, die große Liebe. Was für's Herz (und immer: was für's, ach was, was aufs Auge).
Das steinere Gefühl, das einen bespringt, wenn man in einen saftig einladenden Apfel zu beißen meint und es stellt sich heraus: Er ist aus Wachs. In Mathilde ist alles Wachs. Und dann stapft Jodie Foster durch's Bild - "Aber das ist doch..."-Getuschel im Saal begleitet den Auftritt -, dann wird sie irgendwann besprungen und ist wieder weg. Und so verhält sich das mit jedem Stück nostalgischer Klebrigkeit, das Jeunet hier in zähe Langeweile packt: Eine Ausschmückerei noch bis ins Pittoreske hinein, aber alles so wurscht, abgespult, reines Programm. Und Audrey Tatous Hintern zerren wir auch noch ins Bild. Wie niedlich er ist. So müde nach dem Film.
Ich bin nun weiß Gott keiner, den im Kino zu sentimentalen Emotionen hinzumobilisieren es viel Aufwands benötigte. Dass ich am Ende nur ein verwirrtes So where's the beef? im Kopf hatte ist vor diesem Hintergrund bezeichnend. Mathilde schaut und schaut und schaut. Diesseits des Bildes ich im Saal und mach's genauso. Und schaue und schaue und schaue. Vektoren, die ins Nichts führen, in geschmolzenes Wachs allenfalls.
imdb ~ filmz.de ~ angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
11.04.2005, Heimkino
Ein Offizier von Rang und Namen (Ed Harris) – seine Karriere ließ ihn die Tet-Offensive ebenso miterleben wie den Desert Storm (von zahlreichen Geheimmissionen jenseits offizieller Verlautbarungen ganz abgesehen) – sucht Rache an den Vereinigten Staaten, welche seinen im Dienst für die Nation dahingegangenen Kameraden noch nicht mal ein offizielles Militärbegräbnis (von Entschädigungen für die Hinterbliebenen ganz zu schweigen) haben zukommen lassen. Zu diesem Zweck bringt er mit gleichgesinnten Soldaten mehrere mit tödlichen Chemikalien bestückte Raketen in seinen Besitz, nimmt eine Gruppe Touristen auf der legendären, nunmehr stillgelegten Gefängnisinsel Alcatraz zur Geisel, um von dort aus die Raketen auf San Francisco zu richten. Seine Forderung: 100 Millionen Dollar, davon je eine Million als Entschädigung für 83 Familien, den Rest für ihn zur freien Verfügung, und freies Geleit in ein Land ohne Auslieferungsverfahren für ihn und seine Kameraden. Die Regierung ruft den Chemikalienexperten Goodspeed (Nicolas Cage) auf den Plan, der alleine die Raketen entschärfen könnte. Um die Insel überhaupt einnehmen zu können, bedarf es indes der Dienste eines seit Jahr und Tag namenlos in Gewahrsam der us-amerikanischen Regierung einsitzenden britischen Geheimdienstagenten (Sean Connery), der einzige, dem in der Geschichte von Alcatraz je die Flucht von dort gelang. Der zeigt sich, aus naheliegenden Gründen, nicht unbedingt kooperationswillig, vielmehr ist er an einer möglichst bedingungslos wiedererlangten Freiheit interessiert. Unterdessen verrinnt die knappe Zeit bis zum Ende des Ultimatums: 24 Stunden nach Einnahme der Gefängnisinsel sollen die ersten todbringenden Raketen abgefeuert werden ...
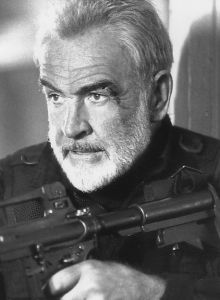 The Rock lässt sich umstandslos als höchst gelungener Vertreter des typischen Blockbuster-Kinos der 90er Jahre einsortieren. Seine Ziele erreicht er ohne weiteres mit Bravour. Diese mögen, im Sinne eines künstlerisch avancierten Kinos, nicht hoch angesetzt sein, doch besitzen auch sie, in der Tradition wiederum einer Geschichte des Kinos als Spielfeld für neue und vor allem angewandte Technologien, Gültigkeit. Nun setzen viele Regisseure (und noch mehr Filme) auf die Mischung einer dynamisch angehenden Geschichte mit viel technologischem Rabatz, doch ist es eben vor allem immer wieder das Team Bay/Bruckheimer, das nicht nur die nötigen finanziellen Mittel, sondern auch das nötige Wissen um diese Ader des Kinobetriebs mitbringt, um solchen (ebenfalls an sich nicht zu gering einzuschätzenden) Ansprüchen voll und ganz zu entsprechen. Hier erweist sich Kommerzialität ausnahmsweise als unbedingter Hauptgewinn: Während die unzähligen Actionklopper, die direct to video in die Filmwelt geblasen werden, für gewöhnlich an mehreren Stellen kranken – sei es ein für diese Ansprüche noch mangelhaft konstruierter narrativer Rahmen oder aber sichtliche handwerkliche wie finanzielle Mängel in der Gestaltung der Hauptattraktionen -, stellt ein Film wie The Rock, natürlich noch bis in Detail aus kulturindustriellen Überlegungen heraus konzipiert, ein in jeder Hinsicht perfektes Paket dar, das sein Publikum immerhin in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen vermag. Wenn schon Action-Blockbusterkino – ein Kino also, das seine Grandezza vor allem im tadellosen Handwerk entwickelt -, dann auf diese Weise, wo das Gefüge aus Charakterentwicklungen, dem grundlegenden Szenario und die darauf abhebende Action ein wohlaustariertes Gesamtergebnis zeitigen.
The Rock lässt sich umstandslos als höchst gelungener Vertreter des typischen Blockbuster-Kinos der 90er Jahre einsortieren. Seine Ziele erreicht er ohne weiteres mit Bravour. Diese mögen, im Sinne eines künstlerisch avancierten Kinos, nicht hoch angesetzt sein, doch besitzen auch sie, in der Tradition wiederum einer Geschichte des Kinos als Spielfeld für neue und vor allem angewandte Technologien, Gültigkeit. Nun setzen viele Regisseure (und noch mehr Filme) auf die Mischung einer dynamisch angehenden Geschichte mit viel technologischem Rabatz, doch ist es eben vor allem immer wieder das Team Bay/Bruckheimer, das nicht nur die nötigen finanziellen Mittel, sondern auch das nötige Wissen um diese Ader des Kinobetriebs mitbringt, um solchen (ebenfalls an sich nicht zu gering einzuschätzenden) Ansprüchen voll und ganz zu entsprechen. Hier erweist sich Kommerzialität ausnahmsweise als unbedingter Hauptgewinn: Während die unzähligen Actionklopper, die direct to video in die Filmwelt geblasen werden, für gewöhnlich an mehreren Stellen kranken – sei es ein für diese Ansprüche noch mangelhaft konstruierter narrativer Rahmen oder aber sichtliche handwerkliche wie finanzielle Mängel in der Gestaltung der Hauptattraktionen -, stellt ein Film wie The Rock, natürlich noch bis in Detail aus kulturindustriellen Überlegungen heraus konzipiert, ein in jeder Hinsicht perfektes Paket dar, das sein Publikum immerhin in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen vermag. Wenn schon Action-Blockbusterkino – ein Kino also, das seine Grandezza vor allem im tadellosen Handwerk entwickelt -, dann auf diese Weise, wo das Gefüge aus Charakterentwicklungen, dem grundlegenden Szenario und die darauf abhebende Action ein wohlaustariertes Gesamtergebnis zeitigen.
Dabei steht The Rock auch deutlich in einer Tradition, wie sie das Autokino der 50er und 60er Jahre mitbegründete. Eine reißerische, sensationalistische Geschichte, die sich unter Rückgriff auf vulgärstmögliches Wissenschaftsbla begründet, einigermaßen im Zweidimensionalen verhaften bleibende Figuren und ein deutliches Augenmerk auf strukturell Jahrmarktsattraktion entsprechender Sensationsinseln innerhalb des narrativen Gefüges, das selbst nur den möglichst flexiblen Rahmen eines solchen Zwecken dienliches Ablaufprogramms stellt. Es ist von daher kein Zufall, dass in Armageddon - ebenfalls von Bay/Bruckheimer inszeniert (und hierzulande, wo man seit jeher mit allzu profanen Gütern der Unterhaltungskultur seine dünkelhaften Reserven hat, ebenfalls belächelt) – die Kraterlandschaft des Kometen, der die Erde bedroht, einer modernen Version einer Planetenlandschaft aus einem beliebigen Science Fiction Reißer aus den Hallen der American International Pictures, jener legendären B-Movie-Schmiede von Samuel Arkoff, wo auch Roger Corman seine ersten Gehversuche wagte, entspricht, wie es ebenso wenig vom Zufall bestimmt ist, dass der MacGuffin in The Rock, die beinahe schon legendär tödliche Chemikalie in den Raketen, schummrig-grün glitzert und in kleinen, beinahe magisch anmutenden Kugeln gelagert wird, die sich nur mit bedeutungsschwangerer Geste den Raketen wieder entnehmen lassen. Hier trifft die Welt aus Vintage Comics und Autokino im technologisch aufgemotzten Rahmen des 90er Jahre Blockbusterkinos zusammen und nur von dieser Perspektive aus lassen sich die (meisten) Filme von Bay/Bruckheimer adäquat verstehen (und genau deshalb sind auch die Vorwürfe eines übertriebenen Patriotismus in deren Filmen so dermaßen abgehangen; zwar mag er attestierbar sein, doch ist dies die bequemste Haltung, die man als Kritiker aus der Zunft alteuropäischer Vernunftsheischerei einnehmen kann: sich am einen schon fast schmerzhaft anspringenden Offensichtlichsten aufhalten, um sich anhand dessen als weitsichtig zu gerieren, während man doch nur zu vertuschen gedenkt, dass hinter das Offensichtlichste einen Blick zu werfen die eigene Perspektive einem vor lauter Dünkel und Selbstzufriedenheit schon gar nicht mehr gestattet).
Die Filme von Bay/Bruckheimer mögen künstlerisch kaum weitsichtigen Charakter haben. Sie gehören keiner Tradition eines Kinos an, das etwas über die Welt und den Menschen aussagen will (allenfalls auf zweiter Ebene und auch dann nur über den Menschen im Medien- und Zeichenpark des ausgehenden 20. Jahrhunderts). Aus ihnen etwas zu lernen hieße vor der Komplexität der Welt zu kapitulieren (wie es im Umkehrschluss das selbe hieße, sie als Hauptschuldige einer allgemeinen Verdummung anzuklagen). Aber sie bedienen einen, meiner Ansicht nach höchst legitimen, Wunsch (auch) nach einem Kino der technologischen Möglichkeiten und bieten diesem einen Rahmen, in dem es sich auf beste, weil befreiteste Weise entfalten kann. Ein solches Kino in Ausschließlichkeit wäre die Hölle auf Erden, aber von Zeit zu Zeit in guten Dosen verabreicht: Ja bitte, sehr gerne.
imdb ~ mrqe
Ein Offizier von Rang und Namen (Ed Harris) – seine Karriere ließ ihn die Tet-Offensive ebenso miterleben wie den Desert Storm (von zahlreichen Geheimmissionen jenseits offizieller Verlautbarungen ganz abgesehen) – sucht Rache an den Vereinigten Staaten, welche seinen im Dienst für die Nation dahingegangenen Kameraden noch nicht mal ein offizielles Militärbegräbnis (von Entschädigungen für die Hinterbliebenen ganz zu schweigen) haben zukommen lassen. Zu diesem Zweck bringt er mit gleichgesinnten Soldaten mehrere mit tödlichen Chemikalien bestückte Raketen in seinen Besitz, nimmt eine Gruppe Touristen auf der legendären, nunmehr stillgelegten Gefängnisinsel Alcatraz zur Geisel, um von dort aus die Raketen auf San Francisco zu richten. Seine Forderung: 100 Millionen Dollar, davon je eine Million als Entschädigung für 83 Familien, den Rest für ihn zur freien Verfügung, und freies Geleit in ein Land ohne Auslieferungsverfahren für ihn und seine Kameraden. Die Regierung ruft den Chemikalienexperten Goodspeed (Nicolas Cage) auf den Plan, der alleine die Raketen entschärfen könnte. Um die Insel überhaupt einnehmen zu können, bedarf es indes der Dienste eines seit Jahr und Tag namenlos in Gewahrsam der us-amerikanischen Regierung einsitzenden britischen Geheimdienstagenten (Sean Connery), der einzige, dem in der Geschichte von Alcatraz je die Flucht von dort gelang. Der zeigt sich, aus naheliegenden Gründen, nicht unbedingt kooperationswillig, vielmehr ist er an einer möglichst bedingungslos wiedererlangten Freiheit interessiert. Unterdessen verrinnt die knappe Zeit bis zum Ende des Ultimatums: 24 Stunden nach Einnahme der Gefängnisinsel sollen die ersten todbringenden Raketen abgefeuert werden ...
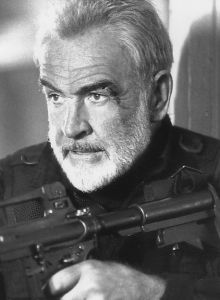 The Rock lässt sich umstandslos als höchst gelungener Vertreter des typischen Blockbuster-Kinos der 90er Jahre einsortieren. Seine Ziele erreicht er ohne weiteres mit Bravour. Diese mögen, im Sinne eines künstlerisch avancierten Kinos, nicht hoch angesetzt sein, doch besitzen auch sie, in der Tradition wiederum einer Geschichte des Kinos als Spielfeld für neue und vor allem angewandte Technologien, Gültigkeit. Nun setzen viele Regisseure (und noch mehr Filme) auf die Mischung einer dynamisch angehenden Geschichte mit viel technologischem Rabatz, doch ist es eben vor allem immer wieder das Team Bay/Bruckheimer, das nicht nur die nötigen finanziellen Mittel, sondern auch das nötige Wissen um diese Ader des Kinobetriebs mitbringt, um solchen (ebenfalls an sich nicht zu gering einzuschätzenden) Ansprüchen voll und ganz zu entsprechen. Hier erweist sich Kommerzialität ausnahmsweise als unbedingter Hauptgewinn: Während die unzähligen Actionklopper, die direct to video in die Filmwelt geblasen werden, für gewöhnlich an mehreren Stellen kranken – sei es ein für diese Ansprüche noch mangelhaft konstruierter narrativer Rahmen oder aber sichtliche handwerkliche wie finanzielle Mängel in der Gestaltung der Hauptattraktionen -, stellt ein Film wie The Rock, natürlich noch bis in Detail aus kulturindustriellen Überlegungen heraus konzipiert, ein in jeder Hinsicht perfektes Paket dar, das sein Publikum immerhin in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen vermag. Wenn schon Action-Blockbusterkino – ein Kino also, das seine Grandezza vor allem im tadellosen Handwerk entwickelt -, dann auf diese Weise, wo das Gefüge aus Charakterentwicklungen, dem grundlegenden Szenario und die darauf abhebende Action ein wohlaustariertes Gesamtergebnis zeitigen.
The Rock lässt sich umstandslos als höchst gelungener Vertreter des typischen Blockbuster-Kinos der 90er Jahre einsortieren. Seine Ziele erreicht er ohne weiteres mit Bravour. Diese mögen, im Sinne eines künstlerisch avancierten Kinos, nicht hoch angesetzt sein, doch besitzen auch sie, in der Tradition wiederum einer Geschichte des Kinos als Spielfeld für neue und vor allem angewandte Technologien, Gültigkeit. Nun setzen viele Regisseure (und noch mehr Filme) auf die Mischung einer dynamisch angehenden Geschichte mit viel technologischem Rabatz, doch ist es eben vor allem immer wieder das Team Bay/Bruckheimer, das nicht nur die nötigen finanziellen Mittel, sondern auch das nötige Wissen um diese Ader des Kinobetriebs mitbringt, um solchen (ebenfalls an sich nicht zu gering einzuschätzenden) Ansprüchen voll und ganz zu entsprechen. Hier erweist sich Kommerzialität ausnahmsweise als unbedingter Hauptgewinn: Während die unzähligen Actionklopper, die direct to video in die Filmwelt geblasen werden, für gewöhnlich an mehreren Stellen kranken – sei es ein für diese Ansprüche noch mangelhaft konstruierter narrativer Rahmen oder aber sichtliche handwerkliche wie finanzielle Mängel in der Gestaltung der Hauptattraktionen -, stellt ein Film wie The Rock, natürlich noch bis in Detail aus kulturindustriellen Überlegungen heraus konzipiert, ein in jeder Hinsicht perfektes Paket dar, das sein Publikum immerhin in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen vermag. Wenn schon Action-Blockbusterkino – ein Kino also, das seine Grandezza vor allem im tadellosen Handwerk entwickelt -, dann auf diese Weise, wo das Gefüge aus Charakterentwicklungen, dem grundlegenden Szenario und die darauf abhebende Action ein wohlaustariertes Gesamtergebnis zeitigen.Dabei steht The Rock auch deutlich in einer Tradition, wie sie das Autokino der 50er und 60er Jahre mitbegründete. Eine reißerische, sensationalistische Geschichte, die sich unter Rückgriff auf vulgärstmögliches Wissenschaftsbla begründet, einigermaßen im Zweidimensionalen verhaften bleibende Figuren und ein deutliches Augenmerk auf strukturell Jahrmarktsattraktion entsprechender Sensationsinseln innerhalb des narrativen Gefüges, das selbst nur den möglichst flexiblen Rahmen eines solchen Zwecken dienliches Ablaufprogramms stellt. Es ist von daher kein Zufall, dass in Armageddon - ebenfalls von Bay/Bruckheimer inszeniert (und hierzulande, wo man seit jeher mit allzu profanen Gütern der Unterhaltungskultur seine dünkelhaften Reserven hat, ebenfalls belächelt) – die Kraterlandschaft des Kometen, der die Erde bedroht, einer modernen Version einer Planetenlandschaft aus einem beliebigen Science Fiction Reißer aus den Hallen der American International Pictures, jener legendären B-Movie-Schmiede von Samuel Arkoff, wo auch Roger Corman seine ersten Gehversuche wagte, entspricht, wie es ebenso wenig vom Zufall bestimmt ist, dass der MacGuffin in The Rock, die beinahe schon legendär tödliche Chemikalie in den Raketen, schummrig-grün glitzert und in kleinen, beinahe magisch anmutenden Kugeln gelagert wird, die sich nur mit bedeutungsschwangerer Geste den Raketen wieder entnehmen lassen. Hier trifft die Welt aus Vintage Comics und Autokino im technologisch aufgemotzten Rahmen des 90er Jahre Blockbusterkinos zusammen und nur von dieser Perspektive aus lassen sich die (meisten) Filme von Bay/Bruckheimer adäquat verstehen (und genau deshalb sind auch die Vorwürfe eines übertriebenen Patriotismus in deren Filmen so dermaßen abgehangen; zwar mag er attestierbar sein, doch ist dies die bequemste Haltung, die man als Kritiker aus der Zunft alteuropäischer Vernunftsheischerei einnehmen kann: sich am einen schon fast schmerzhaft anspringenden Offensichtlichsten aufhalten, um sich anhand dessen als weitsichtig zu gerieren, während man doch nur zu vertuschen gedenkt, dass hinter das Offensichtlichste einen Blick zu werfen die eigene Perspektive einem vor lauter Dünkel und Selbstzufriedenheit schon gar nicht mehr gestattet).
Die Filme von Bay/Bruckheimer mögen künstlerisch kaum weitsichtigen Charakter haben. Sie gehören keiner Tradition eines Kinos an, das etwas über die Welt und den Menschen aussagen will (allenfalls auf zweiter Ebene und auch dann nur über den Menschen im Medien- und Zeichenpark des ausgehenden 20. Jahrhunderts). Aus ihnen etwas zu lernen hieße vor der Komplexität der Welt zu kapitulieren (wie es im Umkehrschluss das selbe hieße, sie als Hauptschuldige einer allgemeinen Verdummung anzuklagen). Aber sie bedienen einen, meiner Ansicht nach höchst legitimen, Wunsch (auch) nach einem Kino der technologischen Möglichkeiten und bieten diesem einen Rahmen, in dem es sich auf beste, weil befreiteste Weise entfalten kann. Ein solches Kino in Ausschließlichkeit wäre die Hölle auf Erden, aber von Zeit zu Zeit in guten Dosen verabreicht: Ja bitte, sehr gerne.
imdb ~ mrqe
° ° °
lol
