Thema: Filmtagebuch
28.01.2005, Heimkino
Die thailändische Legende, auf der der Film dem Vernehmen nach basiert, erzählt von einer jungen Frau, deren Gatte das Heim zu verlassen gezwungen wurde und die im folgenden noch Jahrhunderte als Geist auf der Suche nach ihm durch's Land streifte. Nang Nak, inszeniert von Nonzee Nimibutr, der zuletzt mit Baytong (Berlinale 2004 im Forum zu sehen) einen bisweilen recht sehenswerten filmischen Kommentar zur religiös gespaltenen Lage seines Landes ablieferte, verlegt diese Geschichte mit leichter Variation an den Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der junge Mak wird aus dem Naturidyll einer abseits gelegenen Siedlung im tiefen Dschungel zum Militär für den Krieg abgeordnet und lässt seine schwangere Frau, Nak, unter Tränen zurück. Im Kriege entgeht er nur knapp dem Tod, während die zurückgelassene Nak unter Komplikationen einem Sohn das Leben schenkt. So zumindest der erste Eindruck, der sich ihm ergibt, als er lebendig und trotz traumatisierender Erfahrungen recht lebenslustig aus einem Kloster, wo man ihn gesund gepflegt hatte, zurückkehrt. Doch etwas liegt im Argen: Schreckliche Visionen plagen ihn, seine Freunde verhalten sich merkwürdig bis mutmaßlich intrigant. Einer fasst sich schließlich ein Herz und unterrichtet den jungen Veteran, dass Nak mitsamt dem Kind während der Geburt verstorben sei ...
Nang Nak ist ein deutlich ambitionierter Versuch, eine Geistergeschichte mit romantisch-melodramatischem Hintergrund auf eine an sich eher untypische Weise zu erzählen. Dafür sprechen die auffällig geringe Zahl üblicher Genre-Schockmomente, eine buttersanfte Montage, die verschiedene Bildeindrücke betont langsam ineinander gleiten lässt, und nicht zuletzt auch die Bemühung, dem Film eine Art zweite Erzählebene zu verleihen, die sich ganz auf Eindrücke der Dschungelflora und -fauna stützt, welche, auf diese Weise ins Bild gesetzt, wirkt wie ein einziges Kompendium an Mirakulösem und Bestaunenswertem. Ergeben soll sich augenscheinlich ein flirrendes Bild des Dschungels. Dies jedoch vollzieht sich in einer Art und Weise, die vom naturmystischen Kitsch der Reklamespots für Entspannungs-CDs nicht weit entfernt ist. Dramaturgische Längen vor allem zur Mitte hin, endlos öde Dialoge ("Geh nicht von mir! Ich liebe Dich!" - "Ich liebe Dich so sehr" - "Geh nicht weg!" - "Oh, Nak, ich liebe Dich!" - "Ich liebe Dich, bitte geh nicht weg!" ...) und vor allem letzten Endes auch die vor sich hergetragene Verweigerung, ein kinetisches Genrefeuerwerk abzuzünden, die an dessen Stelle indes auch keine Alternative oder Variation aufzubauen in der Lage ist, ergeben ein im Endeffekt eher ermüdendes Filmerlebnis.
Geradezu frech ist der Versuch des deutschen DVD-Anbieters, den Film auf dem Backcover als eine thailändische Antwort auf A Chinese Ghost Story anzupreisen. Weder narrativ, noch inszenatorisch, ästhetisch oder überhaupt intentionell gibt es da auch nur die leisteste Ahnung einer Verwandtschaft. Etwas irritierend ist der Umstand, dass offenbar keiner der Dschungeldorfbewohner über ein einsatzfähiges Gebiss verfügt - entweder haben die alle keine Zähne mehr oder sie sind kohlrabenschwarz von was auch immer.
imdb
Die thailändische Legende, auf der der Film dem Vernehmen nach basiert, erzählt von einer jungen Frau, deren Gatte das Heim zu verlassen gezwungen wurde und die im folgenden noch Jahrhunderte als Geist auf der Suche nach ihm durch's Land streifte. Nang Nak, inszeniert von Nonzee Nimibutr, der zuletzt mit Baytong (Berlinale 2004 im Forum zu sehen) einen bisweilen recht sehenswerten filmischen Kommentar zur religiös gespaltenen Lage seines Landes ablieferte, verlegt diese Geschichte mit leichter Variation an den Beginn des 20. Jahrhunderts.

Der junge Mak wird aus dem Naturidyll einer abseits gelegenen Siedlung im tiefen Dschungel zum Militär für den Krieg abgeordnet und lässt seine schwangere Frau, Nak, unter Tränen zurück. Im Kriege entgeht er nur knapp dem Tod, während die zurückgelassene Nak unter Komplikationen einem Sohn das Leben schenkt. So zumindest der erste Eindruck, der sich ihm ergibt, als er lebendig und trotz traumatisierender Erfahrungen recht lebenslustig aus einem Kloster, wo man ihn gesund gepflegt hatte, zurückkehrt. Doch etwas liegt im Argen: Schreckliche Visionen plagen ihn, seine Freunde verhalten sich merkwürdig bis mutmaßlich intrigant. Einer fasst sich schließlich ein Herz und unterrichtet den jungen Veteran, dass Nak mitsamt dem Kind während der Geburt verstorben sei ...
Nang Nak ist ein deutlich ambitionierter Versuch, eine Geistergeschichte mit romantisch-melodramatischem Hintergrund auf eine an sich eher untypische Weise zu erzählen. Dafür sprechen die auffällig geringe Zahl üblicher Genre-Schockmomente, eine buttersanfte Montage, die verschiedene Bildeindrücke betont langsam ineinander gleiten lässt, und nicht zuletzt auch die Bemühung, dem Film eine Art zweite Erzählebene zu verleihen, die sich ganz auf Eindrücke der Dschungelflora und -fauna stützt, welche, auf diese Weise ins Bild gesetzt, wirkt wie ein einziges Kompendium an Mirakulösem und Bestaunenswertem. Ergeben soll sich augenscheinlich ein flirrendes Bild des Dschungels. Dies jedoch vollzieht sich in einer Art und Weise, die vom naturmystischen Kitsch der Reklamespots für Entspannungs-CDs nicht weit entfernt ist. Dramaturgische Längen vor allem zur Mitte hin, endlos öde Dialoge ("Geh nicht von mir! Ich liebe Dich!" - "Ich liebe Dich so sehr" - "Geh nicht weg!" - "Oh, Nak, ich liebe Dich!" - "Ich liebe Dich, bitte geh nicht weg!" ...) und vor allem letzten Endes auch die vor sich hergetragene Verweigerung, ein kinetisches Genrefeuerwerk abzuzünden, die an dessen Stelle indes auch keine Alternative oder Variation aufzubauen in der Lage ist, ergeben ein im Endeffekt eher ermüdendes Filmerlebnis.
Geradezu frech ist der Versuch des deutschen DVD-Anbieters, den Film auf dem Backcover als eine thailändische Antwort auf A Chinese Ghost Story anzupreisen. Weder narrativ, noch inszenatorisch, ästhetisch oder überhaupt intentionell gibt es da auch nur die leisteste Ahnung einer Verwandtschaft. Etwas irritierend ist der Umstand, dass offenbar keiner der Dschungeldorfbewohner über ein einsatzfähiges Gebiss verfügt - entweder haben die alle keine Zähne mehr oder sie sind kohlrabenschwarz von was auch immer.
imdb
° ° °
Thema: Filmtagebuch
23.01.2005, Kosmos UFA-Palast; Inhalt.

Schnell sticht die Farbgebung ins Auge: War es lange Zeit im großen Kino populär, den Bildern die Farben so gut es nur ging zu entziehen, lässt Scorsese mittels neuester Technik die Kraft des Technicolor wieder aufleben. Der Opulenz der Bilder - etwa in der Cocoanut-Bar - tut dies gut und man beginnt, sich in diesem Film heimisch zu fühlen. Man weiß, er dauert fast 3 Stunden. Eine lange Zeit, doch man ist gerne bereit, sie mit diesem Film zu verbringen.
The Aviator ist vor allem auch ein eigenes Bild Scorseses. Dass der Film mit der Produktion von Hell's Angels beginnt, über den - schenkt man dem Film hier Glauben - wohl ähnlich viel Häme ob dessen Gigantomanie und der Unentschlossenheit seines Regisseurs im Schnitt im Vorfeld ausgegossen wurde wie seinerzeit bei Gangs of New York, geschieht gewiss aus verschiedenen Gründen. Ganz unprätentios eröffnet der Film an dieser Stelle eine Schnittstelle, die den Hughes im Film auch als Scorsese lesen lässt. (und die Spitze der paranoiden Anwandlungen, wirken diese nicht auch wie eine schlecht gelaufene Drogenkarriere?)
Nicht vordergründig, aber doch spürbar wandelt sich das Farbsystem im Verlauf. Immer mit dramaturgischem und narrativem Gewinn. In dieser Sachtheit liegt der Glanz von The Aviator verborgen: Ein Mainstream-kompatibles Stück Glamourkino, das niemanden formal oder inszenatorisch vor den Kopf stoßen muss, dabei aber für denjenigen, der den Blick dafür hat, Scorsese als Auteur immer mit sich trägt.
The Aviator mag nicht Scorseses größter Wurf sein, auch sein klugster, bester Film ist das beileibe nicht. Aber es ist schön, Scorsese nach dem zwar, meiner Meinung nach, sehr gutem, aber dennoch in sich merkwürdig unentschlossenen Gangs of New York wieder ganz bei sich zu sehen, wie er also einen Film auch über die große Prachtzeit des Kinos schafft, mit eleganter Hand in jedem Moment.
imdb | filmz.de | angelaufen.de | mrqe

Schnell sticht die Farbgebung ins Auge: War es lange Zeit im großen Kino populär, den Bildern die Farben so gut es nur ging zu entziehen, lässt Scorsese mittels neuester Technik die Kraft des Technicolor wieder aufleben. Der Opulenz der Bilder - etwa in der Cocoanut-Bar - tut dies gut und man beginnt, sich in diesem Film heimisch zu fühlen. Man weiß, er dauert fast 3 Stunden. Eine lange Zeit, doch man ist gerne bereit, sie mit diesem Film zu verbringen.
The Aviator ist vor allem auch ein eigenes Bild Scorseses. Dass der Film mit der Produktion von Hell's Angels beginnt, über den - schenkt man dem Film hier Glauben - wohl ähnlich viel Häme ob dessen Gigantomanie und der Unentschlossenheit seines Regisseurs im Schnitt im Vorfeld ausgegossen wurde wie seinerzeit bei Gangs of New York, geschieht gewiss aus verschiedenen Gründen. Ganz unprätentios eröffnet der Film an dieser Stelle eine Schnittstelle, die den Hughes im Film auch als Scorsese lesen lässt. (und die Spitze der paranoiden Anwandlungen, wirken diese nicht auch wie eine schlecht gelaufene Drogenkarriere?)
Nicht vordergründig, aber doch spürbar wandelt sich das Farbsystem im Verlauf. Immer mit dramaturgischem und narrativem Gewinn. In dieser Sachtheit liegt der Glanz von The Aviator verborgen: Ein Mainstream-kompatibles Stück Glamourkino, das niemanden formal oder inszenatorisch vor den Kopf stoßen muss, dabei aber für denjenigen, der den Blick dafür hat, Scorsese als Auteur immer mit sich trägt.
The Aviator mag nicht Scorseses größter Wurf sein, auch sein klugster, bester Film ist das beileibe nicht. Aber es ist schön, Scorsese nach dem zwar, meiner Meinung nach, sehr gutem, aber dennoch in sich merkwürdig unentschlossenen Gangs of New York wieder ganz bei sich zu sehen, wie er also einen Film auch über die große Prachtzeit des Kinos schafft, mit eleganter Hand in jedem Moment.
imdb | filmz.de | angelaufen.de | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
22.01.2005, Heimkino

Was hier geschieht, ist natürlich nur noch großartig und verhält sich zur "diegetischen Versunkenheit", wie sie das in sich geschlossene, narrative Kino als Effekt intendiert, geradezu antithetisch. Eine solche wird nicht nur nicht etabliert, sie wird noch nicht einmal als vorsichtige Ahnung in Aussicht gestellt. Momente wie der aus der Mitte einer Tätowierung auf dem Brustkorb hervorschnellende Wachhund, hart von vorne und in Großaufnahme gefilmt, sind hierbei nur Spitzen eines Projektes, das den filmischen Raum vollends destabilisiert - an dieser Stelle sei auch an die nur vordergründig alberne, an sich aber schlicht geniale Szene mit dem fehlenden Spiegel erinnert - und jenseits von physikalischer, narrativer und psychologischer Logik verortet. Hier tun sich Verknüpfungen zum Surrealismus und Dadaismus auf, wie auch die konsequente Verneinung jeglicher Werte und Autoritäten (seien es politische, personelle oder nur idealtypische, beispielsweise die Autorität der Gepflogenheiten, die Gespräche in ihrem Verlauf normieren) mit diesen künstlerischen Ausdrucksformen Bündnisse schließen.
Der Film gipfelt in: Respektlosigkeit gegenüber bellizistischer Wahnvorstellungen und pazifistisch-narzistischer Betroffenheitsrethorik (ist es doch die Logik der Vernunft, die in letzterer den Kopf als Instrument verbietet und welche, konsequent beschritten, letzten Endes auch nur die Verneinung des Menschen als solchen zur Folge hat), Verharmlosung des Krieges ("Help wanted!") und perspektivisch bedingtes Bloßstellen jedweder politischer Betriebsamkeit als große, alberne Groteske. Kurzum: Punk avant la lettre.
Wenn Kunst vor allem Dinge in einem ästhetischen Bezugsrahmen sicht- und erfahrbar machen soll, die sich einer bloß dinglichen, alltäglichen Wahrnehmungsweise entziehen, dann ist Duck Soup, im Sinne dieser abstraktesten Definition, ganz große Kunst.

Was hier geschieht, ist natürlich nur noch großartig und verhält sich zur "diegetischen Versunkenheit", wie sie das in sich geschlossene, narrative Kino als Effekt intendiert, geradezu antithetisch. Eine solche wird nicht nur nicht etabliert, sie wird noch nicht einmal als vorsichtige Ahnung in Aussicht gestellt. Momente wie der aus der Mitte einer Tätowierung auf dem Brustkorb hervorschnellende Wachhund, hart von vorne und in Großaufnahme gefilmt, sind hierbei nur Spitzen eines Projektes, das den filmischen Raum vollends destabilisiert - an dieser Stelle sei auch an die nur vordergründig alberne, an sich aber schlicht geniale Szene mit dem fehlenden Spiegel erinnert - und jenseits von physikalischer, narrativer und psychologischer Logik verortet. Hier tun sich Verknüpfungen zum Surrealismus und Dadaismus auf, wie auch die konsequente Verneinung jeglicher Werte und Autoritäten (seien es politische, personelle oder nur idealtypische, beispielsweise die Autorität der Gepflogenheiten, die Gespräche in ihrem Verlauf normieren) mit diesen künstlerischen Ausdrucksformen Bündnisse schließen.
Der Film gipfelt in: Respektlosigkeit gegenüber bellizistischer Wahnvorstellungen und pazifistisch-narzistischer Betroffenheitsrethorik (ist es doch die Logik der Vernunft, die in letzterer den Kopf als Instrument verbietet und welche, konsequent beschritten, letzten Endes auch nur die Verneinung des Menschen als solchen zur Folge hat), Verharmlosung des Krieges ("Help wanted!") und perspektivisch bedingtes Bloßstellen jedweder politischer Betriebsamkeit als große, alberne Groteske. Kurzum: Punk avant la lettre.
Wenn Kunst vor allem Dinge in einem ästhetischen Bezugsrahmen sicht- und erfahrbar machen soll, die sich einer bloß dinglichen, alltäglichen Wahrnehmungsweise entziehen, dann ist Duck Soup, im Sinne dieser abstraktesten Definition, ganz große Kunst.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
21. Januar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Anfang Januar, UFA Kosmos; Inhalt.
Heist Movies haben ein grundsätzliches Problem, aus dessen Lösung sie primär ihren Reiz beziehen: Sie müssen schlauer als der Zuschauer sein. So wie die Gangster und Halunken in ihnen schlauer sein müssen als Alarmanlagen, gegnerische Teams, die Wächter der bürgerlichen Ordnung. Der Film und seine Stars sind Komplizen: Beide müssen sie tricksen. Die einen, um ans Geld zu kommen. Der andere, um an den Zuschauer zu kommen. Wer in ein Heist Movie geht, der will betrogen werden. Aber er will auch auf seine Kosten kommen. Der hingenommene Betrug ist nur solange von Genuss, wie er auch teuer erworben war. Heist Movies, die sich darum drücken, haben keine Chance, trotz allen guten Willens.
*
Mit Ocean's Eleven hat Steven Soderbergh vielleicht den heist movie to end all heist movies gedreht. Noch durchgeknallter, hinterlistiger, spektakulärer, glamouröser, cooler ging nicht. Zumindest nicht, solange der Rahmen des Bildes außer Acht gelassen, nur als Gegebenheit, nicht aber als Möglichkeit betrachtet wird. "Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg."
*
Also ist in Ocean's Twelve: Alles anders. Europa. Das alte Europa. Eine sich in diesem verirrende, irrlichternde Kamera, der jedwede Gelassenheit abhanden gekommen ist. Die Helden von einst sind satt geworden. Eher Depression, denn der leichte Zungenschlag des Anything Goes bestimmt diese Bilder. Nur wenig gelingt wirklich, die Müdigkeit spricht aus diesen Gesichtern. Und auch Julia Roberts sieht nicht mehr so aus wie sie selbst.
*

*
Full Frontal war der letzte Film von Steven Soderbergh, der in den hiesigen Kinos lief. Es war ein Film um Rahmen und Rahmungen, um Schachteln und Materialästhetiken. Ein Film, in dem die Position der Kamera einen Ort als Inneres eines Flugzeugs oder als Inneres eines Studios (mit einem Modell des Innern eines Flugzeugs darin) charakterisierte. Ein Film, der seine Ebenen ständig überlappen ließ und so seinen Inhalt offen ließ. Vielleicht hat er nie geendet, dies wäre eine Möglichkeit. In Ocean's Twelve findet er seinen Niederschlag, ist ungemein präsent. Als wären beide Filme miteinander verwoben (und sie sind es auch, letzten Endes, im Kopf ihres Regisseurs).
(ich muss an dieser Stelle zugeben, dass mir Full Frontal nicht gefallen hat.)
*
In Ocean's Twelve gibt es ein Vor- und ein Hinter-dem-Bild. Der Film erzählt sich maßgeblich auf zweiter Ebene. Und das Vordere ist eine Welt, in der der Film nicht diegetischer Raum, sondern ganz sabotierbares Material, eben Film, ist. In The Limey konnte man diesem ungemein am Physischen des Films und dessen Organisation interessierten Ansatz Soderberghs bei der Arbeit zusehen. Über Full Frontal kehrt er zurück, auch wenn das erst vom Ende her betrachtet erkenntlich wird.
*

*
Und andererseits ist Ocean's Twelve aber auch gar nicht Film im quasi-zweidimensionalen Sinne des Filmstreifens. Er erzählt von einer Welt, in der von der Postmoderne selbst schon wieder in Filmen erzählt werden kann, als wäre sie eine in jeder Hinsicht kontingente Pille, die man einwerfen und schlucken kann. "Erinnerst Du Dich an die Szene in Miller's Crossing...?", heißt es an einer Stelle. Ocean's Twelve spielt in einer Welt, die extra-diegetisch ist, und die die Möglichkeit besitzt, darin Ocean's Twelve zu inszenieren. Eine Welt, in der man sich selbst begegnen kann, eine Welt der konsequent doppelt gebrochenen Ironie.
*
Ein Bild ist von besonderer Bedeutung: Es zeigt ein herannahendes Flugzeug im Landeanflug, aus Richtung der Landebahn geschossen. An sich ist das ein denkbar gewöhnlicher Bildinhalt. Das Besondere jedoch an diesem Bild: Die Kamera steht parallel zum Erdboden, das Bild steht im 90° Winkel zu seiner üblichen Ausrichtung. Doch das Flugzeug naht heran, die Kamera dreht sich mit und als das Flugzeug über die Kameraposition hinwegfliegt, blicken wir direkt nach oben, hin zu seinem Bauch. Das verschobene Bild hat sich durch eine simple Bewegung in eine normale Ansicht verwandelt, die man kennen kann. Doch das Flugzeug fliegt weiter, die Kamera rollt weiter und das Bild verschiebt sich wieder zurück in eine Verfremdung, die vom konzipierten Charakter des Bildes spricht. Was zunächst wie ein bloßes Kunststück eines formgewitzten Regisseurs anmutet, aber nicht wirklich etwas meinen muss, wird, allein über diese Bewegung, zum Schlüsselmoment, in dem sich die Methode des Films ablesen lässt: Nimm das übliche, verändere den Blickwinkel, ohne es selbst zu verändern, gebe dem Publikum das Vertraute zurück, wiege sie in Sicherheit, und lasse schließlich doch die Verschiebung Oberhand gewinnen.
*

*
Ocean's Twelve ist eine Kakophonie des Scheiterns. Das ist neu für ein Heist Movie. Und doch ist alles alles andere als Scheitern. Der Film ist nicht in der Kadrage, wo wir ihn vermuten. Er steht woanders, jenseits dessen, von wo aus er uns lachend ansieht. Weil wir betrogen werden wollten, nicht betrogen zu werden glaubten und darüber erst der Betrug stattfand. Weil er den Rahmen beachtete, schlauer war als wir und eine paradoxe Logik seiner Selbst entwarf, in der hier wie dort zugleich sein kann.
*
Ocean's Twelve ist ein ganz und gar unmöglicher Film. Süß ist es, dass er in den größten Sälen mit maximalem Erfolg hier lief. Dies ist nur ein weiterer Betrug.
imdb | angelaufen.de | filmz.de
filmtagebuch: steven soderbergh
Heist Movies haben ein grundsätzliches Problem, aus dessen Lösung sie primär ihren Reiz beziehen: Sie müssen schlauer als der Zuschauer sein. So wie die Gangster und Halunken in ihnen schlauer sein müssen als Alarmanlagen, gegnerische Teams, die Wächter der bürgerlichen Ordnung. Der Film und seine Stars sind Komplizen: Beide müssen sie tricksen. Die einen, um ans Geld zu kommen. Der andere, um an den Zuschauer zu kommen. Wer in ein Heist Movie geht, der will betrogen werden. Aber er will auch auf seine Kosten kommen. Der hingenommene Betrug ist nur solange von Genuss, wie er auch teuer erworben war. Heist Movies, die sich darum drücken, haben keine Chance, trotz allen guten Willens.
*
Mit Ocean's Eleven hat Steven Soderbergh vielleicht den heist movie to end all heist movies gedreht. Noch durchgeknallter, hinterlistiger, spektakulärer, glamouröser, cooler ging nicht. Zumindest nicht, solange der Rahmen des Bildes außer Acht gelassen, nur als Gegebenheit, nicht aber als Möglichkeit betrachtet wird. "Jeder geschlossene Raum ist ein Sarg."
*
Also ist in Ocean's Twelve: Alles anders. Europa. Das alte Europa. Eine sich in diesem verirrende, irrlichternde Kamera, der jedwede Gelassenheit abhanden gekommen ist. Die Helden von einst sind satt geworden. Eher Depression, denn der leichte Zungenschlag des Anything Goes bestimmt diese Bilder. Nur wenig gelingt wirklich, die Müdigkeit spricht aus diesen Gesichtern. Und auch Julia Roberts sieht nicht mehr so aus wie sie selbst.
*

*
Full Frontal war der letzte Film von Steven Soderbergh, der in den hiesigen Kinos lief. Es war ein Film um Rahmen und Rahmungen, um Schachteln und Materialästhetiken. Ein Film, in dem die Position der Kamera einen Ort als Inneres eines Flugzeugs oder als Inneres eines Studios (mit einem Modell des Innern eines Flugzeugs darin) charakterisierte. Ein Film, der seine Ebenen ständig überlappen ließ und so seinen Inhalt offen ließ. Vielleicht hat er nie geendet, dies wäre eine Möglichkeit. In Ocean's Twelve findet er seinen Niederschlag, ist ungemein präsent. Als wären beide Filme miteinander verwoben (und sie sind es auch, letzten Endes, im Kopf ihres Regisseurs).
(ich muss an dieser Stelle zugeben, dass mir Full Frontal nicht gefallen hat.)
*
In Ocean's Twelve gibt es ein Vor- und ein Hinter-dem-Bild. Der Film erzählt sich maßgeblich auf zweiter Ebene. Und das Vordere ist eine Welt, in der der Film nicht diegetischer Raum, sondern ganz sabotierbares Material, eben Film, ist. In The Limey konnte man diesem ungemein am Physischen des Films und dessen Organisation interessierten Ansatz Soderberghs bei der Arbeit zusehen. Über Full Frontal kehrt er zurück, auch wenn das erst vom Ende her betrachtet erkenntlich wird.
*

*
Und andererseits ist Ocean's Twelve aber auch gar nicht Film im quasi-zweidimensionalen Sinne des Filmstreifens. Er erzählt von einer Welt, in der von der Postmoderne selbst schon wieder in Filmen erzählt werden kann, als wäre sie eine in jeder Hinsicht kontingente Pille, die man einwerfen und schlucken kann. "Erinnerst Du Dich an die Szene in Miller's Crossing...?", heißt es an einer Stelle. Ocean's Twelve spielt in einer Welt, die extra-diegetisch ist, und die die Möglichkeit besitzt, darin Ocean's Twelve zu inszenieren. Eine Welt, in der man sich selbst begegnen kann, eine Welt der konsequent doppelt gebrochenen Ironie.
*
Ein Bild ist von besonderer Bedeutung: Es zeigt ein herannahendes Flugzeug im Landeanflug, aus Richtung der Landebahn geschossen. An sich ist das ein denkbar gewöhnlicher Bildinhalt. Das Besondere jedoch an diesem Bild: Die Kamera steht parallel zum Erdboden, das Bild steht im 90° Winkel zu seiner üblichen Ausrichtung. Doch das Flugzeug naht heran, die Kamera dreht sich mit und als das Flugzeug über die Kameraposition hinwegfliegt, blicken wir direkt nach oben, hin zu seinem Bauch. Das verschobene Bild hat sich durch eine simple Bewegung in eine normale Ansicht verwandelt, die man kennen kann. Doch das Flugzeug fliegt weiter, die Kamera rollt weiter und das Bild verschiebt sich wieder zurück in eine Verfremdung, die vom konzipierten Charakter des Bildes spricht. Was zunächst wie ein bloßes Kunststück eines formgewitzten Regisseurs anmutet, aber nicht wirklich etwas meinen muss, wird, allein über diese Bewegung, zum Schlüsselmoment, in dem sich die Methode des Films ablesen lässt: Nimm das übliche, verändere den Blickwinkel, ohne es selbst zu verändern, gebe dem Publikum das Vertraute zurück, wiege sie in Sicherheit, und lasse schließlich doch die Verschiebung Oberhand gewinnen.
*

*
Ocean's Twelve ist eine Kakophonie des Scheiterns. Das ist neu für ein Heist Movie. Und doch ist alles alles andere als Scheitern. Der Film ist nicht in der Kadrage, wo wir ihn vermuten. Er steht woanders, jenseits dessen, von wo aus er uns lachend ansieht. Weil wir betrogen werden wollten, nicht betrogen zu werden glaubten und darüber erst der Betrug stattfand. Weil er den Rahmen beachtete, schlauer war als wir und eine paradoxe Logik seiner Selbst entwarf, in der hier wie dort zugleich sein kann.
*
Ocean's Twelve ist ein ganz und gar unmöglicher Film. Süß ist es, dass er in den größten Sälen mit maximalem Erfolg hier lief. Dies ist nur ein weiterer Betrug.
imdb | angelaufen.de | filmz.de
filmtagebuch: steven soderbergh
° ° °
Thema: Filmtagebuch
15. Januar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
13.01.2005, Heimkino
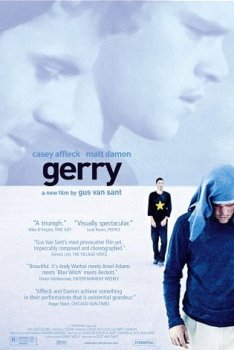 In seiner Reduktion und Anti-Haltung (mehr noch als später dann bei Elephant) radikales, radikalstes Kino. Der Film ist reiner Plot: Zwei junge Männer - beide heißen Gerry - fahren in die Wüste, um "the thing" zu sehen. Sie steigen aus, ziehen los, überlegen es sich bald anders (ohne dass wirklich etwas überlegt worden wäre: man entscheidet sich halt um, flachst dabei unverbindlich vor sich hin), wollen also zurückkehren, zum Wagen, doch sie verlaufen sich, ihr Weg führt immer tiefer in die mehr und mehr abstrakte, ortlos gewordene Wüste. Dies alles geschieht. Mehr nicht.
In seiner Reduktion und Anti-Haltung (mehr noch als später dann bei Elephant) radikales, radikalstes Kino. Der Film ist reiner Plot: Zwei junge Männer - beide heißen Gerry - fahren in die Wüste, um "the thing" zu sehen. Sie steigen aus, ziehen los, überlegen es sich bald anders (ohne dass wirklich etwas überlegt worden wäre: man entscheidet sich halt um, flachst dabei unverbindlich vor sich hin), wollen also zurückkehren, zum Wagen, doch sie verlaufen sich, ihr Weg führt immer tiefer in die mehr und mehr abstrakte, ortlos gewordene Wüste. Dies alles geschieht. Mehr nicht.
Kein Mehr auf einer dramaturgischen Ebene. Entbehrungen und Siechtum werden nicht zum Zwecke filmischen Gewinns in Szene gesetzt. Herausfordernden Situationen begegnet der Film mit mehrwertloser Lakonie: Der eine (die englischen Untertitel der DVD bezeichnen ihn als "Gerry2") steigt auf einen großen Felsen, um nach dem anderen Ausschau zu halten (man hatte sich zur Orientierung getrennt). Sein Tritt bröckelt dahin, er scheint auf dem Podest gefangen. Der andere kehrt zurück, und schafft Staub - "Make me a dirt mattress!" - heran. Eine quälend lange Szene ohne Schnitt, unbewegt in einer Distanz schaffenden Totalen gefilmt, keine Dramatik, beinahe schon öde. Irgendwann springt Gerry2 - noch immer die gleiche Einstellung - einfach runter, und das kommt dann schon fast einem "Chock" gleich (nicht zuletzt aufgrund der zurückgelegten Höhe). Aber ist wirklich was geschehen? Nein.

Musik gibt es dazu selten. Wenn überhaupt, dann sind es Soundscapes aus Ambient und Clicks'n'Cuts. Dann und wann Minimales von Arvo Pärt. Mal unterstreichend, mal konterkarierend. Zum flirrenden Höhepunkt dieser, ja, Zen-Meditation, die nur sich selbst zum Thema hat, keinen Gegenstand mehr aufzuweisen scheint, gerät eine ebenfalls quälend lange Einstellung, die beide Elenden von hinten zeigt, wie sie ausgehungert und mit einigem Abstand durch die Wüste stolpern. Die Bewegung findet augenscheinlich statt, doch der Abstand zwischen beiden und auch der Abstand zwischen ihnen und der Kamera ändert sich nicht: Im Zusammenspiel mit der nunmehr fast völlig konturlos gewordenen Wüste ergibt sich ein Bild des ewigen Sich-Fort-Bewegens ohne sich dabei jedoch fortzubewegen. Zu Beginn ist die Szene dunkel, es scheint früher Morgen, fast nichts ist zu sehen, doch unmerklich wird das Bild heller (fast so, als würde man sich nachts ans Dunkel gewöhnen), die beiden heben sich ab, der Boden wird erst grau, dann beinahe blendend weiß. Verzerrte Klänge aus Synthesizern, die in dieser Welt reinster Naturgewalt (die aber, eben, doch nicht gewalttätig im Sinne einer Überwältigung ist, eher ist es ein gleichmütiges Verschlucken, auch hier fehlt jeder Pathos: Der Blick in die verderbende Natur bleibt fremd, weil sich nichts darin findet, was dem kultivierten Menschen Referenz oder Anknüpfungspunkt sein könnte) so deplatziert wir unterstreichend wirken, verfremden das Gezeigte, geben ihm eine metaphysische Qualität, doch auch hier findet eine Dramatisierung nicht statt. Alles fließt, mitleidlos/leidenschaftslos beobachtet.

Ein bisschen ist das wie "Warten auf Godot". Hier, wie dort. Auch die ganz eigene Sprache der beiden Gerrys erinnert ein wenig daran.
Inserts zeigen andernorts zur Mystifizierung dienende Bilder von in atemberaubendem Tempo über Landschaften dahinrasende Wolken. Super8-Aufnahmen im Point of View, die im Zeitraffer über Straßen fahren. Doch die Bilder mystifizieren eben nicht. Sie zeigen lediglich eine Welt, die jenseits der Erfahrungswelt des Menschen liegen, unterstreichen die Differenz zwischen der stoisch bleibenden Wüste und den lächerlichen Figuren (die noch am Vorabend ihrer persönlichen Katastrophe, die der Film nicht katastrophisch im Sinne filmischer Konventionen werden lässt, sich beiläufig über Quatsch unterhalten, über Computerspiele etwa, wie man in einem Spiel - Age of Empire, oder Civilization oder ähnliches - Theben erobert hätte, was mangels eines letzten Pferdes jedoch scheitern musste) darin.
Am Ende überlebt dann einer. Der große Film, den man so gerne doch in einem Kino gesehen hätte, ist aus.
imdb | mrqe | gus van sant im weblog
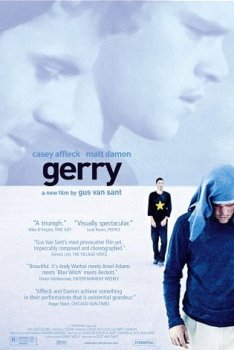 In seiner Reduktion und Anti-Haltung (mehr noch als später dann bei Elephant) radikales, radikalstes Kino. Der Film ist reiner Plot: Zwei junge Männer - beide heißen Gerry - fahren in die Wüste, um "the thing" zu sehen. Sie steigen aus, ziehen los, überlegen es sich bald anders (ohne dass wirklich etwas überlegt worden wäre: man entscheidet sich halt um, flachst dabei unverbindlich vor sich hin), wollen also zurückkehren, zum Wagen, doch sie verlaufen sich, ihr Weg führt immer tiefer in die mehr und mehr abstrakte, ortlos gewordene Wüste. Dies alles geschieht. Mehr nicht.
In seiner Reduktion und Anti-Haltung (mehr noch als später dann bei Elephant) radikales, radikalstes Kino. Der Film ist reiner Plot: Zwei junge Männer - beide heißen Gerry - fahren in die Wüste, um "the thing" zu sehen. Sie steigen aus, ziehen los, überlegen es sich bald anders (ohne dass wirklich etwas überlegt worden wäre: man entscheidet sich halt um, flachst dabei unverbindlich vor sich hin), wollen also zurückkehren, zum Wagen, doch sie verlaufen sich, ihr Weg führt immer tiefer in die mehr und mehr abstrakte, ortlos gewordene Wüste. Dies alles geschieht. Mehr nicht.Kein Mehr auf einer dramaturgischen Ebene. Entbehrungen und Siechtum werden nicht zum Zwecke filmischen Gewinns in Szene gesetzt. Herausfordernden Situationen begegnet der Film mit mehrwertloser Lakonie: Der eine (die englischen Untertitel der DVD bezeichnen ihn als "Gerry2") steigt auf einen großen Felsen, um nach dem anderen Ausschau zu halten (man hatte sich zur Orientierung getrennt). Sein Tritt bröckelt dahin, er scheint auf dem Podest gefangen. Der andere kehrt zurück, und schafft Staub - "Make me a dirt mattress!" - heran. Eine quälend lange Szene ohne Schnitt, unbewegt in einer Distanz schaffenden Totalen gefilmt, keine Dramatik, beinahe schon öde. Irgendwann springt Gerry2 - noch immer die gleiche Einstellung - einfach runter, und das kommt dann schon fast einem "Chock" gleich (nicht zuletzt aufgrund der zurückgelegten Höhe). Aber ist wirklich was geschehen? Nein.

Musik gibt es dazu selten. Wenn überhaupt, dann sind es Soundscapes aus Ambient und Clicks'n'Cuts. Dann und wann Minimales von Arvo Pärt. Mal unterstreichend, mal konterkarierend. Zum flirrenden Höhepunkt dieser, ja, Zen-Meditation, die nur sich selbst zum Thema hat, keinen Gegenstand mehr aufzuweisen scheint, gerät eine ebenfalls quälend lange Einstellung, die beide Elenden von hinten zeigt, wie sie ausgehungert und mit einigem Abstand durch die Wüste stolpern. Die Bewegung findet augenscheinlich statt, doch der Abstand zwischen beiden und auch der Abstand zwischen ihnen und der Kamera ändert sich nicht: Im Zusammenspiel mit der nunmehr fast völlig konturlos gewordenen Wüste ergibt sich ein Bild des ewigen Sich-Fort-Bewegens ohne sich dabei jedoch fortzubewegen. Zu Beginn ist die Szene dunkel, es scheint früher Morgen, fast nichts ist zu sehen, doch unmerklich wird das Bild heller (fast so, als würde man sich nachts ans Dunkel gewöhnen), die beiden heben sich ab, der Boden wird erst grau, dann beinahe blendend weiß. Verzerrte Klänge aus Synthesizern, die in dieser Welt reinster Naturgewalt (die aber, eben, doch nicht gewalttätig im Sinne einer Überwältigung ist, eher ist es ein gleichmütiges Verschlucken, auch hier fehlt jeder Pathos: Der Blick in die verderbende Natur bleibt fremd, weil sich nichts darin findet, was dem kultivierten Menschen Referenz oder Anknüpfungspunkt sein könnte) so deplatziert wir unterstreichend wirken, verfremden das Gezeigte, geben ihm eine metaphysische Qualität, doch auch hier findet eine Dramatisierung nicht statt. Alles fließt, mitleidlos/leidenschaftslos beobachtet.

Ein bisschen ist das wie "Warten auf Godot". Hier, wie dort. Auch die ganz eigene Sprache der beiden Gerrys erinnert ein wenig daran.
Inserts zeigen andernorts zur Mystifizierung dienende Bilder von in atemberaubendem Tempo über Landschaften dahinrasende Wolken. Super8-Aufnahmen im Point of View, die im Zeitraffer über Straßen fahren. Doch die Bilder mystifizieren eben nicht. Sie zeigen lediglich eine Welt, die jenseits der Erfahrungswelt des Menschen liegen, unterstreichen die Differenz zwischen der stoisch bleibenden Wüste und den lächerlichen Figuren (die noch am Vorabend ihrer persönlichen Katastrophe, die der Film nicht katastrophisch im Sinne filmischer Konventionen werden lässt, sich beiläufig über Quatsch unterhalten, über Computerspiele etwa, wie man in einem Spiel - Age of Empire, oder Civilization oder ähnliches - Theben erobert hätte, was mangels eines letzten Pferdes jedoch scheitern musste) darin.
Am Ende überlebt dann einer. Der große Film, den man so gerne doch in einem Kino gesehen hätte, ist aus.
imdb | mrqe | gus van sant im weblog
° ° °
Thema: Filmtagebuch
10. Januar 05 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
10.01.2005, Heimkino; Inhalt.
Ein eigenartig schöner, intelligent inszenierter Film von - kein Geblödel jetzt - philosophischer Tiefe, mit beeindruckender Akkurattese auf den Punkt gebracht: Keine Minute oder nur Sekunde zu lang, alles - verdammt viel - ist erzählt nach einer Stunde. Abspann.
*
Wie jemand für die Leidenschaft lebt, in einer Welt, die dafür nicht geschaffen ist. Zwei Jobs und der Nebenjob reiben auf, attackieren noch den Schlaf. Wind und Wetter torpedieren den Leidenschaftlichen beim Zeitungsaustragen. Allerlei Surreales in der Fischbude. Geschichten vorlesen im Altenheim (oder wo auch immer). Am Abend dann: Konzert in der minderbesuchten Kneipe am Eck. Nachbarn hinter Fenstern, zahlendes Publikum: Kaum. Groteske Figuren am Rande: Einer hat das Tonbandgerät stets bereit stehen, in der Hoffnung, eine Interpretation eines raren Stücks zu ergattern (die kriegt er und kommentiert es mit Zungenschlag - einer der schönsten seltsamen Momente in diesem Film). Ein anderer verkauft Heftpflaster zu zwei Mark pro Doppelmeter. Doch auf der Bühne spielen die Ausgestoßenen, sie spielen mit der ganzen Seele ihrer tristen Existenz (und wie wichtig Schneider dies ist, wird deutlich daran, dass nicht sattsam Bekanntes über die Musik gelegt wird, sondern die Musik für sich steht und auch das Bild kippt nie ins Groteske um): Hier, an dieser Stelle, ist Schneider wie Sisyphos bei Camus - wir müssen ihn uns als Glücklichen vorstellen, auch wenn der Stein jeden Moment zu kippen droht.
*

*
Überhaupt die Musik: On- und Off-Screen-organisiert finden sich Juwelen der Klangkunst, des Jazz. Die solo gespielte Orgel akzentuiert das Bild, trägt maßgeblich zu den schönen Ansichten bei. Weder Klamauk noch Pfeifenrauchertum bestimmen diese Töne: Es ist die reine Freude an ihnen selbst.
*
Das Ende: Versinnbildlichter Eskapismus. Eine andere Welt, absurder, grotesker noch als diese (die ohne Zweifel - keine Schneider'schen Verfremdung über ein Minimum heraus - auf unsere verweist), gleichzeitig aber schöner, bunter, musikalischer. Wie bei Sun Ra wird das Glück nicht auf Erden gesucht: Space is the Place. Neue Räume erschließen. Das Alberne, das hier mitschwingt, wird gebrochen durch den vorangegangen Film selbst, der nun alles andere als albern war, eher das melancholische Bild eines Menschen, dem die Kunst alles ist, selbst noch in jenen kleinen Zirkeln, die eine Welt zwischen Provinznest, Suff-Nachbarn und Fischbuletten ihr zugesteht.
imdb | offizielle site | angelaufen.de | filmz.de
Ein eigenartig schöner, intelligent inszenierter Film von - kein Geblödel jetzt - philosophischer Tiefe, mit beeindruckender Akkurattese auf den Punkt gebracht: Keine Minute oder nur Sekunde zu lang, alles - verdammt viel - ist erzählt nach einer Stunde. Abspann.
*
Wie jemand für die Leidenschaft lebt, in einer Welt, die dafür nicht geschaffen ist. Zwei Jobs und der Nebenjob reiben auf, attackieren noch den Schlaf. Wind und Wetter torpedieren den Leidenschaftlichen beim Zeitungsaustragen. Allerlei Surreales in der Fischbude. Geschichten vorlesen im Altenheim (oder wo auch immer). Am Abend dann: Konzert in der minderbesuchten Kneipe am Eck. Nachbarn hinter Fenstern, zahlendes Publikum: Kaum. Groteske Figuren am Rande: Einer hat das Tonbandgerät stets bereit stehen, in der Hoffnung, eine Interpretation eines raren Stücks zu ergattern (die kriegt er und kommentiert es mit Zungenschlag - einer der schönsten seltsamen Momente in diesem Film). Ein anderer verkauft Heftpflaster zu zwei Mark pro Doppelmeter. Doch auf der Bühne spielen die Ausgestoßenen, sie spielen mit der ganzen Seele ihrer tristen Existenz (und wie wichtig Schneider dies ist, wird deutlich daran, dass nicht sattsam Bekanntes über die Musik gelegt wird, sondern die Musik für sich steht und auch das Bild kippt nie ins Groteske um): Hier, an dieser Stelle, ist Schneider wie Sisyphos bei Camus - wir müssen ihn uns als Glücklichen vorstellen, auch wenn der Stein jeden Moment zu kippen droht.
*

*
Überhaupt die Musik: On- und Off-Screen-organisiert finden sich Juwelen der Klangkunst, des Jazz. Die solo gespielte Orgel akzentuiert das Bild, trägt maßgeblich zu den schönen Ansichten bei. Weder Klamauk noch Pfeifenrauchertum bestimmen diese Töne: Es ist die reine Freude an ihnen selbst.
*
Das Ende: Versinnbildlichter Eskapismus. Eine andere Welt, absurder, grotesker noch als diese (die ohne Zweifel - keine Schneider'schen Verfremdung über ein Minimum heraus - auf unsere verweist), gleichzeitig aber schöner, bunter, musikalischer. Wie bei Sun Ra wird das Glück nicht auf Erden gesucht: Space is the Place. Neue Räume erschließen. Das Alberne, das hier mitschwingt, wird gebrochen durch den vorangegangen Film selbst, der nun alles andere als albern war, eher das melancholische Bild eines Menschen, dem die Kunst alles ist, selbst noch in jenen kleinen Zirkeln, die eine Welt zwischen Provinznest, Suff-Nachbarn und Fischbuletten ihr zugesteht.
imdb | offizielle site | angelaufen.de | filmz.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch

Wer ein Geheimnis hat, vertraue es einem Baumloch an und schließe dieses mit Lehm, damit es darin sicher verwahrt bleibe. Mit diesem Ritual entließ uns Wong Kar-Wai vor viel zu langen Jahren aus seinem bezaubernden In the Mood for Love. 2046, auf den man viel zu lange warten musste, beginnt nun mit einer langen Fahrt aus einem Loch hinaus und endet mit einer Fahrt wieder hinein. Eine Rahmung, die verdeutlicht: Es geht um Geheimnisse und ihren Ort. Der Film selbst erscheint als ein solches (und er bleibt es in vielerlei Hinsicht auch). Er handelt zudem von der erdrückenden Anwesenheit eines Geheimnisses. Und er handelt davon, wie man Geheimnisse versteckt. In Bildern, Literatur, Musik, in kleinen Gesten. Und nicht zuletzt: In Filmen.

2046 ist ohne Zweifel Wong Kar-Wais poetischster, sinnlichster Film. Mehr noch als der ebenfalls schon hochstilisierte Vorgänger, ist 2046 darum bemüht, ein großes, traumhaftes Bild zu zeichnen, ohne dabei aber in die Langeweile des Panoramas zu gehen. Vielmehr lenkt er Blicke auf Details, fragmentiert, trennt ab, lässt die Dinge im Diffusen verschwimmen. Auffällig oft sind die Bilder angeschnitten oder größtenteils von dunklen Flächen im unscharfen Vordergrund verdeckt. Kaum, dass eine souveräne Übersicht ermöglichende Perspektive gewährt wird. Entsprechend flirren auch Zeit und Raum: Erinnerung, gegenwärtige Geschehnisse, Traum, Fiktionalisierung, Visualisierung literarischer Ergüsse? 2046 verneint nicht selten eindeutige Antworten auf die Frage nach dem Status seiner Bilder. Mehr als jeder andere Film von Wong Kar-Wai will er zuallererst sinnlich erlebt werden (und das heißt: am besten im Kino): Kameraführung, Ausstattung, der emotional ungemein aufwühlende Soundtrack, die Montage und nicht zuletzt die äußeren Erscheinungen der Darsteller ergeben ein kinematographisches Amalgam von einer Intensität, wie man sie lange nicht mehr erleben konnte.

Schwierig, eine Handlung eigentlichen Sinne zu destillieren. Wir begegnen Chow Mo Wan (Tony Leung Chiu Wai) aus In the Mood for Love wieder, der sich, Jahre nach den Ereignissen aus dem vorangegangenen Film, als Boulevardjournalist und Autor leichter Erotikromane verdingt, während auf den Straßen Hongkongs die Aufstände der 60er Jahre toben. Die tragische Liebesgeschichte hat er nie verwunden: Er sucht schnelle, erotische Abenteuer, ist nach außen hin zwar zunächst charmant, aber bindungsunfähig. In einem Buch namens 2046 schreibt er sein Innerstes nieder und projiziert sich selbst in ein japanisches Alter Ego, das in einem Science-Fiction-Szenario in einem Zug durch die Zeit reist, ins Jahr 2046, wo alle Erinnerungen für immer verweilen. 2046, das ist auch die Nummer des Zimmers, in dem Maggie Cheungs Figur aus In the Mood for Love lebte, neben das Chow Mo Wan nun wieder eingezogen ist. Und wieder leben Frauen in diesem Zimmer, das Spiel der Liebe dreht erneut seine Runden, durchzogen allerdings von Chow Mo Wans Geheimnis, das unausgesprochen über jedem gescheiterten, leidenschaftlichen neuen Abenteuer schwebt. Ein diffuses, oft episodenhaftes Bild von der Liebe nach ihrer eigentlichen Unmöglichkeit, über zwar viele, letztens Endes aber nur zwei Menschen, von denen der eine jedoch im anderen Film geblieben ist.

Viele Miniaturen, mal größer, mal kleiner angelegte Entwürfe finden sich in diesem Film. Bis zuletzt und über den Wettbewerb von Cannes hinaus hat Wong Kar-Wai am Schnitt gesessen. Dass man das, wie die langjährige Produktionszeit, dem Film nicht ansehe, wäre glatt gelogen. Manch einen mag der daraus resultierende, fragmentarische Charakter des Films vor den Kopf stoßen, wie auch, dass er vieles unklar lässt. Wer darüber jedoch hinwegsehen, darin vielleicht sogar die poetische Stärke und nicht zuletzt seine Klugheit als Kommentar zu Liebe, Sex, dem ganzen Rest anerkennen kann, wer sich an den reizenden Details erfreuen und sich vor allem lustvoll darin versenken kann, der wird mit einem ungemein euphorisch stimmenden Filmerlebnis belohnt. Ein Meisterwerk, das der ungeheuren Erwartungshaltung nach In the Mood for Love, vor allem aber: nach den ersten Stimmen aus Cannes, mit Leichtigkeit begegnet.
Ab 13. Januar im Kino (Verleih: Prokino). Offizielle Website.
2046 (Hongkong/China 2004)
Regie/Drehbuch: Wong Kar-Wai; Kamera: Christopher Doyle, Kwan Pung-Leung, Lai Yiu-Fai; Schnitt: William Chang; Musik: Peer Raben, Shigeru Umebayashi
Mit: Tony Leung Chiu Wai, Li Gong, Takuya Kimura, Faye Wong, Ziyi Zhang, Carina Lau, Chen Chang, Wang Sum, Ping Lam Siu, Maggie Cheung, u.a.
web: mrqe | 2046-news auf monkeypeaches
filmtagebuch: wong kar-wai | 2046 | kino aus hongkong
Regie/Drehbuch: Wong Kar-Wai; Kamera: Christopher Doyle, Kwan Pung-Leung, Lai Yiu-Fai; Schnitt: William Chang; Musik: Peer Raben, Shigeru Umebayashi
Mit: Tony Leung Chiu Wai, Li Gong, Takuya Kimura, Faye Wong, Ziyi Zhang, Carina Lau, Chen Chang, Wang Sum, Ping Lam Siu, Maggie Cheung, u.a.
web: mrqe | 2046-news auf monkeypeaches
filmtagebuch: wong kar-wai | 2046 | kino aus hongkong
° ° °
Thema: Filmtagebuch
02.01.2005, Kino Arsenal
 Warum, frage ich mich während der Vorführung, spielt dieser in den USA entstandene Film eigentlich in Wien? Die Stadt dient weder als Kulisse, noch wären die Figuren (für meinen Begriff) "typische Wiener". Ich überlege kurz, und komme auf einen Gedanken, der mir gefällt, der nicht unbedingt Gültigkeit besitzen muss, mit dem ich mich aber gut arrangieren kann: Wien ist so sehr die Stadt des Walzers, dass der berühmteste sogar nach ihr benannt ist. Und wie beim Walzer sich alles im Kreise dreht, wie der Rhythmus ganz im Vordergrund steht, wie Leichtigkeit und Charme diesen Tanz umgibt, aber auch immer eine Prise Ironie, wie schlußendlich auch das Spiel mit der Maske und Fassade zum Walzer gehört und man letzten Endes nie wirklich wissen kann, wer nun eigentlich geführt hat, so gilt dies auch in Gänze für Lubitschs wunderbaren Film.
Warum, frage ich mich während der Vorführung, spielt dieser in den USA entstandene Film eigentlich in Wien? Die Stadt dient weder als Kulisse, noch wären die Figuren (für meinen Begriff) "typische Wiener". Ich überlege kurz, und komme auf einen Gedanken, der mir gefällt, der nicht unbedingt Gültigkeit besitzen muss, mit dem ich mich aber gut arrangieren kann: Wien ist so sehr die Stadt des Walzers, dass der berühmteste sogar nach ihr benannt ist. Und wie beim Walzer sich alles im Kreise dreht, wie der Rhythmus ganz im Vordergrund steht, wie Leichtigkeit und Charme diesen Tanz umgibt, aber auch immer eine Prise Ironie, wie schlußendlich auch das Spiel mit der Maske und Fassade zum Walzer gehört und man letzten Endes nie wirklich wissen kann, wer nun eigentlich geführt hat, so gilt dies auch in Gänze für Lubitschs wunderbaren Film.
Und später, nach dem Kino, schaue ich nach, was andere schreiben und stoße, natürlich, auf Ekkehard Knörers Kritik und darin sieht er eigentlich ein Ballet in diesem Film, das ist nicht weit und deshalb freue ich mich.
Schön ist auch, wie der Film mit der Nahaufnahme arbeitet, wie sich über kleine Veränderungen im Gesichtsausdruck der Schauspieler Witz entwickelt (sich kräuselnde Lippen, Stirnfalten, die sich leicht aufzutürmen beginnen, und dergleichen), wie eine schnell eingeschnittene Pistole am Boden den Raum ganz verändert, eine Stola schließlich auch, die am Fuße, vom Geher unbemerkt, hängen bleibt. Wie darüber die seltenen Zwischentitel (aber auch sie im übrigen: Pointiert!) oft schon gar nicht mehr vermisst werden, weil alles sich im Bild und über die Montage erzählt. Im besten Sinne: Film mit Pfiff.
web: imdb | mrqe | lubitsch: tv-termine
filmtagebuch: magical history tour
 Warum, frage ich mich während der Vorführung, spielt dieser in den USA entstandene Film eigentlich in Wien? Die Stadt dient weder als Kulisse, noch wären die Figuren (für meinen Begriff) "typische Wiener". Ich überlege kurz, und komme auf einen Gedanken, der mir gefällt, der nicht unbedingt Gültigkeit besitzen muss, mit dem ich mich aber gut arrangieren kann: Wien ist so sehr die Stadt des Walzers, dass der berühmteste sogar nach ihr benannt ist. Und wie beim Walzer sich alles im Kreise dreht, wie der Rhythmus ganz im Vordergrund steht, wie Leichtigkeit und Charme diesen Tanz umgibt, aber auch immer eine Prise Ironie, wie schlußendlich auch das Spiel mit der Maske und Fassade zum Walzer gehört und man letzten Endes nie wirklich wissen kann, wer nun eigentlich geführt hat, so gilt dies auch in Gänze für Lubitschs wunderbaren Film.
Warum, frage ich mich während der Vorführung, spielt dieser in den USA entstandene Film eigentlich in Wien? Die Stadt dient weder als Kulisse, noch wären die Figuren (für meinen Begriff) "typische Wiener". Ich überlege kurz, und komme auf einen Gedanken, der mir gefällt, der nicht unbedingt Gültigkeit besitzen muss, mit dem ich mich aber gut arrangieren kann: Wien ist so sehr die Stadt des Walzers, dass der berühmteste sogar nach ihr benannt ist. Und wie beim Walzer sich alles im Kreise dreht, wie der Rhythmus ganz im Vordergrund steht, wie Leichtigkeit und Charme diesen Tanz umgibt, aber auch immer eine Prise Ironie, wie schlußendlich auch das Spiel mit der Maske und Fassade zum Walzer gehört und man letzten Endes nie wirklich wissen kann, wer nun eigentlich geführt hat, so gilt dies auch in Gänze für Lubitschs wunderbaren Film.Und später, nach dem Kino, schaue ich nach, was andere schreiben und stoße, natürlich, auf Ekkehard Knörers Kritik und darin sieht er eigentlich ein Ballet in diesem Film, das ist nicht weit und deshalb freue ich mich.
Schön ist auch, wie der Film mit der Nahaufnahme arbeitet, wie sich über kleine Veränderungen im Gesichtsausdruck der Schauspieler Witz entwickelt (sich kräuselnde Lippen, Stirnfalten, die sich leicht aufzutürmen beginnen, und dergleichen), wie eine schnell eingeschnittene Pistole am Boden den Raum ganz verändert, eine Stola schließlich auch, die am Fuße, vom Geher unbemerkt, hängen bleibt. Wie darüber die seltenen Zwischentitel (aber auch sie im übrigen: Pointiert!) oft schon gar nicht mehr vermisst werden, weil alles sich im Bild und über die Montage erzählt. Im besten Sinne: Film mit Pfiff.
web: imdb | mrqe | lubitsch: tv-termine
filmtagebuch: magical history tour
° ° °
Thema: Filmtagebuch
28.12.2004, Heimkino
 Eine Melodie wie aus einem späten Western führt diesen Film ein, aus jenen, die man gemeinhin als "Abgesang" auf das Genre und seinen Helden bezeichnet. Und jener Held, dem - was jenseits des Filmes begründet liegt, nur in kurzen Momenten aufblitzt, aber dennoch über allem zu liegen scheint - das Heldendasein verwehrt, verunmöglicht wird, schreitet im ersten Bild durch eine idealisierte Welt voller Natur und Idyll, wie aus einem Gemälde fast, und man könnte fast Einheit mit der Welt darin sehen, sabotierte das zweite Bild, die am See gelegene Hütte, wo er seinen alten Freund aus Kriegszeiten nach Jahren antreffen zu können meint (doch der Krebs hat jenen zerfressen), nicht diese Auffassung. Der Mythos ist schal geworden, Bilder (die erst gezeigt, dann zurückgelassen werden) sind zu verstummten Echos geworden, die von nichts mehr künden als von einem Verlust (aber nicht mehr von dem, was mal war), Gespenster besiedeln diese innere Welt, Phantome blitzen auf, durch die nur kontingent scheinenden Bilder hindurch.
Eine Melodie wie aus einem späten Western führt diesen Film ein, aus jenen, die man gemeinhin als "Abgesang" auf das Genre und seinen Helden bezeichnet. Und jener Held, dem - was jenseits des Filmes begründet liegt, nur in kurzen Momenten aufblitzt, aber dennoch über allem zu liegen scheint - das Heldendasein verwehrt, verunmöglicht wird, schreitet im ersten Bild durch eine idealisierte Welt voller Natur und Idyll, wie aus einem Gemälde fast, und man könnte fast Einheit mit der Welt darin sehen, sabotierte das zweite Bild, die am See gelegene Hütte, wo er seinen alten Freund aus Kriegszeiten nach Jahren antreffen zu können meint (doch der Krebs hat jenen zerfressen), nicht diese Auffassung. Der Mythos ist schal geworden, Bilder (die erst gezeigt, dann zurückgelassen werden) sind zu verstummten Echos geworden, die von nichts mehr künden als von einem Verlust (aber nicht mehr von dem, was mal war), Gespenster besiedeln diese innere Welt, Phantome blitzen auf, durch die nur kontingent scheinenden Bilder hindurch.
 Blitze, Explosionen, Pyrotechnik, kurz: Zerstörung. Bilder der Gewalt. Doch keines ist heroisch, erhaben, jubilatorisch. Jedes verweist auf eine zerstörte Innenwelt, auf zugefügte Schmerzen, auf Abhandengekommenes, nie mehr Erreichbares. Wir spüren das auch dadurch, weil es für diesen Elenden zwar ein Leben im Krieg vor dem Film gegeben hat, doch offenbar nie ein Leben vor dem Krieg. Der Verlust (den der Krieg markiert, aber nicht benennt) bleibt unaussprechlich, auch wenn, zum Ende hin, die Wortkargkeit mündet in Beredsamkeit und das steinerne Gesicht Tränen vergießt. Doch auch dann ist der Krieg Gegenstand.
Blitze, Explosionen, Pyrotechnik, kurz: Zerstörung. Bilder der Gewalt. Doch keines ist heroisch, erhaben, jubilatorisch. Jedes verweist auf eine zerstörte Innenwelt, auf zugefügte Schmerzen, auf Abhandengekommenes, nie mehr Erreichbares. Wir spüren das auch dadurch, weil es für diesen Elenden zwar ein Leben im Krieg vor dem Film gegeben hat, doch offenbar nie ein Leben vor dem Krieg. Der Verlust (den der Krieg markiert, aber nicht benennt) bleibt unaussprechlich, auch wenn, zum Ende hin, die Wortkargkeit mündet in Beredsamkeit und das steinerne Gesicht Tränen vergießt. Doch auch dann ist der Krieg Gegenstand.
 Rein auf ideologischer Ebene betrachtet, mag der Sprechakt sich schon durch die Perspektive desavouieren, die eingenommen und von der nie abgewichen wird. Dennoch bleibt der erste Film der vielbelächelten Ramboreihe (dass Teil 2 und 3 unter Gesichtspunkten des Trashs überhaupt nur funktionieren sei gar nicht verheimlicht) ein wichtiges Dokument, weil es einerseits einen spezifischen Moment der geistigen Verfassung einer verwundeten Nation zu fassen und adäquat zu bebildern bekommt (mehr vielleicht noch als Scorseses Taxi Driver), andererseits, weil es, in seiner seltsamen Vermischung verschiedenster Motive, auch als abschließender Kommentar zum US-Kino der 70er Jahre funktioniert. Ein - bei aller Melancholie, die ihm in jeder Einstellung steckt - mitreißender Film.
Rein auf ideologischer Ebene betrachtet, mag der Sprechakt sich schon durch die Perspektive desavouieren, die eingenommen und von der nie abgewichen wird. Dennoch bleibt der erste Film der vielbelächelten Ramboreihe (dass Teil 2 und 3 unter Gesichtspunkten des Trashs überhaupt nur funktionieren sei gar nicht verheimlicht) ein wichtiges Dokument, weil es einerseits einen spezifischen Moment der geistigen Verfassung einer verwundeten Nation zu fassen und adäquat zu bebildern bekommt (mehr vielleicht noch als Scorseses Taxi Driver), andererseits, weil es, in seiner seltsamen Vermischung verschiedenster Motive, auch als abschließender Kommentar zum US-Kino der 70er Jahre funktioniert. Ein - bei aller Melancholie, die ihm in jeder Einstellung steckt - mitreißender Film.
imdb | mrqe
 Eine Melodie wie aus einem späten Western führt diesen Film ein, aus jenen, die man gemeinhin als "Abgesang" auf das Genre und seinen Helden bezeichnet. Und jener Held, dem - was jenseits des Filmes begründet liegt, nur in kurzen Momenten aufblitzt, aber dennoch über allem zu liegen scheint - das Heldendasein verwehrt, verunmöglicht wird, schreitet im ersten Bild durch eine idealisierte Welt voller Natur und Idyll, wie aus einem Gemälde fast, und man könnte fast Einheit mit der Welt darin sehen, sabotierte das zweite Bild, die am See gelegene Hütte, wo er seinen alten Freund aus Kriegszeiten nach Jahren antreffen zu können meint (doch der Krebs hat jenen zerfressen), nicht diese Auffassung. Der Mythos ist schal geworden, Bilder (die erst gezeigt, dann zurückgelassen werden) sind zu verstummten Echos geworden, die von nichts mehr künden als von einem Verlust (aber nicht mehr von dem, was mal war), Gespenster besiedeln diese innere Welt, Phantome blitzen auf, durch die nur kontingent scheinenden Bilder hindurch.
Eine Melodie wie aus einem späten Western führt diesen Film ein, aus jenen, die man gemeinhin als "Abgesang" auf das Genre und seinen Helden bezeichnet. Und jener Held, dem - was jenseits des Filmes begründet liegt, nur in kurzen Momenten aufblitzt, aber dennoch über allem zu liegen scheint - das Heldendasein verwehrt, verunmöglicht wird, schreitet im ersten Bild durch eine idealisierte Welt voller Natur und Idyll, wie aus einem Gemälde fast, und man könnte fast Einheit mit der Welt darin sehen, sabotierte das zweite Bild, die am See gelegene Hütte, wo er seinen alten Freund aus Kriegszeiten nach Jahren antreffen zu können meint (doch der Krebs hat jenen zerfressen), nicht diese Auffassung. Der Mythos ist schal geworden, Bilder (die erst gezeigt, dann zurückgelassen werden) sind zu verstummten Echos geworden, die von nichts mehr künden als von einem Verlust (aber nicht mehr von dem, was mal war), Gespenster besiedeln diese innere Welt, Phantome blitzen auf, durch die nur kontingent scheinenden Bilder hindurch. Blitze, Explosionen, Pyrotechnik, kurz: Zerstörung. Bilder der Gewalt. Doch keines ist heroisch, erhaben, jubilatorisch. Jedes verweist auf eine zerstörte Innenwelt, auf zugefügte Schmerzen, auf Abhandengekommenes, nie mehr Erreichbares. Wir spüren das auch dadurch, weil es für diesen Elenden zwar ein Leben im Krieg vor dem Film gegeben hat, doch offenbar nie ein Leben vor dem Krieg. Der Verlust (den der Krieg markiert, aber nicht benennt) bleibt unaussprechlich, auch wenn, zum Ende hin, die Wortkargkeit mündet in Beredsamkeit und das steinerne Gesicht Tränen vergießt. Doch auch dann ist der Krieg Gegenstand.
Blitze, Explosionen, Pyrotechnik, kurz: Zerstörung. Bilder der Gewalt. Doch keines ist heroisch, erhaben, jubilatorisch. Jedes verweist auf eine zerstörte Innenwelt, auf zugefügte Schmerzen, auf Abhandengekommenes, nie mehr Erreichbares. Wir spüren das auch dadurch, weil es für diesen Elenden zwar ein Leben im Krieg vor dem Film gegeben hat, doch offenbar nie ein Leben vor dem Krieg. Der Verlust (den der Krieg markiert, aber nicht benennt) bleibt unaussprechlich, auch wenn, zum Ende hin, die Wortkargkeit mündet in Beredsamkeit und das steinerne Gesicht Tränen vergießt. Doch auch dann ist der Krieg Gegenstand.  Rein auf ideologischer Ebene betrachtet, mag der Sprechakt sich schon durch die Perspektive desavouieren, die eingenommen und von der nie abgewichen wird. Dennoch bleibt der erste Film der vielbelächelten Ramboreihe (dass Teil 2 und 3 unter Gesichtspunkten des Trashs überhaupt nur funktionieren sei gar nicht verheimlicht) ein wichtiges Dokument, weil es einerseits einen spezifischen Moment der geistigen Verfassung einer verwundeten Nation zu fassen und adäquat zu bebildern bekommt (mehr vielleicht noch als Scorseses Taxi Driver), andererseits, weil es, in seiner seltsamen Vermischung verschiedenster Motive, auch als abschließender Kommentar zum US-Kino der 70er Jahre funktioniert. Ein - bei aller Melancholie, die ihm in jeder Einstellung steckt - mitreißender Film.
Rein auf ideologischer Ebene betrachtet, mag der Sprechakt sich schon durch die Perspektive desavouieren, die eingenommen und von der nie abgewichen wird. Dennoch bleibt der erste Film der vielbelächelten Ramboreihe (dass Teil 2 und 3 unter Gesichtspunkten des Trashs überhaupt nur funktionieren sei gar nicht verheimlicht) ein wichtiges Dokument, weil es einerseits einen spezifischen Moment der geistigen Verfassung einer verwundeten Nation zu fassen und adäquat zu bebildern bekommt (mehr vielleicht noch als Scorseses Taxi Driver), andererseits, weil es, in seiner seltsamen Vermischung verschiedenster Motive, auch als abschließender Kommentar zum US-Kino der 70er Jahre funktioniert. Ein - bei aller Melancholie, die ihm in jeder Einstellung steckt - mitreißender Film.imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
Chicken Run (Peter Lord/Nick Park, GB 2000)
Harmlose, nette Unterhaltung, nett gemacht, noch netter gemeint und gerne mag man während der Sichtung Kuchen essen. Die Grandezza, die ich bei Trickfilmen aber immer noch gerne als Bonbon dabei haben möchte, das Spektakuläre, das Glitzernde also, fehlt ihm jedoch nahezu völlig. [imdb]
Kafka (Steven Soderbergh, USA 1991)
Letzten Endes traurig ist an diesem rein optisch sicher reizendem Film, dass man immer wieder meint, das Meisterwerk, das er durchaus sein könnte, durchblitzen sehen zu können, doch zu seinem Recht kommt es nie. Die Ambitionen werden einem daumendick aufs Butterbrot geschmiert - der Arzt heißt Dr. Murnau, gesucht werden die Orlac-Akten, später wird man bunt wie ein Hammer-Film und Allgemeinwissensanekdoten um die Persona Kafka werden so dick wie Taue eingefädelt - , allein, sie finden keine wirkliche Entsprechung im Werk insgesamt. Diese Aussichten auf das Große, was hier versucht werden wollte, sind es aber nun, die den Film insgesamt nicht als groß erscheinen lassen wollen. Wirklich schade: Kein Soderbergh, der zu Unrecht von der Kritik verrissen wurde und den es nun wiederzuentdecken gilt. [imdb]
Kronos (Kurt Neumann, USA 1957)
Nur halbherzig mitverfolgt, deswegen kaum verbindliche Äußerungen möglich. Erschien mir allerdings als etwas schwach auf der Brust, das erhoffte, durchgeknallte Drive-In-Erlebnis, wie man es von Sci-Fi-Knallern jener Tage durchaus erwarten darf (vgl. zum Beispiel den prima Earth vs. The Spider, der hier im "Blog des Grauens" adäquat gewürdigt wird), wird hier nur bedingt geboten. Etwas irritiert hat mich, dass einige Szenen irgendwie an Star Wars erinnerten, z.B. einige Anflugszenen auf den Weltallgiganten in der Wüstenei, gefilmt aus dem Innern des Militärflugzeugs heraus, das wirkte so ein bisschen wie die Schlacht um Hoth. [imdb]
The Incredibles (Brad Bird, USA 2004)
Ein großartiger Film, den es in Zukunft vielleicht sogar als Wendepunkt der computeranimierten Filmtradition zu betrachten gilt. Weg vom Kinder-Trulala, bei dem sich die Erwachsenen an technischen Gimmicks bloßer Machbarkeit erfreuen können, hin zur mitreißenden Story und einem Was der Ausstattung ("Kuck mal, die 60s-Möbel!") im Gegensatz zu deren vorherigem Wie ("Kuck mal, wie toll die das Wasser bei Findet Nemo animiert haben!"). Darüber hinaus auch ein spannender Kommentar zum Verhältnis von Superhelden (in deren goldenem Jahrzehnt, den 40ern, der Film beginnt) zu Superagenten wie James Bond (in dessen goldenem Jahrzehnt, den 60ern, der Film seinen weiteren Verlauf nimmt). Im Verein mit Shrek 2 und dem furiosen Sky Captain ist The Incredibles ein Indiz dafür, dass sich im Computerbereich einiges tut, was in Zukunft weiterzuverfolgen sich als spannend erweisen wird. [imdb]
Alexander (Oliver Stone, USA 2004)
Das weitgehend vernichtende Urteil der Kritik wird sich, so hoffe ich, in Zukunft als unberechtigt erweisen. "Langweilig" sei der Film, so konnte man es gemeinhin vernehmen. Natürlich ist er das, wenn man den Monumentalfilm nur als Vehikel für monumentale Bilder und Spektakel anzusehen bereit ist: Hier ist Alexander in der Tat nicht sonderlich ergiebig. Spannend wird es aber, wenn die eher essayistische Filmform Oliver Stones sich dieser Form annimmt und über den Genrekontext hinausweisende Fragen verhandelt. Das Ergebnis ist nichts, was sich didaktisch übernehmen ließe, aber eben doch interessant und wirft, im besten Sinne verstanden, Gedanken auf, die man nach dem Kinobesuch lange weiterspinnen kann. Deshalb betrachte ich Alexander eher als eine Art Gesprächsangebot (und in der Tat war Stones Film einer der wenigen dieses Jahres, wo ich andauernd reflektierte, weitere Schritte erahnen und das Geschehen verstehen wollte, kurzum: in mir mit dem Film über ihn diskutierte), als, natürlich, eine Kontroverse, für die Stone bekannt ist, doch entfaltet sie sich jenseits des Kinosaals vielleicht nur deshalb weniger als zu früheren Zeiten Stones, weil der Gegenstand erstem Augenschein nach nicht von Aktualitäten oder zumindest historisch nahen Bezügen gekennzeichnet ist. Schwer ist es, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ist der Film gut? Schlecht? Ich denke, die Knappheit solcher Floskeln wird den verschiedenen Inhalten des Films (und den verschiedenen möglichen Konzepten, ihm zu begegnen) nicht gerecht, weswegen ich hier auch ganz bewusst platzmangelshalber keine Gedankenoffenlegung betreiben möchte. Ganz grundsätzlich aber: Ein spannendes, anregendes Kinoerlebnis. Empfehlungsjournalismus, der ganz auf Tagesaktualitäten ausgerichtet ist, muss an dem Film vermutlich schon formhalber scheitern.
Nachtrag: Nachdem ich nun mal kreuz und quer Kritiken unterschiedlichster Herkunft und Ausrichtung gelesen habe, erscheint es mir bemerkenswert, mit welch kleinlicher Lust, die nicht selten zum Hysterischen neigt, der Film niederzureden versucht wird. Geradewegs so, als müsse man ihn sich vom Leibe halten, koste es, was es wolle. Nun hätte ich gegen einen argumentierten Verriss nicht das Geringste einzuwenden, aber was hier zum Teil für Armutszeugnisse abgeliefert werden, diskreditiert manch Website und Printperiodikum und nährt zudem einmal mehr meine Befürchtung, dass die Zunft der Filmkritik schlichtweg am degenerieren ist (einmal mehr die Hoffnung, hier möge mal irgendwas Großes geschehen, eine neue Bewegung, irgendwas.). [imdb]
Harmlose, nette Unterhaltung, nett gemacht, noch netter gemeint und gerne mag man während der Sichtung Kuchen essen. Die Grandezza, die ich bei Trickfilmen aber immer noch gerne als Bonbon dabei haben möchte, das Spektakuläre, das Glitzernde also, fehlt ihm jedoch nahezu völlig. [imdb]
Kafka (Steven Soderbergh, USA 1991)
Letzten Endes traurig ist an diesem rein optisch sicher reizendem Film, dass man immer wieder meint, das Meisterwerk, das er durchaus sein könnte, durchblitzen sehen zu können, doch zu seinem Recht kommt es nie. Die Ambitionen werden einem daumendick aufs Butterbrot geschmiert - der Arzt heißt Dr. Murnau, gesucht werden die Orlac-Akten, später wird man bunt wie ein Hammer-Film und Allgemeinwissensanekdoten um die Persona Kafka werden so dick wie Taue eingefädelt - , allein, sie finden keine wirkliche Entsprechung im Werk insgesamt. Diese Aussichten auf das Große, was hier versucht werden wollte, sind es aber nun, die den Film insgesamt nicht als groß erscheinen lassen wollen. Wirklich schade: Kein Soderbergh, der zu Unrecht von der Kritik verrissen wurde und den es nun wiederzuentdecken gilt. [imdb]
Kronos (Kurt Neumann, USA 1957)
Nur halbherzig mitverfolgt, deswegen kaum verbindliche Äußerungen möglich. Erschien mir allerdings als etwas schwach auf der Brust, das erhoffte, durchgeknallte Drive-In-Erlebnis, wie man es von Sci-Fi-Knallern jener Tage durchaus erwarten darf (vgl. zum Beispiel den prima Earth vs. The Spider, der hier im "Blog des Grauens" adäquat gewürdigt wird), wird hier nur bedingt geboten. Etwas irritiert hat mich, dass einige Szenen irgendwie an Star Wars erinnerten, z.B. einige Anflugszenen auf den Weltallgiganten in der Wüstenei, gefilmt aus dem Innern des Militärflugzeugs heraus, das wirkte so ein bisschen wie die Schlacht um Hoth. [imdb]
The Incredibles (Brad Bird, USA 2004)
Ein großartiger Film, den es in Zukunft vielleicht sogar als Wendepunkt der computeranimierten Filmtradition zu betrachten gilt. Weg vom Kinder-Trulala, bei dem sich die Erwachsenen an technischen Gimmicks bloßer Machbarkeit erfreuen können, hin zur mitreißenden Story und einem Was der Ausstattung ("Kuck mal, die 60s-Möbel!") im Gegensatz zu deren vorherigem Wie ("Kuck mal, wie toll die das Wasser bei Findet Nemo animiert haben!"). Darüber hinaus auch ein spannender Kommentar zum Verhältnis von Superhelden (in deren goldenem Jahrzehnt, den 40ern, der Film beginnt) zu Superagenten wie James Bond (in dessen goldenem Jahrzehnt, den 60ern, der Film seinen weiteren Verlauf nimmt). Im Verein mit Shrek 2 und dem furiosen Sky Captain ist The Incredibles ein Indiz dafür, dass sich im Computerbereich einiges tut, was in Zukunft weiterzuverfolgen sich als spannend erweisen wird. [imdb]
Alexander (Oliver Stone, USA 2004)
Das weitgehend vernichtende Urteil der Kritik wird sich, so hoffe ich, in Zukunft als unberechtigt erweisen. "Langweilig" sei der Film, so konnte man es gemeinhin vernehmen. Natürlich ist er das, wenn man den Monumentalfilm nur als Vehikel für monumentale Bilder und Spektakel anzusehen bereit ist: Hier ist Alexander in der Tat nicht sonderlich ergiebig. Spannend wird es aber, wenn die eher essayistische Filmform Oliver Stones sich dieser Form annimmt und über den Genrekontext hinausweisende Fragen verhandelt. Das Ergebnis ist nichts, was sich didaktisch übernehmen ließe, aber eben doch interessant und wirft, im besten Sinne verstanden, Gedanken auf, die man nach dem Kinobesuch lange weiterspinnen kann. Deshalb betrachte ich Alexander eher als eine Art Gesprächsangebot (und in der Tat war Stones Film einer der wenigen dieses Jahres, wo ich andauernd reflektierte, weitere Schritte erahnen und das Geschehen verstehen wollte, kurzum: in mir mit dem Film über ihn diskutierte), als, natürlich, eine Kontroverse, für die Stone bekannt ist, doch entfaltet sie sich jenseits des Kinosaals vielleicht nur deshalb weniger als zu früheren Zeiten Stones, weil der Gegenstand erstem Augenschein nach nicht von Aktualitäten oder zumindest historisch nahen Bezügen gekennzeichnet ist. Schwer ist es, ein eindeutiges Urteil zu fällen. Ist der Film gut? Schlecht? Ich denke, die Knappheit solcher Floskeln wird den verschiedenen Inhalten des Films (und den verschiedenen möglichen Konzepten, ihm zu begegnen) nicht gerecht, weswegen ich hier auch ganz bewusst platzmangelshalber keine Gedankenoffenlegung betreiben möchte. Ganz grundsätzlich aber: Ein spannendes, anregendes Kinoerlebnis. Empfehlungsjournalismus, der ganz auf Tagesaktualitäten ausgerichtet ist, muss an dem Film vermutlich schon formhalber scheitern.
Nachtrag: Nachdem ich nun mal kreuz und quer Kritiken unterschiedlichster Herkunft und Ausrichtung gelesen habe, erscheint es mir bemerkenswert, mit welch kleinlicher Lust, die nicht selten zum Hysterischen neigt, der Film niederzureden versucht wird. Geradewegs so, als müsse man ihn sich vom Leibe halten, koste es, was es wolle. Nun hätte ich gegen einen argumentierten Verriss nicht das Geringste einzuwenden, aber was hier zum Teil für Armutszeugnisse abgeliefert werden, diskreditiert manch Website und Printperiodikum und nährt zudem einmal mehr meine Befürchtung, dass die Zunft der Filmkritik schlichtweg am degenerieren ist (einmal mehr die Hoffnung, hier möge mal irgendwas Großes geschehen, eine neue Bewegung, irgendwas.). [imdb]
° ° °
lol