Thema: Filmtagebuch
15.06.2004, Ufa Palast Kosmos
 Will vermutlich keiner glauben, aber: Ich halte The Day After Tomorrow für einen guten Film. Nicht weil ihm, wie viele Kritiker nun hämisch unken, der Emmerich-übliche patriotische Pathos fehlt - mit dem habe ich, in diesem Bedeutungssystem, nur wenig Probleme -, sondern weil er, in der Tat, erfrischend melancholisch und auf angenehme Art und Weise gegen den Strich seines Genres gebürstet ist: Wechselt der Film zu Beginn für eine Episode nach Japan, konzentriert sich die Kamera dort auf eine telefonierende Person, wähnt man noch, das bekannte Muster, das viele einzelne, räumlich voneinander getrennte Erzählfäden im Verlauf zusammenbringt, erkannt zu haben. Doch nichts dergleichen: Die vorgeschlagene Bedeutungsperson wird schnell erschlagen, von einem faustgroßen Hagelnugget. Erstaunlich auch, wie schnell der Film sein sensationalistisches Pulver verschießt, wie schon bald zu Beginn eine Lokalität nach der anderen mit viel audio-visuellen Getöse - jener Sorte, die zu gefallen weiß, letztlich befinden wir uns eben doch in einem Exploitation-Movie - zunichte gemacht wird und wie dann damit begonnen wird, ins Detail zu gehen, die Widrigkeiten der Einzelnen abzuhaken, ohne dabei auf die "finale Schlacht" oder ähnlich Heroisches hinzuarbeiten. Am Ende nur altbekanntes, in diesem Zusammenhang jedoch erfrischendes persönliches Drama, das von der Überwindung von Schwächen und alten Fehlern erzählt. Das dabei das Schicksal jener zuvor lang vorgestellten Wetterbasis in Schottland, die, wie wir per Funk erfahren, dem Untergang geweiht ist, komplett ausgeblendet, ja nachgerade vergessen wird, stört dabei kaum, es fällt schon gar nicht mehr auf. Auch anderes geht im Schnitt zwischen zwei Sequenzen verloren: Hier verlässt der Präsident noch das Weiße Haus, im nächsten Moment bezeichnet ihn eine Mitteilung - per Funk, von einem Soldaten aber mündlich weitergegeben, Mauerschau allenorten - schon als tot: Die Auflösung der Zivilisation, die hier zelebriert wird, findet in der Auflösung des Erzählsystems Entsprechung, lässt aber lange nicht jegliche Hoffnung fahren: Die letzten Bilder, wenngleich pathetisch, so doch melancholisch, gebrochen, anti-heroisch, bieten noch immer genügend Optionen für die Personen darin, für das Szenario selbst, für das zugrundeliegende Genre, das hier zum Teil empfindlich angeknackst, nicht aber vollends dekonstruiert wird. Die Frage, was nach diesem Genrebeitrag noch zu kommen vermag, wo der doch alle Genreszenarien in sich vereint und im Zuge die halbe Welt zerstört und, aus Menschenlebenperspektive, ewig unter Eis verpackt, ist dennoch berechtigt.
Will vermutlich keiner glauben, aber: Ich halte The Day After Tomorrow für einen guten Film. Nicht weil ihm, wie viele Kritiker nun hämisch unken, der Emmerich-übliche patriotische Pathos fehlt - mit dem habe ich, in diesem Bedeutungssystem, nur wenig Probleme -, sondern weil er, in der Tat, erfrischend melancholisch und auf angenehme Art und Weise gegen den Strich seines Genres gebürstet ist: Wechselt der Film zu Beginn für eine Episode nach Japan, konzentriert sich die Kamera dort auf eine telefonierende Person, wähnt man noch, das bekannte Muster, das viele einzelne, räumlich voneinander getrennte Erzählfäden im Verlauf zusammenbringt, erkannt zu haben. Doch nichts dergleichen: Die vorgeschlagene Bedeutungsperson wird schnell erschlagen, von einem faustgroßen Hagelnugget. Erstaunlich auch, wie schnell der Film sein sensationalistisches Pulver verschießt, wie schon bald zu Beginn eine Lokalität nach der anderen mit viel audio-visuellen Getöse - jener Sorte, die zu gefallen weiß, letztlich befinden wir uns eben doch in einem Exploitation-Movie - zunichte gemacht wird und wie dann damit begonnen wird, ins Detail zu gehen, die Widrigkeiten der Einzelnen abzuhaken, ohne dabei auf die "finale Schlacht" oder ähnlich Heroisches hinzuarbeiten. Am Ende nur altbekanntes, in diesem Zusammenhang jedoch erfrischendes persönliches Drama, das von der Überwindung von Schwächen und alten Fehlern erzählt. Das dabei das Schicksal jener zuvor lang vorgestellten Wetterbasis in Schottland, die, wie wir per Funk erfahren, dem Untergang geweiht ist, komplett ausgeblendet, ja nachgerade vergessen wird, stört dabei kaum, es fällt schon gar nicht mehr auf. Auch anderes geht im Schnitt zwischen zwei Sequenzen verloren: Hier verlässt der Präsident noch das Weiße Haus, im nächsten Moment bezeichnet ihn eine Mitteilung - per Funk, von einem Soldaten aber mündlich weitergegeben, Mauerschau allenorten - schon als tot: Die Auflösung der Zivilisation, die hier zelebriert wird, findet in der Auflösung des Erzählsystems Entsprechung, lässt aber lange nicht jegliche Hoffnung fahren: Die letzten Bilder, wenngleich pathetisch, so doch melancholisch, gebrochen, anti-heroisch, bieten noch immer genügend Optionen für die Personen darin, für das Szenario selbst, für das zugrundeliegende Genre, das hier zum Teil empfindlich angeknackst, nicht aber vollends dekonstruiert wird. Die Frage, was nach diesem Genrebeitrag noch zu kommen vermag, wo der doch alle Genreszenarien in sich vereint und im Zuge die halbe Welt zerstört und, aus Menschenlebenperspektive, ewig unter Eis verpackt, ist dennoch berechtigt.
 Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Die Gutenberg-Bibel überlebt, wie beiläufig sehen wir sie am Ende im Arm eines Überlebenden, der zuvor angekündigt hat, sie mit seinem Leben zu beschützen: Dort, in der New Yorker Stadtbibliothek, diesem Archiv des Wissens und der Kultur, als die bittere Entscheidung getroffen wird, sich mit brennenden Büchern zu wärmen. Sicherlich eine der stärksten Momente des Films: Wie sich da zwei Liebende endlich finden, in goldenes Licht getaucht, wie sie vor dem buchstäblichen Niedergang der Kulutr und ihres Wissens Hoffnung fassen können. Ein brutales, brutalstes Bild eigentlich: Wie sich zwei küssen, wie das schön aussieht, wie der Preis dieser Schönheit - der Verlust des eigenen Kulturarsenals - in ihr unübersehbar eingeschrieben ist. Und wie Emmerich es, nachdem er vor Jahren das Weiße Haus zerstört und hier den Präsidenten der USA in den Tod geschickt hat, es letztlich nicht wagt, die Gutenberg-Bibel den Flammen preis zu geben. Diese ist nicht austauschbar, die Menschen in dieser Erzählung sind - bewusst? selten waren Blockbuster-Figuren so leer, so stereotyp unaufregend - es allemal. Das ist perfide, gewiss, aber wirkungsvoll.
Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Die Gutenberg-Bibel überlebt, wie beiläufig sehen wir sie am Ende im Arm eines Überlebenden, der zuvor angekündigt hat, sie mit seinem Leben zu beschützen: Dort, in der New Yorker Stadtbibliothek, diesem Archiv des Wissens und der Kultur, als die bittere Entscheidung getroffen wird, sich mit brennenden Büchern zu wärmen. Sicherlich eine der stärksten Momente des Films: Wie sich da zwei Liebende endlich finden, in goldenes Licht getaucht, wie sie vor dem buchstäblichen Niedergang der Kulutr und ihres Wissens Hoffnung fassen können. Ein brutales, brutalstes Bild eigentlich: Wie sich zwei küssen, wie das schön aussieht, wie der Preis dieser Schönheit - der Verlust des eigenen Kulturarsenals - in ihr unübersehbar eingeschrieben ist. Und wie Emmerich es, nachdem er vor Jahren das Weiße Haus zerstört und hier den Präsidenten der USA in den Tod geschickt hat, es letztlich nicht wagt, die Gutenberg-Bibel den Flammen preis zu geben. Diese ist nicht austauschbar, die Menschen in dieser Erzählung sind - bewusst? selten waren Blockbuster-Figuren so leer, so stereotyp unaufregend - es allemal. Das ist perfide, gewiss, aber wirkungsvoll.
 Der Film beginnt bereits tiefmelancholisch, mit einem zur Erde geneigten Blick ins Wasser, kein establishing shot, kein Blick in den Himmel. Wasser. Eissschollen. Eine lange Kamerafahrt, die nur selten den Blick in den wundervollen Himmel darüber wagt, meist gleich schon wieder hinunterblickt, über Eisinseln fliegt, um dann allmählich einen Bezugspunkt zu gewähren, der die Größenverhältnisse verdeutlicht: Weit hinten ein kleiner dunkler Fleck, der sich als Expedition zu erkennen gibt, der nur allmählich wächst und beinahe schon nicht mehr von der Kamera anvisiert wird, als diese schließlich den Bogen macht, diese Expedition umkreist, sie aber nur beiläufig anblickt, als wäre sie ein magnetisches Feld im Bild, das nicht stark genug ist, die Perspektive vollends zu verschieben, aber auch nicht schwach genug, um den Kader zu belassen. Hier simuliert sich die Bewegung eines Hurrikans, die Perspektive der Natur auf die Menschen, in dem Verdruss liegt, letztlich aber auch Hoffnung. Ein melancholischer Blick, der sich durch das Gewitter, durch das Drama, durch die Katharsis zieht. Ein angenehmer Film.
Der Film beginnt bereits tiefmelancholisch, mit einem zur Erde geneigten Blick ins Wasser, kein establishing shot, kein Blick in den Himmel. Wasser. Eissschollen. Eine lange Kamerafahrt, die nur selten den Blick in den wundervollen Himmel darüber wagt, meist gleich schon wieder hinunterblickt, über Eisinseln fliegt, um dann allmählich einen Bezugspunkt zu gewähren, der die Größenverhältnisse verdeutlicht: Weit hinten ein kleiner dunkler Fleck, der sich als Expedition zu erkennen gibt, der nur allmählich wächst und beinahe schon nicht mehr von der Kamera anvisiert wird, als diese schließlich den Bogen macht, diese Expedition umkreist, sie aber nur beiläufig anblickt, als wäre sie ein magnetisches Feld im Bild, das nicht stark genug ist, die Perspektive vollends zu verschieben, aber auch nicht schwach genug, um den Kader zu belassen. Hier simuliert sich die Bewegung eines Hurrikans, die Perspektive der Natur auf die Menschen, in dem Verdruss liegt, letztlich aber auch Hoffnung. Ein melancholischer Blick, der sich durch das Gewitter, durch das Drama, durch die Katharsis zieht. Ein angenehmer Film.
imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de
 Will vermutlich keiner glauben, aber: Ich halte The Day After Tomorrow für einen guten Film. Nicht weil ihm, wie viele Kritiker nun hämisch unken, der Emmerich-übliche patriotische Pathos fehlt - mit dem habe ich, in diesem Bedeutungssystem, nur wenig Probleme -, sondern weil er, in der Tat, erfrischend melancholisch und auf angenehme Art und Weise gegen den Strich seines Genres gebürstet ist: Wechselt der Film zu Beginn für eine Episode nach Japan, konzentriert sich die Kamera dort auf eine telefonierende Person, wähnt man noch, das bekannte Muster, das viele einzelne, räumlich voneinander getrennte Erzählfäden im Verlauf zusammenbringt, erkannt zu haben. Doch nichts dergleichen: Die vorgeschlagene Bedeutungsperson wird schnell erschlagen, von einem faustgroßen Hagelnugget. Erstaunlich auch, wie schnell der Film sein sensationalistisches Pulver verschießt, wie schon bald zu Beginn eine Lokalität nach der anderen mit viel audio-visuellen Getöse - jener Sorte, die zu gefallen weiß, letztlich befinden wir uns eben doch in einem Exploitation-Movie - zunichte gemacht wird und wie dann damit begonnen wird, ins Detail zu gehen, die Widrigkeiten der Einzelnen abzuhaken, ohne dabei auf die "finale Schlacht" oder ähnlich Heroisches hinzuarbeiten. Am Ende nur altbekanntes, in diesem Zusammenhang jedoch erfrischendes persönliches Drama, das von der Überwindung von Schwächen und alten Fehlern erzählt. Das dabei das Schicksal jener zuvor lang vorgestellten Wetterbasis in Schottland, die, wie wir per Funk erfahren, dem Untergang geweiht ist, komplett ausgeblendet, ja nachgerade vergessen wird, stört dabei kaum, es fällt schon gar nicht mehr auf. Auch anderes geht im Schnitt zwischen zwei Sequenzen verloren: Hier verlässt der Präsident noch das Weiße Haus, im nächsten Moment bezeichnet ihn eine Mitteilung - per Funk, von einem Soldaten aber mündlich weitergegeben, Mauerschau allenorten - schon als tot: Die Auflösung der Zivilisation, die hier zelebriert wird, findet in der Auflösung des Erzählsystems Entsprechung, lässt aber lange nicht jegliche Hoffnung fahren: Die letzten Bilder, wenngleich pathetisch, so doch melancholisch, gebrochen, anti-heroisch, bieten noch immer genügend Optionen für die Personen darin, für das Szenario selbst, für das zugrundeliegende Genre, das hier zum Teil empfindlich angeknackst, nicht aber vollends dekonstruiert wird. Die Frage, was nach diesem Genrebeitrag noch zu kommen vermag, wo der doch alle Genreszenarien in sich vereint und im Zuge die halbe Welt zerstört und, aus Menschenlebenperspektive, ewig unter Eis verpackt, ist dennoch berechtigt.
Will vermutlich keiner glauben, aber: Ich halte The Day After Tomorrow für einen guten Film. Nicht weil ihm, wie viele Kritiker nun hämisch unken, der Emmerich-übliche patriotische Pathos fehlt - mit dem habe ich, in diesem Bedeutungssystem, nur wenig Probleme -, sondern weil er, in der Tat, erfrischend melancholisch und auf angenehme Art und Weise gegen den Strich seines Genres gebürstet ist: Wechselt der Film zu Beginn für eine Episode nach Japan, konzentriert sich die Kamera dort auf eine telefonierende Person, wähnt man noch, das bekannte Muster, das viele einzelne, räumlich voneinander getrennte Erzählfäden im Verlauf zusammenbringt, erkannt zu haben. Doch nichts dergleichen: Die vorgeschlagene Bedeutungsperson wird schnell erschlagen, von einem faustgroßen Hagelnugget. Erstaunlich auch, wie schnell der Film sein sensationalistisches Pulver verschießt, wie schon bald zu Beginn eine Lokalität nach der anderen mit viel audio-visuellen Getöse - jener Sorte, die zu gefallen weiß, letztlich befinden wir uns eben doch in einem Exploitation-Movie - zunichte gemacht wird und wie dann damit begonnen wird, ins Detail zu gehen, die Widrigkeiten der Einzelnen abzuhaken, ohne dabei auf die "finale Schlacht" oder ähnlich Heroisches hinzuarbeiten. Am Ende nur altbekanntes, in diesem Zusammenhang jedoch erfrischendes persönliches Drama, das von der Überwindung von Schwächen und alten Fehlern erzählt. Das dabei das Schicksal jener zuvor lang vorgestellten Wetterbasis in Schottland, die, wie wir per Funk erfahren, dem Untergang geweiht ist, komplett ausgeblendet, ja nachgerade vergessen wird, stört dabei kaum, es fällt schon gar nicht mehr auf. Auch anderes geht im Schnitt zwischen zwei Sequenzen verloren: Hier verlässt der Präsident noch das Weiße Haus, im nächsten Moment bezeichnet ihn eine Mitteilung - per Funk, von einem Soldaten aber mündlich weitergegeben, Mauerschau allenorten - schon als tot: Die Auflösung der Zivilisation, die hier zelebriert wird, findet in der Auflösung des Erzählsystems Entsprechung, lässt aber lange nicht jegliche Hoffnung fahren: Die letzten Bilder, wenngleich pathetisch, so doch melancholisch, gebrochen, anti-heroisch, bieten noch immer genügend Optionen für die Personen darin, für das Szenario selbst, für das zugrundeliegende Genre, das hier zum Teil empfindlich angeknackst, nicht aber vollends dekonstruiert wird. Die Frage, was nach diesem Genrebeitrag noch zu kommen vermag, wo der doch alle Genreszenarien in sich vereint und im Zuge die halbe Welt zerstört und, aus Menschenlebenperspektive, ewig unter Eis verpackt, ist dennoch berechtigt. Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Die Gutenberg-Bibel überlebt, wie beiläufig sehen wir sie am Ende im Arm eines Überlebenden, der zuvor angekündigt hat, sie mit seinem Leben zu beschützen: Dort, in der New Yorker Stadtbibliothek, diesem Archiv des Wissens und der Kultur, als die bittere Entscheidung getroffen wird, sich mit brennenden Büchern zu wärmen. Sicherlich eine der stärksten Momente des Films: Wie sich da zwei Liebende endlich finden, in goldenes Licht getaucht, wie sie vor dem buchstäblichen Niedergang der Kulutr und ihres Wissens Hoffnung fassen können. Ein brutales, brutalstes Bild eigentlich: Wie sich zwei küssen, wie das schön aussieht, wie der Preis dieser Schönheit - der Verlust des eigenen Kulturarsenals - in ihr unübersehbar eingeschrieben ist. Und wie Emmerich es, nachdem er vor Jahren das Weiße Haus zerstört und hier den Präsidenten der USA in den Tod geschickt hat, es letztlich nicht wagt, die Gutenberg-Bibel den Flammen preis zu geben. Diese ist nicht austauschbar, die Menschen in dieser Erzählung sind - bewusst? selten waren Blockbuster-Figuren so leer, so stereotyp unaufregend - es allemal. Das ist perfide, gewiss, aber wirkungsvoll.
Ein weiterer Hoffnungsschimmer: Die Gutenberg-Bibel überlebt, wie beiläufig sehen wir sie am Ende im Arm eines Überlebenden, der zuvor angekündigt hat, sie mit seinem Leben zu beschützen: Dort, in der New Yorker Stadtbibliothek, diesem Archiv des Wissens und der Kultur, als die bittere Entscheidung getroffen wird, sich mit brennenden Büchern zu wärmen. Sicherlich eine der stärksten Momente des Films: Wie sich da zwei Liebende endlich finden, in goldenes Licht getaucht, wie sie vor dem buchstäblichen Niedergang der Kulutr und ihres Wissens Hoffnung fassen können. Ein brutales, brutalstes Bild eigentlich: Wie sich zwei küssen, wie das schön aussieht, wie der Preis dieser Schönheit - der Verlust des eigenen Kulturarsenals - in ihr unübersehbar eingeschrieben ist. Und wie Emmerich es, nachdem er vor Jahren das Weiße Haus zerstört und hier den Präsidenten der USA in den Tod geschickt hat, es letztlich nicht wagt, die Gutenberg-Bibel den Flammen preis zu geben. Diese ist nicht austauschbar, die Menschen in dieser Erzählung sind - bewusst? selten waren Blockbuster-Figuren so leer, so stereotyp unaufregend - es allemal. Das ist perfide, gewiss, aber wirkungsvoll. Der Film beginnt bereits tiefmelancholisch, mit einem zur Erde geneigten Blick ins Wasser, kein establishing shot, kein Blick in den Himmel. Wasser. Eissschollen. Eine lange Kamerafahrt, die nur selten den Blick in den wundervollen Himmel darüber wagt, meist gleich schon wieder hinunterblickt, über Eisinseln fliegt, um dann allmählich einen Bezugspunkt zu gewähren, der die Größenverhältnisse verdeutlicht: Weit hinten ein kleiner dunkler Fleck, der sich als Expedition zu erkennen gibt, der nur allmählich wächst und beinahe schon nicht mehr von der Kamera anvisiert wird, als diese schließlich den Bogen macht, diese Expedition umkreist, sie aber nur beiläufig anblickt, als wäre sie ein magnetisches Feld im Bild, das nicht stark genug ist, die Perspektive vollends zu verschieben, aber auch nicht schwach genug, um den Kader zu belassen. Hier simuliert sich die Bewegung eines Hurrikans, die Perspektive der Natur auf die Menschen, in dem Verdruss liegt, letztlich aber auch Hoffnung. Ein melancholischer Blick, der sich durch das Gewitter, durch das Drama, durch die Katharsis zieht. Ein angenehmer Film.
Der Film beginnt bereits tiefmelancholisch, mit einem zur Erde geneigten Blick ins Wasser, kein establishing shot, kein Blick in den Himmel. Wasser. Eissschollen. Eine lange Kamerafahrt, die nur selten den Blick in den wundervollen Himmel darüber wagt, meist gleich schon wieder hinunterblickt, über Eisinseln fliegt, um dann allmählich einen Bezugspunkt zu gewähren, der die Größenverhältnisse verdeutlicht: Weit hinten ein kleiner dunkler Fleck, der sich als Expedition zu erkennen gibt, der nur allmählich wächst und beinahe schon nicht mehr von der Kamera anvisiert wird, als diese schließlich den Bogen macht, diese Expedition umkreist, sie aber nur beiläufig anblickt, als wäre sie ein magnetisches Feld im Bild, das nicht stark genug ist, die Perspektive vollends zu verschieben, aber auch nicht schwach genug, um den Kader zu belassen. Hier simuliert sich die Bewegung eines Hurrikans, die Perspektive der Natur auf die Menschen, in dem Verdruss liegt, letztlich aber auch Hoffnung. Ein melancholischer Blick, der sich durch das Gewitter, durch das Drama, durch die Katharsis zieht. Ein angenehmer Film.imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
12. Juni 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
11.06.2004, Heimkino
Wenngleich, was die CGI betrifft, noch einige Schulklassen hinter den Elaboraten us-amerikanischer Cyberschmieden, bietet Returner ein handwerklich routiniert vorgetragenes Sci-Fi-Spektakelchen. Es geht um eine Art Inversion des Terminator-Grundgedankens: Kurz bevor im Jahr 2082 die Menschheit die ihr Schicksal besiegelnde Niederlage gegen eine außerirdische Invasion erleidet, stürzt sich die junge Milly in eine noch nicht erprobte Zeitmaschine, um 80 Jahre früher die Ankunft des ersten Aliens und somit die folgende Invasion zu unterbinden. Natürlich trifft sie mit Miyamoto bald auf einen Jüngling, der selbst wiederum einen besonders oberfiesen Gangster Mizoguchi nach dem Leben trachtet und, nach einigem Hin und Her, ihr Gefährte wird. Das Drehbuch will es zudem, dass beider Missionen letztlich zusammenfallen: Im apokalyptischen Invasions-Eiertanz nimmt Mizoguchi eine ganz besondere Rolle ein.
 Natürlich geht das Ganze, wie es sich für ein B-Movie gehört, nicht ohne Zitationen über die Bühne: Wer in den letzten fünf bis zehn Jahren das Sci-Fi-Genre nicht vollends aus seiner Wahrnehmung usgeblendet hat, dem wird das eine oder andere sicher bekannt vorkommen. Die Bullet-Time-Effekte beispielsweise, die aber immerhin narrativ begründet sind: Eine Art DigiCam mit Armbanduhr-Komfort ermöglicht es ihrem Träger, sich mit 20facher Geschwindigkeit zu bewegen, um so etwa Kugeln auszuweichen oder brenzligen Situationen zu entfliehen. Damit hat Milly natürlich alle Asse im Ärmel und erscheint in der Gegenwart als eigentlich unbesiegbar (mit absehbaren Folgen für den Spannungsbogen): Dass aus dem Gimmick dabei letztlich kein dramaturgischer Gewinn geschlagen wird (etwa dadurch, dass besonders viele brenzlige Situationen etabliert werden, oder dadurch, dass die DigiCam-Uhr-Beschleunigungsmaschine in Feindeshand gerät), fällt schon bald auf. Im wesentlichen ist das eine tolle Freikarte für das weitgehend naive Drehbuch, die vor komplizierteren Entwürfen schützt (und natürlich viele Bullet-Times garantiert). Auch eine Wunderbombe, die sich dem Feind wie ein Pflaster anheften lässt und mit der Milly Miyamoto zunächst zur Mitarbeit erpresst, kann offenbar alles, so dass man sich zum einen wundert, wie die Außerirdischen der Zukunft überhaupt so weit kommen konnten, und sich zum anderen fragt, warum der Film bei einer solchen Ausstattung fast zwei Stunden dauert. Auch hier: Schwaches Drehbuch, Marke "sich besonders leicht gemacht" (wobei fairerweise... aber nun gut, das verrate ich nicht, ist eh egal).
Natürlich geht das Ganze, wie es sich für ein B-Movie gehört, nicht ohne Zitationen über die Bühne: Wer in den letzten fünf bis zehn Jahren das Sci-Fi-Genre nicht vollends aus seiner Wahrnehmung usgeblendet hat, dem wird das eine oder andere sicher bekannt vorkommen. Die Bullet-Time-Effekte beispielsweise, die aber immerhin narrativ begründet sind: Eine Art DigiCam mit Armbanduhr-Komfort ermöglicht es ihrem Träger, sich mit 20facher Geschwindigkeit zu bewegen, um so etwa Kugeln auszuweichen oder brenzligen Situationen zu entfliehen. Damit hat Milly natürlich alle Asse im Ärmel und erscheint in der Gegenwart als eigentlich unbesiegbar (mit absehbaren Folgen für den Spannungsbogen): Dass aus dem Gimmick dabei letztlich kein dramaturgischer Gewinn geschlagen wird (etwa dadurch, dass besonders viele brenzlige Situationen etabliert werden, oder dadurch, dass die DigiCam-Uhr-Beschleunigungsmaschine in Feindeshand gerät), fällt schon bald auf. Im wesentlichen ist das eine tolle Freikarte für das weitgehend naive Drehbuch, die vor komplizierteren Entwürfen schützt (und natürlich viele Bullet-Times garantiert). Auch eine Wunderbombe, die sich dem Feind wie ein Pflaster anheften lässt und mit der Milly Miyamoto zunächst zur Mitarbeit erpresst, kann offenbar alles, so dass man sich zum einen wundert, wie die Außerirdischen der Zukunft überhaupt so weit kommen konnten, und sich zum anderen fragt, warum der Film bei einer solchen Ausstattung fast zwei Stunden dauert. Auch hier: Schwaches Drehbuch, Marke "sich besonders leicht gemacht" (wobei fairerweise... aber nun gut, das verrate ich nicht, ist eh egal).
Auch bleibt der Film merkwürdig brav verschämt. So eine Art Action-Knaller-Film, der nett bleibt und allerlei Wundertüten aufreißt. Was an sich ein gut abgehangener Reißer hätte werden können, wird hier schnell zum illustrierten Jugendroman, in dem eine kleine Gruppe Kiddies gegen böse Böse kämpft und mit Schläue und Durchsetzungsziel zum Ziel kommt. TKKG meets Matrix, wenn man's mal krass ausdrücken möchte. Dramaturgie und charakterliche Gestaltung nähern sich erstgenanntem Jugendzimmerphänomen jedenfalls zuweilen bedenklich an.Das ist zwar irgendwie nett gemeint, geht aber schon deshalb nicht auf, weil der Film eine Viertelstunde vor seinem Ende schon zuende ist, dann aber noch die restliche Spielzeit mit Anhäufung von Nettigkeiten beschäftigt ist. Alles nett, so nett nett nett. Aber Himmel, wenn ich Nettigkeiten sehen will, schaue ich keinen Actionfilm vor Sci-Fi-Kulisse an.
Ernsthaft stellt sich die Frage, wer das denn eigentlich sehen soll. Kiddies scheiden wegen der teils recht expliziten Gewalt vor allem zu Beginn, während der Alieninvasion, aus. Alle anderen kucken vermutlich den real shit, sofern sie das Genre interessiert, und nicht dessen Aufguss unter zweifelhaftem Vorzeichen. Vielleicht ja Menschen mit Aversion gegen Actionfilme und dem darin oft zelebrierten Zynismus? Könnte sein, macht aber eigentlich auch kaum Sinn. Das macht den Film eigentlich schon wieder so sperrig, dass er einem glatt sympathisch sein könnte. Betonung auf letztem Wort.
imdb | mrqe
Wenngleich, was die CGI betrifft, noch einige Schulklassen hinter den Elaboraten us-amerikanischer Cyberschmieden, bietet Returner ein handwerklich routiniert vorgetragenes Sci-Fi-Spektakelchen. Es geht um eine Art Inversion des Terminator-Grundgedankens: Kurz bevor im Jahr 2082 die Menschheit die ihr Schicksal besiegelnde Niederlage gegen eine außerirdische Invasion erleidet, stürzt sich die junge Milly in eine noch nicht erprobte Zeitmaschine, um 80 Jahre früher die Ankunft des ersten Aliens und somit die folgende Invasion zu unterbinden. Natürlich trifft sie mit Miyamoto bald auf einen Jüngling, der selbst wiederum einen besonders oberfiesen Gangster Mizoguchi nach dem Leben trachtet und, nach einigem Hin und Her, ihr Gefährte wird. Das Drehbuch will es zudem, dass beider Missionen letztlich zusammenfallen: Im apokalyptischen Invasions-Eiertanz nimmt Mizoguchi eine ganz besondere Rolle ein.
 Natürlich geht das Ganze, wie es sich für ein B-Movie gehört, nicht ohne Zitationen über die Bühne: Wer in den letzten fünf bis zehn Jahren das Sci-Fi-Genre nicht vollends aus seiner Wahrnehmung usgeblendet hat, dem wird das eine oder andere sicher bekannt vorkommen. Die Bullet-Time-Effekte beispielsweise, die aber immerhin narrativ begründet sind: Eine Art DigiCam mit Armbanduhr-Komfort ermöglicht es ihrem Träger, sich mit 20facher Geschwindigkeit zu bewegen, um so etwa Kugeln auszuweichen oder brenzligen Situationen zu entfliehen. Damit hat Milly natürlich alle Asse im Ärmel und erscheint in der Gegenwart als eigentlich unbesiegbar (mit absehbaren Folgen für den Spannungsbogen): Dass aus dem Gimmick dabei letztlich kein dramaturgischer Gewinn geschlagen wird (etwa dadurch, dass besonders viele brenzlige Situationen etabliert werden, oder dadurch, dass die DigiCam-Uhr-Beschleunigungsmaschine in Feindeshand gerät), fällt schon bald auf. Im wesentlichen ist das eine tolle Freikarte für das weitgehend naive Drehbuch, die vor komplizierteren Entwürfen schützt (und natürlich viele Bullet-Times garantiert). Auch eine Wunderbombe, die sich dem Feind wie ein Pflaster anheften lässt und mit der Milly Miyamoto zunächst zur Mitarbeit erpresst, kann offenbar alles, so dass man sich zum einen wundert, wie die Außerirdischen der Zukunft überhaupt so weit kommen konnten, und sich zum anderen fragt, warum der Film bei einer solchen Ausstattung fast zwei Stunden dauert. Auch hier: Schwaches Drehbuch, Marke "sich besonders leicht gemacht" (wobei fairerweise... aber nun gut, das verrate ich nicht, ist eh egal).
Natürlich geht das Ganze, wie es sich für ein B-Movie gehört, nicht ohne Zitationen über die Bühne: Wer in den letzten fünf bis zehn Jahren das Sci-Fi-Genre nicht vollends aus seiner Wahrnehmung usgeblendet hat, dem wird das eine oder andere sicher bekannt vorkommen. Die Bullet-Time-Effekte beispielsweise, die aber immerhin narrativ begründet sind: Eine Art DigiCam mit Armbanduhr-Komfort ermöglicht es ihrem Träger, sich mit 20facher Geschwindigkeit zu bewegen, um so etwa Kugeln auszuweichen oder brenzligen Situationen zu entfliehen. Damit hat Milly natürlich alle Asse im Ärmel und erscheint in der Gegenwart als eigentlich unbesiegbar (mit absehbaren Folgen für den Spannungsbogen): Dass aus dem Gimmick dabei letztlich kein dramaturgischer Gewinn geschlagen wird (etwa dadurch, dass besonders viele brenzlige Situationen etabliert werden, oder dadurch, dass die DigiCam-Uhr-Beschleunigungsmaschine in Feindeshand gerät), fällt schon bald auf. Im wesentlichen ist das eine tolle Freikarte für das weitgehend naive Drehbuch, die vor komplizierteren Entwürfen schützt (und natürlich viele Bullet-Times garantiert). Auch eine Wunderbombe, die sich dem Feind wie ein Pflaster anheften lässt und mit der Milly Miyamoto zunächst zur Mitarbeit erpresst, kann offenbar alles, so dass man sich zum einen wundert, wie die Außerirdischen der Zukunft überhaupt so weit kommen konnten, und sich zum anderen fragt, warum der Film bei einer solchen Ausstattung fast zwei Stunden dauert. Auch hier: Schwaches Drehbuch, Marke "sich besonders leicht gemacht" (wobei fairerweise... aber nun gut, das verrate ich nicht, ist eh egal).Auch bleibt der Film merkwürdig brav verschämt. So eine Art Action-Knaller-Film, der nett bleibt und allerlei Wundertüten aufreißt. Was an sich ein gut abgehangener Reißer hätte werden können, wird hier schnell zum illustrierten Jugendroman, in dem eine kleine Gruppe Kiddies gegen böse Böse kämpft und mit Schläue und Durchsetzungsziel zum Ziel kommt. TKKG meets Matrix, wenn man's mal krass ausdrücken möchte. Dramaturgie und charakterliche Gestaltung nähern sich erstgenanntem Jugendzimmerphänomen jedenfalls zuweilen bedenklich an.Das ist zwar irgendwie nett gemeint, geht aber schon deshalb nicht auf, weil der Film eine Viertelstunde vor seinem Ende schon zuende ist, dann aber noch die restliche Spielzeit mit Anhäufung von Nettigkeiten beschäftigt ist. Alles nett, so nett nett nett. Aber Himmel, wenn ich Nettigkeiten sehen will, schaue ich keinen Actionfilm vor Sci-Fi-Kulisse an.
Ernsthaft stellt sich die Frage, wer das denn eigentlich sehen soll. Kiddies scheiden wegen der teils recht expliziten Gewalt vor allem zu Beginn, während der Alieninvasion, aus. Alle anderen kucken vermutlich den real shit, sofern sie das Genre interessiert, und nicht dessen Aufguss unter zweifelhaftem Vorzeichen. Vielleicht ja Menschen mit Aversion gegen Actionfilme und dem darin oft zelebrierten Zynismus? Könnte sein, macht aber eigentlich auch kaum Sinn. Das macht den Film eigentlich schon wieder so sperrig, dass er einem glatt sympathisch sein könnte. Betonung auf letztem Wort.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
schon eine Weile her, Heimkino
Filme, die verkrampft gewollt daherkommen, haben es meist schwer. Undead ist so ein Film, der viel will, sich sehr drum bemüht, und dabei auf ganzer Linie scheitert. Und nervig ist er auch für zwei!
 Undead will cooler Trash sein. Dass ihm dabei das Element des spontan Gescheiterten abhanden kommt und er sich nur ungelenk als Pflichterfüllung zu erkennen gibt, scheint ihn dabei nicht zu kümmern, bildet letztendlich aber die Basis für das eigene, höchst unamüsante Scheitern. Um cooler Trash zu sein, erfindet der Film ein Szenario, in dem sowas gut geht: Irgendwo in der australischen Provinz gehen seltsame Meteoriten nieder, die eine bemerkenswerte Treffsicherheit ausweist: Die zielgenau Niedergestreckten stehen als Zombies wieder auf und machen Jagd auf alle anderen. Die obligatorische Gruppe ist schnell zusammengewürfelt: Kreischende Mädels, ein paar trottelige Bullen finden sich im Anwesen eines vollbärtigen, overall-tragenden Aussie-Rednecks ein, der mit lakonischen Sprüchen zur Lage und einigen artistischen Sperenzchen Marke Hongkong-Heroic-Bloodshed der geekiness den Diener machen soll. Schließlich versteigt man sich dramaturgisch unbeholfen zu einer regelrechten Alieninvasions-Travestie, die so recht nicht zu Potte kommt, vielleicht auch, weil die Aliens Abziehbilder der faden Gutmensch-Alienwesen aus Spielbergs A.I. darstellen. Sie wispern sogar ähnlich sphärisch. Am Ende etwas Zynismus, bis dahin viel Comic-Genrealberei.
Undead will cooler Trash sein. Dass ihm dabei das Element des spontan Gescheiterten abhanden kommt und er sich nur ungelenk als Pflichterfüllung zu erkennen gibt, scheint ihn dabei nicht zu kümmern, bildet letztendlich aber die Basis für das eigene, höchst unamüsante Scheitern. Um cooler Trash zu sein, erfindet der Film ein Szenario, in dem sowas gut geht: Irgendwo in der australischen Provinz gehen seltsame Meteoriten nieder, die eine bemerkenswerte Treffsicherheit ausweist: Die zielgenau Niedergestreckten stehen als Zombies wieder auf und machen Jagd auf alle anderen. Die obligatorische Gruppe ist schnell zusammengewürfelt: Kreischende Mädels, ein paar trottelige Bullen finden sich im Anwesen eines vollbärtigen, overall-tragenden Aussie-Rednecks ein, der mit lakonischen Sprüchen zur Lage und einigen artistischen Sperenzchen Marke Hongkong-Heroic-Bloodshed der geekiness den Diener machen soll. Schließlich versteigt man sich dramaturgisch unbeholfen zu einer regelrechten Alieninvasions-Travestie, die so recht nicht zu Potte kommt, vielleicht auch, weil die Aliens Abziehbilder der faden Gutmensch-Alienwesen aus Spielbergs A.I. darstellen. Sie wispern sogar ähnlich sphärisch. Am Ende etwas Zynismus, bis dahin viel Comic-Genrealberei.
Nichts ist ernstgemeint. Alles ist Referenz, ironisch doppelt und dreifach gebrochen, albern, "einfach zum Totschießen". Und mit ziemlicher Sicherheit ist das auch der Fehler des Films. Peter Jacksons Braindead mag noch eine spaßig-charmante Sauerei gewesen sein, doch gleichzeitig war sie auch der Endpunkt des Tom-und-Jerry-für-Erwachsene-Splatterfilms. Wer das nicht verstanden hat, ist dazu verdammt, sein Publikum anzuöden. Und genau hierfür steht Undead als Zeuge vor Gericht. Undead ist ein Film über einen Film über einen Film über die Leidenschaft seines Machers zu einem Genre oder einer gewissen Art von Film - und jede Kopiegeneration wurde in Longplay erstellt, auf einem Videorekorder der ersten Longplay-Generation. Das Ergebnis ist verrauscht, kaum ansehnlich, leichenblass, unendlich fad.
 Bemerkenswert aber immerhin, wie es Undead gelingt, zu keinem Zeitpunkt soetwas wie Inspiration oder Vision zu entwickeln. Gerade ein solches geekmovie sollte doch dahingehend entsprechend auftreten. möchte man meinen. Doch nichts, wirklich nichts: Ein Kopfüber-Stunt in Zeitlupe mit dabei aus dem Rücken gezogenen Kanonen dient ihm bereits als Lichtpunkt und vermeintlich witzige Zitatenunkerei. Wirkt aber so lieblos wie Klamotten von Lidl. Ein paar coole Sprüche, die wirkungslos verpuffen, machen noch keinen Schenkelklopfer-Film. Die Orientierungslosigkeit, mit der die Macher hier ihre Filmleidenschaft zur Schau stellen, erscheint an manchen Stellen als schier erschreckend: Warum in Gottes Namen hat dieser Film entstehen müssen? Ist denn noch nicht mal mehr auf die Passion der Geeks Verlass? Diese Ratlosigkeit hat eine neue Qualität, die Zeiten eines Typ Regisseurs "Cecil B. Demented", scheint's, vorbei.
Bemerkenswert aber immerhin, wie es Undead gelingt, zu keinem Zeitpunkt soetwas wie Inspiration oder Vision zu entwickeln. Gerade ein solches geekmovie sollte doch dahingehend entsprechend auftreten. möchte man meinen. Doch nichts, wirklich nichts: Ein Kopfüber-Stunt in Zeitlupe mit dabei aus dem Rücken gezogenen Kanonen dient ihm bereits als Lichtpunkt und vermeintlich witzige Zitatenunkerei. Wirkt aber so lieblos wie Klamotten von Lidl. Ein paar coole Sprüche, die wirkungslos verpuffen, machen noch keinen Schenkelklopfer-Film. Die Orientierungslosigkeit, mit der die Macher hier ihre Filmleidenschaft zur Schau stellen, erscheint an manchen Stellen als schier erschreckend: Warum in Gottes Namen hat dieser Film entstehen müssen? Ist denn noch nicht mal mehr auf die Passion der Geeks Verlass? Diese Ratlosigkeit hat eine neue Qualität, die Zeiten eines Typ Regisseurs "Cecil B. Demented", scheint's, vorbei.
imdb | mrqe
Filme, die verkrampft gewollt daherkommen, haben es meist schwer. Undead ist so ein Film, der viel will, sich sehr drum bemüht, und dabei auf ganzer Linie scheitert. Und nervig ist er auch für zwei!
 Undead will cooler Trash sein. Dass ihm dabei das Element des spontan Gescheiterten abhanden kommt und er sich nur ungelenk als Pflichterfüllung zu erkennen gibt, scheint ihn dabei nicht zu kümmern, bildet letztendlich aber die Basis für das eigene, höchst unamüsante Scheitern. Um cooler Trash zu sein, erfindet der Film ein Szenario, in dem sowas gut geht: Irgendwo in der australischen Provinz gehen seltsame Meteoriten nieder, die eine bemerkenswerte Treffsicherheit ausweist: Die zielgenau Niedergestreckten stehen als Zombies wieder auf und machen Jagd auf alle anderen. Die obligatorische Gruppe ist schnell zusammengewürfelt: Kreischende Mädels, ein paar trottelige Bullen finden sich im Anwesen eines vollbärtigen, overall-tragenden Aussie-Rednecks ein, der mit lakonischen Sprüchen zur Lage und einigen artistischen Sperenzchen Marke Hongkong-Heroic-Bloodshed der geekiness den Diener machen soll. Schließlich versteigt man sich dramaturgisch unbeholfen zu einer regelrechten Alieninvasions-Travestie, die so recht nicht zu Potte kommt, vielleicht auch, weil die Aliens Abziehbilder der faden Gutmensch-Alienwesen aus Spielbergs A.I. darstellen. Sie wispern sogar ähnlich sphärisch. Am Ende etwas Zynismus, bis dahin viel Comic-Genrealberei.
Undead will cooler Trash sein. Dass ihm dabei das Element des spontan Gescheiterten abhanden kommt und er sich nur ungelenk als Pflichterfüllung zu erkennen gibt, scheint ihn dabei nicht zu kümmern, bildet letztendlich aber die Basis für das eigene, höchst unamüsante Scheitern. Um cooler Trash zu sein, erfindet der Film ein Szenario, in dem sowas gut geht: Irgendwo in der australischen Provinz gehen seltsame Meteoriten nieder, die eine bemerkenswerte Treffsicherheit ausweist: Die zielgenau Niedergestreckten stehen als Zombies wieder auf und machen Jagd auf alle anderen. Die obligatorische Gruppe ist schnell zusammengewürfelt: Kreischende Mädels, ein paar trottelige Bullen finden sich im Anwesen eines vollbärtigen, overall-tragenden Aussie-Rednecks ein, der mit lakonischen Sprüchen zur Lage und einigen artistischen Sperenzchen Marke Hongkong-Heroic-Bloodshed der geekiness den Diener machen soll. Schließlich versteigt man sich dramaturgisch unbeholfen zu einer regelrechten Alieninvasions-Travestie, die so recht nicht zu Potte kommt, vielleicht auch, weil die Aliens Abziehbilder der faden Gutmensch-Alienwesen aus Spielbergs A.I. darstellen. Sie wispern sogar ähnlich sphärisch. Am Ende etwas Zynismus, bis dahin viel Comic-Genrealberei.Nichts ist ernstgemeint. Alles ist Referenz, ironisch doppelt und dreifach gebrochen, albern, "einfach zum Totschießen". Und mit ziemlicher Sicherheit ist das auch der Fehler des Films. Peter Jacksons Braindead mag noch eine spaßig-charmante Sauerei gewesen sein, doch gleichzeitig war sie auch der Endpunkt des Tom-und-Jerry-für-Erwachsene-Splatterfilms. Wer das nicht verstanden hat, ist dazu verdammt, sein Publikum anzuöden. Und genau hierfür steht Undead als Zeuge vor Gericht. Undead ist ein Film über einen Film über einen Film über die Leidenschaft seines Machers zu einem Genre oder einer gewissen Art von Film - und jede Kopiegeneration wurde in Longplay erstellt, auf einem Videorekorder der ersten Longplay-Generation. Das Ergebnis ist verrauscht, kaum ansehnlich, leichenblass, unendlich fad.
 Bemerkenswert aber immerhin, wie es Undead gelingt, zu keinem Zeitpunkt soetwas wie Inspiration oder Vision zu entwickeln. Gerade ein solches geekmovie sollte doch dahingehend entsprechend auftreten. möchte man meinen. Doch nichts, wirklich nichts: Ein Kopfüber-Stunt in Zeitlupe mit dabei aus dem Rücken gezogenen Kanonen dient ihm bereits als Lichtpunkt und vermeintlich witzige Zitatenunkerei. Wirkt aber so lieblos wie Klamotten von Lidl. Ein paar coole Sprüche, die wirkungslos verpuffen, machen noch keinen Schenkelklopfer-Film. Die Orientierungslosigkeit, mit der die Macher hier ihre Filmleidenschaft zur Schau stellen, erscheint an manchen Stellen als schier erschreckend: Warum in Gottes Namen hat dieser Film entstehen müssen? Ist denn noch nicht mal mehr auf die Passion der Geeks Verlass? Diese Ratlosigkeit hat eine neue Qualität, die Zeiten eines Typ Regisseurs "Cecil B. Demented", scheint's, vorbei.
Bemerkenswert aber immerhin, wie es Undead gelingt, zu keinem Zeitpunkt soetwas wie Inspiration oder Vision zu entwickeln. Gerade ein solches geekmovie sollte doch dahingehend entsprechend auftreten. möchte man meinen. Doch nichts, wirklich nichts: Ein Kopfüber-Stunt in Zeitlupe mit dabei aus dem Rücken gezogenen Kanonen dient ihm bereits als Lichtpunkt und vermeintlich witzige Zitatenunkerei. Wirkt aber so lieblos wie Klamotten von Lidl. Ein paar coole Sprüche, die wirkungslos verpuffen, machen noch keinen Schenkelklopfer-Film. Die Orientierungslosigkeit, mit der die Macher hier ihre Filmleidenschaft zur Schau stellen, erscheint an manchen Stellen als schier erschreckend: Warum in Gottes Namen hat dieser Film entstehen müssen? Ist denn noch nicht mal mehr auf die Passion der Geeks Verlass? Diese Ratlosigkeit hat eine neue Qualität, die Zeiten eines Typ Regisseurs "Cecil B. Demented", scheint's, vorbei.imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
02. Juni 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
01.06., Heimkino
 Alucarda hat alles, was ein gutes Exploitationmovie benötigt, um als solches durchzugehen: Eine Geschichte um ein Kloster und junge Mädchen darin, die Luzifer anheim fallen, viel Blut, eine gute Portion Blasphemie, eine wagemutige kinematografische Arbeit in seinen frei delirierenden Momenten, etwa wenn die satanische Initation stattfindet oder Beelzebub persönlich einem Haufen nackter Leiber den Segen zur Orgie ausspricht.
Alucarda hat alles, was ein gutes Exploitationmovie benötigt, um als solches durchzugehen: Eine Geschichte um ein Kloster und junge Mädchen darin, die Luzifer anheim fallen, viel Blut, eine gute Portion Blasphemie, eine wagemutige kinematografische Arbeit in seinen frei delirierenden Momenten, etwa wenn die satanische Initation stattfindet oder Beelzebub persönlich einem Haufen nackter Leiber den Segen zur Orgie ausspricht.
Warum er aber dennoch nicht funktioniert, das weiß vermutlich allein der Teufel. Zum einen gestaltet sich der Zugriff durch die Geräuschkulisse schon als schwierig: Bald 80 Minuten hysterisches Gekreische hält selbst der wohlwollendste Freund abnormer Filme kaum aus. Dann behandelt der Film seine eigentlich knalligen Zutaten recht stiefmütterlich und scheint sich selbst nicht ganz sicher zu sein, was er eigentlich will: Die große künstlerische Vision steht als Behauptung stets im Raum, doch versickert das Visionäre, das Manische, vielleicht auch das manisch-visionäre Scheitern an der Unbeholfenheit, mit der hier einzelne Balken nicht zu einem tragenden Gerüst konstruiert, sondern zu einem bloßen Haufen aufeinander geworfen werden. Die Kulissenhaftigkeit, das Theatralische im Spiel der Darsteller tun je ihr übriges, um einem den Film fremd bleiben zu lassen.
 Das ist umso bedauerlicher, da manche Szenen wirklich das Zeug gehabt hätten, ganz große Kunst im Sinne des Exploitationkinos zu sein, wäre da noch etwas mehr Pfeffer im Spiel gewesen. Kamera-, Schnitt- und mise-en-scène-Experimente machen den Film hie und da schon fast spannend, auf formale Weise. Und dennoch fehlt da was, die Vision scheint kaum ehrlich. Bald überkommt einen der Gedanke: "Das ist ein Film, wie ihn Leute drehen, die nur von wenig eine Ahnung haben, aber gerne bekunden, dass sie regelmäßig vor ihrem geistigen Auge "ganz tolle Bilder für einen Film" halluzinieren." Und ganz ehrlich: Von solchen Leuten möchte ich am wenigsten einen Film sehen.
Das ist umso bedauerlicher, da manche Szenen wirklich das Zeug gehabt hätten, ganz große Kunst im Sinne des Exploitationkinos zu sein, wäre da noch etwas mehr Pfeffer im Spiel gewesen. Kamera-, Schnitt- und mise-en-scène-Experimente machen den Film hie und da schon fast spannend, auf formale Weise. Und dennoch fehlt da was, die Vision scheint kaum ehrlich. Bald überkommt einen der Gedanke: "Das ist ein Film, wie ihn Leute drehen, die nur von wenig eine Ahnung haben, aber gerne bekunden, dass sie regelmäßig vor ihrem geistigen Auge "ganz tolle Bilder für einen Film" halluzinieren." Und ganz ehrlich: Von solchen Leuten möchte ich am wenigsten einen Film sehen.
Insgesamt: Schade.
imdb | mrqe | mondo macabro (dvd-label)
 Alucarda hat alles, was ein gutes Exploitationmovie benötigt, um als solches durchzugehen: Eine Geschichte um ein Kloster und junge Mädchen darin, die Luzifer anheim fallen, viel Blut, eine gute Portion Blasphemie, eine wagemutige kinematografische Arbeit in seinen frei delirierenden Momenten, etwa wenn die satanische Initation stattfindet oder Beelzebub persönlich einem Haufen nackter Leiber den Segen zur Orgie ausspricht.
Alucarda hat alles, was ein gutes Exploitationmovie benötigt, um als solches durchzugehen: Eine Geschichte um ein Kloster und junge Mädchen darin, die Luzifer anheim fallen, viel Blut, eine gute Portion Blasphemie, eine wagemutige kinematografische Arbeit in seinen frei delirierenden Momenten, etwa wenn die satanische Initation stattfindet oder Beelzebub persönlich einem Haufen nackter Leiber den Segen zur Orgie ausspricht.Warum er aber dennoch nicht funktioniert, das weiß vermutlich allein der Teufel. Zum einen gestaltet sich der Zugriff durch die Geräuschkulisse schon als schwierig: Bald 80 Minuten hysterisches Gekreische hält selbst der wohlwollendste Freund abnormer Filme kaum aus. Dann behandelt der Film seine eigentlich knalligen Zutaten recht stiefmütterlich und scheint sich selbst nicht ganz sicher zu sein, was er eigentlich will: Die große künstlerische Vision steht als Behauptung stets im Raum, doch versickert das Visionäre, das Manische, vielleicht auch das manisch-visionäre Scheitern an der Unbeholfenheit, mit der hier einzelne Balken nicht zu einem tragenden Gerüst konstruiert, sondern zu einem bloßen Haufen aufeinander geworfen werden. Die Kulissenhaftigkeit, das Theatralische im Spiel der Darsteller tun je ihr übriges, um einem den Film fremd bleiben zu lassen.
 Das ist umso bedauerlicher, da manche Szenen wirklich das Zeug gehabt hätten, ganz große Kunst im Sinne des Exploitationkinos zu sein, wäre da noch etwas mehr Pfeffer im Spiel gewesen. Kamera-, Schnitt- und mise-en-scène-Experimente machen den Film hie und da schon fast spannend, auf formale Weise. Und dennoch fehlt da was, die Vision scheint kaum ehrlich. Bald überkommt einen der Gedanke: "Das ist ein Film, wie ihn Leute drehen, die nur von wenig eine Ahnung haben, aber gerne bekunden, dass sie regelmäßig vor ihrem geistigen Auge "ganz tolle Bilder für einen Film" halluzinieren." Und ganz ehrlich: Von solchen Leuten möchte ich am wenigsten einen Film sehen.
Das ist umso bedauerlicher, da manche Szenen wirklich das Zeug gehabt hätten, ganz große Kunst im Sinne des Exploitationkinos zu sein, wäre da noch etwas mehr Pfeffer im Spiel gewesen. Kamera-, Schnitt- und mise-en-scène-Experimente machen den Film hie und da schon fast spannend, auf formale Weise. Und dennoch fehlt da was, die Vision scheint kaum ehrlich. Bald überkommt einen der Gedanke: "Das ist ein Film, wie ihn Leute drehen, die nur von wenig eine Ahnung haben, aber gerne bekunden, dass sie regelmäßig vor ihrem geistigen Auge "ganz tolle Bilder für einen Film" halluzinieren." Und ganz ehrlich: Von solchen Leuten möchte ich am wenigsten einen Film sehen.Insgesamt: Schade.
imdb | mrqe | mondo macabro (dvd-label)
° ° °
Thema: Filmtagebuch
01. Juni 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
31.05.2004, Heimkino
Chinesische Provinz, vor vielen, vielen Jahren: Eine alte, morbide Legende erzählt von einem Laternenmacher, der menschliche Haut als Rohstoff für sein Handwerk verwende. Und so beginnt denn dieser Film mit Blitzen und Donnergrollen und er zeigt uns in kurzen Lichtsekunden blutbenetzte, herabhängende Beine und ebenso blutiges Handwerkszeug ...
 Doch bis der versprochene Horror des Vorspanns in den Film eintritt, ist es noch etwas hin: Ein Dorffest mit den zwei mächtigsten Männern der Gemeinde, die sich - natürlich - nicht riechen können, dient ihm zur Exposition. Wir erfahren Grundkonflikte, ohne dass diese allzu konkret ausformuliert würden. Natürlich geht es um Stolz, Eitelkeit und Ehrabschneidung: Wer zum Neujahrsfest dem Dorf den schönsten Lampion präsentieren kann, gewinnt. Diese simple Anordnung gewinnt im Verlauf an Tiefe und Komplexität, ohne dass dabei das richtige Maß überschritten wäre, ganz im Gegenteil ist es beeindruckend, mit welch sicherer Hand der Film - immerhin eigentlich als knalliger Reißer angelegt - stets die Balance zwischen Martial Arts, Horror, Groteske und Drama hält, seine mäandernden Verflechtungen immer wieder zum Mittelpunkt des Films zurückführt. Das ist alles andere als der gewohnte Standard in diesem Segment der Filmproduktion.
Doch bis der versprochene Horror des Vorspanns in den Film eintritt, ist es noch etwas hin: Ein Dorffest mit den zwei mächtigsten Männern der Gemeinde, die sich - natürlich - nicht riechen können, dient ihm zur Exposition. Wir erfahren Grundkonflikte, ohne dass diese allzu konkret ausformuliert würden. Natürlich geht es um Stolz, Eitelkeit und Ehrabschneidung: Wer zum Neujahrsfest dem Dorf den schönsten Lampion präsentieren kann, gewinnt. Diese simple Anordnung gewinnt im Verlauf an Tiefe und Komplexität, ohne dass dabei das richtige Maß überschritten wäre, ganz im Gegenteil ist es beeindruckend, mit welch sicherer Hand der Film - immerhin eigentlich als knalliger Reißer angelegt - stets die Balance zwischen Martial Arts, Horror, Groteske und Drama hält, seine mäandernden Verflechtungen immer wieder zum Mittelpunkt des Films zurückführt. Das ist alles andere als der gewohnte Standard in diesem Segment der Filmproduktion.
Im wesentlichen folgen wir Master Lung, der einen alten Lampionmeister in die Pflicht für seine Zwecke nehmen will. Doch der winkt ab und verweist an einen anderen, der nur im Verborgenen leben will und sich als ein ehemaliger Konkurrent Lungs herausstellt. Vor Jahren war dieser von Lung geschlagen worden, seitdem meidet er das öffentliche Leben. Lung ersehnt ihn um Hilfe und bietet ihm Reichtümer an, der Eremit willigt schließlich ein, unter der Bedingung, dass Lung dessen Höhle bis zur Fertigstellung des Lichtwerks nicht mehr betreten dürfe - der Deal ist perfekt. Doch in Folge mehren sich Entführungsfälle: Damen aus dem Umfeld von Lungs Konkurrenten verschwinden vom Erdboden, von einem wild anzusehenden Wesen entführt, was jedoch nur wir wissen. Gegenseitige Verdächtigungen und die Ermittlungen eines Polizeibeamten stacheln die Stimmung auf, während die Frauen in der Grotte des Eremiten blutige Tode sterben ...
 Human Lanterns ist nicht unbedingt spannend im Sinne eines dramaturgischen Aufbaus geraten. Er konzentriert sich zum einen, wie gesagt, zwar sehr genau auf sein narratives Geflecht, dass er trotz vieler Action- und Gruselsequenzen nie außer Augen lässt. Da von Beginn an kein Zweifel bestehen kann, wer hinter den Morden steckt, ist das Interesse den verschiedenen Konstellationen zugewandt, die im Laufe vertieft werden, wie auch die Frage stets im Raum steht, wie nun der Plan des Eremiten - offensichtlich will er die beiden Machthaber gegenseitig ausspielen - aufgeht. Dass wir weitgehend die Perspektive Lungs teilen - einem unglaublich von sich eingenommenen, eitlen Widerling - versetzt dem ganzen die richtige Würze, da aus moralischen Gründen - eben deshalb - ein Happy End für diese Person eigentlich kaum in Frage kommt. Gerade in Verbindung mit den zahlreichen Swordplay-Szenen - Human Lanterns ist, trotz seines makabren Szenarios, kaum Horror, sondern eher wuxia pian - ergibt sich daraus eine Spannung, die sich vor allem aus dem Moment ergibt: Man weiß nie - wirklich nie! - wer nun als nächstes ins Gras beißt, ob der Film seine Hauptfigur opfert oder nicht, kurzum: Wie es wohl weitergehen wird. Dem bekannten ästhetischen Genuss beim Betrachten solcher, im übrigen exzellenter Kampfchoreografien wird eine gesunde Prise Surprise zur Seite gestellt, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Ergänzt wird dieser Spaß durch einige ungemein schön ausgeleuchtete Kulissenaufnahmen - seien es auf den Anwesen der beiden Konkurrenten, sei es die schaurig-gruselige Grotte des makabren Blutmetzes -, die ohne weiteres an die besten Momente der großen Shaw-Klassiker anschließen.
Human Lanterns ist nicht unbedingt spannend im Sinne eines dramaturgischen Aufbaus geraten. Er konzentriert sich zum einen, wie gesagt, zwar sehr genau auf sein narratives Geflecht, dass er trotz vieler Action- und Gruselsequenzen nie außer Augen lässt. Da von Beginn an kein Zweifel bestehen kann, wer hinter den Morden steckt, ist das Interesse den verschiedenen Konstellationen zugewandt, die im Laufe vertieft werden, wie auch die Frage stets im Raum steht, wie nun der Plan des Eremiten - offensichtlich will er die beiden Machthaber gegenseitig ausspielen - aufgeht. Dass wir weitgehend die Perspektive Lungs teilen - einem unglaublich von sich eingenommenen, eitlen Widerling - versetzt dem ganzen die richtige Würze, da aus moralischen Gründen - eben deshalb - ein Happy End für diese Person eigentlich kaum in Frage kommt. Gerade in Verbindung mit den zahlreichen Swordplay-Szenen - Human Lanterns ist, trotz seines makabren Szenarios, kaum Horror, sondern eher wuxia pian - ergibt sich daraus eine Spannung, die sich vor allem aus dem Moment ergibt: Man weiß nie - wirklich nie! - wer nun als nächstes ins Gras beißt, ob der Film seine Hauptfigur opfert oder nicht, kurzum: Wie es wohl weitergehen wird. Dem bekannten ästhetischen Genuss beim Betrachten solcher, im übrigen exzellenter Kampfchoreografien wird eine gesunde Prise Surprise zur Seite gestellt, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Ergänzt wird dieser Spaß durch einige ungemein schön ausgeleuchtete Kulissenaufnahmen - seien es auf den Anwesen der beiden Konkurrenten, sei es die schaurig-gruselige Grotte des makabren Blutmetzes -, die ohne weiteres an die besten Momente der großen Shaw-Klassiker anschließen.
Eine kleine Überraschung also: Erwartet hatte ich einen spekulativen, sleazigen Reißer. Bekommen habe ich einen wohldurchdacht erzählte und inszenierte Groschenromanbegebenheit. Und das ist, natürlich, keineswegs negativ gemeint. Lustvolle Trivialität der schönen Sorte (schade nur, dass die DVD der Reissue-Reihe einige Schnitte aufweist).
imdb
filmtagebuch: shaw
Chinesische Provinz, vor vielen, vielen Jahren: Eine alte, morbide Legende erzählt von einem Laternenmacher, der menschliche Haut als Rohstoff für sein Handwerk verwende. Und so beginnt denn dieser Film mit Blitzen und Donnergrollen und er zeigt uns in kurzen Lichtsekunden blutbenetzte, herabhängende Beine und ebenso blutiges Handwerkszeug ...
 Doch bis der versprochene Horror des Vorspanns in den Film eintritt, ist es noch etwas hin: Ein Dorffest mit den zwei mächtigsten Männern der Gemeinde, die sich - natürlich - nicht riechen können, dient ihm zur Exposition. Wir erfahren Grundkonflikte, ohne dass diese allzu konkret ausformuliert würden. Natürlich geht es um Stolz, Eitelkeit und Ehrabschneidung: Wer zum Neujahrsfest dem Dorf den schönsten Lampion präsentieren kann, gewinnt. Diese simple Anordnung gewinnt im Verlauf an Tiefe und Komplexität, ohne dass dabei das richtige Maß überschritten wäre, ganz im Gegenteil ist es beeindruckend, mit welch sicherer Hand der Film - immerhin eigentlich als knalliger Reißer angelegt - stets die Balance zwischen Martial Arts, Horror, Groteske und Drama hält, seine mäandernden Verflechtungen immer wieder zum Mittelpunkt des Films zurückführt. Das ist alles andere als der gewohnte Standard in diesem Segment der Filmproduktion.
Doch bis der versprochene Horror des Vorspanns in den Film eintritt, ist es noch etwas hin: Ein Dorffest mit den zwei mächtigsten Männern der Gemeinde, die sich - natürlich - nicht riechen können, dient ihm zur Exposition. Wir erfahren Grundkonflikte, ohne dass diese allzu konkret ausformuliert würden. Natürlich geht es um Stolz, Eitelkeit und Ehrabschneidung: Wer zum Neujahrsfest dem Dorf den schönsten Lampion präsentieren kann, gewinnt. Diese simple Anordnung gewinnt im Verlauf an Tiefe und Komplexität, ohne dass dabei das richtige Maß überschritten wäre, ganz im Gegenteil ist es beeindruckend, mit welch sicherer Hand der Film - immerhin eigentlich als knalliger Reißer angelegt - stets die Balance zwischen Martial Arts, Horror, Groteske und Drama hält, seine mäandernden Verflechtungen immer wieder zum Mittelpunkt des Films zurückführt. Das ist alles andere als der gewohnte Standard in diesem Segment der Filmproduktion.Im wesentlichen folgen wir Master Lung, der einen alten Lampionmeister in die Pflicht für seine Zwecke nehmen will. Doch der winkt ab und verweist an einen anderen, der nur im Verborgenen leben will und sich als ein ehemaliger Konkurrent Lungs herausstellt. Vor Jahren war dieser von Lung geschlagen worden, seitdem meidet er das öffentliche Leben. Lung ersehnt ihn um Hilfe und bietet ihm Reichtümer an, der Eremit willigt schließlich ein, unter der Bedingung, dass Lung dessen Höhle bis zur Fertigstellung des Lichtwerks nicht mehr betreten dürfe - der Deal ist perfekt. Doch in Folge mehren sich Entführungsfälle: Damen aus dem Umfeld von Lungs Konkurrenten verschwinden vom Erdboden, von einem wild anzusehenden Wesen entführt, was jedoch nur wir wissen. Gegenseitige Verdächtigungen und die Ermittlungen eines Polizeibeamten stacheln die Stimmung auf, während die Frauen in der Grotte des Eremiten blutige Tode sterben ...
 Human Lanterns ist nicht unbedingt spannend im Sinne eines dramaturgischen Aufbaus geraten. Er konzentriert sich zum einen, wie gesagt, zwar sehr genau auf sein narratives Geflecht, dass er trotz vieler Action- und Gruselsequenzen nie außer Augen lässt. Da von Beginn an kein Zweifel bestehen kann, wer hinter den Morden steckt, ist das Interesse den verschiedenen Konstellationen zugewandt, die im Laufe vertieft werden, wie auch die Frage stets im Raum steht, wie nun der Plan des Eremiten - offensichtlich will er die beiden Machthaber gegenseitig ausspielen - aufgeht. Dass wir weitgehend die Perspektive Lungs teilen - einem unglaublich von sich eingenommenen, eitlen Widerling - versetzt dem ganzen die richtige Würze, da aus moralischen Gründen - eben deshalb - ein Happy End für diese Person eigentlich kaum in Frage kommt. Gerade in Verbindung mit den zahlreichen Swordplay-Szenen - Human Lanterns ist, trotz seines makabren Szenarios, kaum Horror, sondern eher wuxia pian - ergibt sich daraus eine Spannung, die sich vor allem aus dem Moment ergibt: Man weiß nie - wirklich nie! - wer nun als nächstes ins Gras beißt, ob der Film seine Hauptfigur opfert oder nicht, kurzum: Wie es wohl weitergehen wird. Dem bekannten ästhetischen Genuss beim Betrachten solcher, im übrigen exzellenter Kampfchoreografien wird eine gesunde Prise Surprise zur Seite gestellt, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Ergänzt wird dieser Spaß durch einige ungemein schön ausgeleuchtete Kulissenaufnahmen - seien es auf den Anwesen der beiden Konkurrenten, sei es die schaurig-gruselige Grotte des makabren Blutmetzes -, die ohne weiteres an die besten Momente der großen Shaw-Klassiker anschließen.
Human Lanterns ist nicht unbedingt spannend im Sinne eines dramaturgischen Aufbaus geraten. Er konzentriert sich zum einen, wie gesagt, zwar sehr genau auf sein narratives Geflecht, dass er trotz vieler Action- und Gruselsequenzen nie außer Augen lässt. Da von Beginn an kein Zweifel bestehen kann, wer hinter den Morden steckt, ist das Interesse den verschiedenen Konstellationen zugewandt, die im Laufe vertieft werden, wie auch die Frage stets im Raum steht, wie nun der Plan des Eremiten - offensichtlich will er die beiden Machthaber gegenseitig ausspielen - aufgeht. Dass wir weitgehend die Perspektive Lungs teilen - einem unglaublich von sich eingenommenen, eitlen Widerling - versetzt dem ganzen die richtige Würze, da aus moralischen Gründen - eben deshalb - ein Happy End für diese Person eigentlich kaum in Frage kommt. Gerade in Verbindung mit den zahlreichen Swordplay-Szenen - Human Lanterns ist, trotz seines makabren Szenarios, kaum Horror, sondern eher wuxia pian - ergibt sich daraus eine Spannung, die sich vor allem aus dem Moment ergibt: Man weiß nie - wirklich nie! - wer nun als nächstes ins Gras beißt, ob der Film seine Hauptfigur opfert oder nicht, kurzum: Wie es wohl weitergehen wird. Dem bekannten ästhetischen Genuss beim Betrachten solcher, im übrigen exzellenter Kampfchoreografien wird eine gesunde Prise Surprise zur Seite gestellt, die ihre Wirkung nicht verfehlt. Ergänzt wird dieser Spaß durch einige ungemein schön ausgeleuchtete Kulissenaufnahmen - seien es auf den Anwesen der beiden Konkurrenten, sei es die schaurig-gruselige Grotte des makabren Blutmetzes -, die ohne weiteres an die besten Momente der großen Shaw-Klassiker anschließen.Eine kleine Überraschung also: Erwartet hatte ich einen spekulativen, sleazigen Reißer. Bekommen habe ich einen wohldurchdacht erzählte und inszenierte Groschenromanbegebenheit. Und das ist, natürlich, keineswegs negativ gemeint. Lustvolle Trivialität der schönen Sorte (schade nur, dass die DVD der Reissue-Reihe einige Schnitte aufweist).
imdb
filmtagebuch: shaw
° ° °
Thema: Filmtagebuch
31. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
25.05.2004, Ufa Palast Kosmos
Inhalt.
Ein grundlegendes Problem des Films: An einigen Stellen lässt er durchscheinen, wie clever er eigentlich sein könnte. Immer dann nämlich, wenn er offenkundig macht, dass hier nicht etwa ein fester Stamm an Filmen mittels bloßer Persiflierung verkackmeiert wird, sondern dass es eher um eine bestimmte Vorstellung geht, um einen Blick, eine Mentalität, die diese Filme überhaupt erst ermöglichen. Ziel des Angriffs: Die post-wirtschaftswunderbare Sämigkeit der deutschen Unterhaltungskultur, einige Jahre nach dem Krieg, kurz vor den sozio-kulturellen Umwälzungen, für die 68 zur synonymen Zahl wurde (auch wenn, mit Jurassic Park 2 gesprochen, etwas überlebt hat, ganz klar).
 Soweit, so klug. Warum sollte das aber problematisch, ärgerlich sein? Weil dem Film der Wagemut fehlt (den man bei Kalkofe eigentlich erwarten darf), dieses Projekt konsequent zu verfolgen. Wo er an manchen Stellen schlicht genial ist - in obig genanntem Sinne -, verfällt er an anderen doppelt und dreifach in die bloße Mimese dumm-deutscher Unkerei. Die Überaffirmation, die eigentlich bloßstellen soll, gerät zur Schunkelei, zum flachen Witz, der nichts aufdeckt, sondern bloß unliebsame Traditionen des deutschen Humors für die Post-Schuh-des-Manitu-Generation fortschreibt. Die wenigen gelungenen Momente werden da fast schon zu Oasen innerhalb einer Wüstenei, deren Dürre durch die kurzen Wasserpausen nur umso schmerzlicher bewusst wird. Vollkommen quer zu allem, - ohne dabei dem Film dadurch Würze zu verleihen - stehen uninspirierte Parodien auf Matrix und Das Schweigen der Lämmer, die weder zünden, noch irgendwie im Sinne des Films einen Zweck erfüllen, vom dünkenden Geblöke jener Klientel mal abgesehen, die eine Parodie schon mit dem Erkennen des Referierten für erfolgreich erklärt. Vielmehr lässt ihre benommene Orientierungslosigkeit um den Verstand der Macher fürchten, um den Kalkofes insbesondere, der hier im Nachhinein jeglichen Ruhm seiner Mattscheibe demontieren zu wollen scheint.
Soweit, so klug. Warum sollte das aber problematisch, ärgerlich sein? Weil dem Film der Wagemut fehlt (den man bei Kalkofe eigentlich erwarten darf), dieses Projekt konsequent zu verfolgen. Wo er an manchen Stellen schlicht genial ist - in obig genanntem Sinne -, verfällt er an anderen doppelt und dreifach in die bloße Mimese dumm-deutscher Unkerei. Die Überaffirmation, die eigentlich bloßstellen soll, gerät zur Schunkelei, zum flachen Witz, der nichts aufdeckt, sondern bloß unliebsame Traditionen des deutschen Humors für die Post-Schuh-des-Manitu-Generation fortschreibt. Die wenigen gelungenen Momente werden da fast schon zu Oasen innerhalb einer Wüstenei, deren Dürre durch die kurzen Wasserpausen nur umso schmerzlicher bewusst wird. Vollkommen quer zu allem, - ohne dabei dem Film dadurch Würze zu verleihen - stehen uninspirierte Parodien auf Matrix und Das Schweigen der Lämmer, die weder zünden, noch irgendwie im Sinne des Films einen Zweck erfüllen, vom dünkenden Geblöke jener Klientel mal abgesehen, die eine Parodie schon mit dem Erkennen des Referierten für erfolgreich erklärt. Vielmehr lässt ihre benommene Orientierungslosigkeit um den Verstand der Macher fürchten, um den Kalkofes insbesondere, der hier im Nachhinein jeglichen Ruhm seiner Mattscheibe demontieren zu wollen scheint.
"Ich erinnere mich an Wurzelbehandlungen ohne Betäubungen, bei denen ich mehr gelacht habe als bei dieser Sendung. Wenn das wirklich ein Beispiel für den deutschen Humor sein soll, ist es höchste Zeit, aus dem Fenster zu springen und vorher noch seine Staatsbürgerschaft aufzugeben" - so ließe sich Kalkofe mit Kalkofe schlagen. Ein Trauerspiel reinsten Wassers.
imdb | offizielle site | filmz.de | angelaufen.de
Inhalt.
Ein grundlegendes Problem des Films: An einigen Stellen lässt er durchscheinen, wie clever er eigentlich sein könnte. Immer dann nämlich, wenn er offenkundig macht, dass hier nicht etwa ein fester Stamm an Filmen mittels bloßer Persiflierung verkackmeiert wird, sondern dass es eher um eine bestimmte Vorstellung geht, um einen Blick, eine Mentalität, die diese Filme überhaupt erst ermöglichen. Ziel des Angriffs: Die post-wirtschaftswunderbare Sämigkeit der deutschen Unterhaltungskultur, einige Jahre nach dem Krieg, kurz vor den sozio-kulturellen Umwälzungen, für die 68 zur synonymen Zahl wurde (auch wenn, mit Jurassic Park 2 gesprochen, etwas überlebt hat, ganz klar).
 Soweit, so klug. Warum sollte das aber problematisch, ärgerlich sein? Weil dem Film der Wagemut fehlt (den man bei Kalkofe eigentlich erwarten darf), dieses Projekt konsequent zu verfolgen. Wo er an manchen Stellen schlicht genial ist - in obig genanntem Sinne -, verfällt er an anderen doppelt und dreifach in die bloße Mimese dumm-deutscher Unkerei. Die Überaffirmation, die eigentlich bloßstellen soll, gerät zur Schunkelei, zum flachen Witz, der nichts aufdeckt, sondern bloß unliebsame Traditionen des deutschen Humors für die Post-Schuh-des-Manitu-Generation fortschreibt. Die wenigen gelungenen Momente werden da fast schon zu Oasen innerhalb einer Wüstenei, deren Dürre durch die kurzen Wasserpausen nur umso schmerzlicher bewusst wird. Vollkommen quer zu allem, - ohne dabei dem Film dadurch Würze zu verleihen - stehen uninspirierte Parodien auf Matrix und Das Schweigen der Lämmer, die weder zünden, noch irgendwie im Sinne des Films einen Zweck erfüllen, vom dünkenden Geblöke jener Klientel mal abgesehen, die eine Parodie schon mit dem Erkennen des Referierten für erfolgreich erklärt. Vielmehr lässt ihre benommene Orientierungslosigkeit um den Verstand der Macher fürchten, um den Kalkofes insbesondere, der hier im Nachhinein jeglichen Ruhm seiner Mattscheibe demontieren zu wollen scheint.
Soweit, so klug. Warum sollte das aber problematisch, ärgerlich sein? Weil dem Film der Wagemut fehlt (den man bei Kalkofe eigentlich erwarten darf), dieses Projekt konsequent zu verfolgen. Wo er an manchen Stellen schlicht genial ist - in obig genanntem Sinne -, verfällt er an anderen doppelt und dreifach in die bloße Mimese dumm-deutscher Unkerei. Die Überaffirmation, die eigentlich bloßstellen soll, gerät zur Schunkelei, zum flachen Witz, der nichts aufdeckt, sondern bloß unliebsame Traditionen des deutschen Humors für die Post-Schuh-des-Manitu-Generation fortschreibt. Die wenigen gelungenen Momente werden da fast schon zu Oasen innerhalb einer Wüstenei, deren Dürre durch die kurzen Wasserpausen nur umso schmerzlicher bewusst wird. Vollkommen quer zu allem, - ohne dabei dem Film dadurch Würze zu verleihen - stehen uninspirierte Parodien auf Matrix und Das Schweigen der Lämmer, die weder zünden, noch irgendwie im Sinne des Films einen Zweck erfüllen, vom dünkenden Geblöke jener Klientel mal abgesehen, die eine Parodie schon mit dem Erkennen des Referierten für erfolgreich erklärt. Vielmehr lässt ihre benommene Orientierungslosigkeit um den Verstand der Macher fürchten, um den Kalkofes insbesondere, der hier im Nachhinein jeglichen Ruhm seiner Mattscheibe demontieren zu wollen scheint."Ich erinnere mich an Wurzelbehandlungen ohne Betäubungen, bei denen ich mehr gelacht habe als bei dieser Sendung. Wenn das wirklich ein Beispiel für den deutschen Humor sein soll, ist es höchste Zeit, aus dem Fenster zu springen und vorher noch seine Staatsbürgerschaft aufzugeben" - so ließe sich Kalkofe mit Kalkofe schlagen. Ein Trauerspiel reinsten Wassers.
imdb | offizielle site | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
30. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
28.01.2004, Heimkino
Ich bin der Erste, der pauschalen Kritikern minimaler Horror-Szenarien - sagen wir: "Gruppe wird gejagt" oder "blutrünstiger Mörder geht um" - entgegen tritt und deren oft nur vorab getroffenen Urteile für nicht zutreffend erklärt. Nicht wenige Elaborate der oft abgetanen "Schmuddelecke" weisen, vom Diktum großangelegter Erzählungen befreit, ganz ungeahnte Qualitäten auf. Dann aber wiederum gibt es Fälle, da strecke ich die Waffen, da ist mir das alles wurscht, da stimme ich gerne in den allgemeinen Tenor mit ein: "Dieser Film ist schlecht und langweilig." Ich meine natürlich den koreanischen Say Yes, vom Fantasy Filmfest damals - so das Zitat auf der Hülle der DVD - im Programmheft als "fieser Dobermann" bezeichnet und dort sogar, wenn ich mich recht erinnere, Tobe Hoopers Kettensägenmassaker zwecks Qualitätsversicherung gleichgestellt. Was für ein bodenloser Frevel.
Das Setting ist allenfalls reißbrettartig durchkonzipiert und überzeugt zu keiner Sekunde. Endlich verlegter Ex-Student mit Schriftstellerambitionen verwöhnt Herzensdame ob der frohen Kunde, als wäre ein Lottohauptgewinn eine verbindliche Klausel im Vertrag gewesen: Neues Auto, teures Hotel, eine Reise durch's Land, das Angebot an sie, die zuvor beide mit einem Übersetzerjob durchgebracht hat, nun endlich wieder selbst studieren zu können, er finanziere sogar ein Auslandssemester. Soweit die ersten Minuten. Durchkreuzt wird das junge, reisende Glück jedoch jäh von einem finster dreinblickenden Psychopathen, der die beiden auf der Reise zunächst nur provoziert und gängelt, in der Wahl seiner Mittel dabei aber zunehmend skrupellos vorgeht. Viel Gewalt, 'ne Nacht im Knast - welch' Intrige des Bösewichts! -, viele Demütigungen, wie sie sich jeder x-beliebige TV-Serien-Drehbuchautor ausdenken und komponieren kann. Der primus movens des Herrn bleibt verborgen - das soll dem Film wohl Spannung einpflanzen, trägt aber nur zu einer latenten Alles-scheißegal-Haltung seitens des Zuschauers bei, die dem Film schon im ersten Drittel das Genick zu brechen droht. Und es wird im Verlauf nicht besser, en contraire.
Ein Paradestück für uninspiriertes, unoriginelles Filmemachen. Eine halbgare Idee, die sich in ihrer Auflösung zum Schluß offenbar als existenzialistische Weitsicht empfindet, dabei aber allenfalls so ein bißchen rumgründelnd bleibt, getragen von zweifelhaften Darstellerleistungen, einem ungewitzten Drehbuch und einer geradewegs erschreckend konventionellen formalen Umsetzung. Das ist nicht nur: langweilig, sondern auch: dumm, vor allem aber: nervig. Und es korresponidert auch alles mit den ganz und gar bodenlosen Leistungen der Synchronisation, die dem Film bei der Durchführung seines Projekts, die Meßlatte in Sachen Langeweile ein paar Level höher anzusetzen, in jeder Sekunde Hilfestellung leistet.
Ganz ernsthaft möchte man die Macher fragen: Was soll die Scheiße eigentlich? Muss wirklich jeder Film gredreht werden, bloß weil einem gerade ein Geldgeber auf den Leim gegangen ist? Nee echt, Leute, versucht's beim Fernsehen, geht in die Nachrichten, wenn es Euch nur drum geht, 'ne Kamera in der Hand zu halten und technisch solide Kost abzuliefern. Aber verschont die Menschheit doch bitte mit einem solchen in jedweder Hinsicht faden Schmu.
imdb | mrqe
Ich bin der Erste, der pauschalen Kritikern minimaler Horror-Szenarien - sagen wir: "Gruppe wird gejagt" oder "blutrünstiger Mörder geht um" - entgegen tritt und deren oft nur vorab getroffenen Urteile für nicht zutreffend erklärt. Nicht wenige Elaborate der oft abgetanen "Schmuddelecke" weisen, vom Diktum großangelegter Erzählungen befreit, ganz ungeahnte Qualitäten auf. Dann aber wiederum gibt es Fälle, da strecke ich die Waffen, da ist mir das alles wurscht, da stimme ich gerne in den allgemeinen Tenor mit ein: "Dieser Film ist schlecht und langweilig." Ich meine natürlich den koreanischen Say Yes, vom Fantasy Filmfest damals - so das Zitat auf der Hülle der DVD - im Programmheft als "fieser Dobermann" bezeichnet und dort sogar, wenn ich mich recht erinnere, Tobe Hoopers Kettensägenmassaker zwecks Qualitätsversicherung gleichgestellt. Was für ein bodenloser Frevel.
Das Setting ist allenfalls reißbrettartig durchkonzipiert und überzeugt zu keiner Sekunde. Endlich verlegter Ex-Student mit Schriftstellerambitionen verwöhnt Herzensdame ob der frohen Kunde, als wäre ein Lottohauptgewinn eine verbindliche Klausel im Vertrag gewesen: Neues Auto, teures Hotel, eine Reise durch's Land, das Angebot an sie, die zuvor beide mit einem Übersetzerjob durchgebracht hat, nun endlich wieder selbst studieren zu können, er finanziere sogar ein Auslandssemester. Soweit die ersten Minuten. Durchkreuzt wird das junge, reisende Glück jedoch jäh von einem finster dreinblickenden Psychopathen, der die beiden auf der Reise zunächst nur provoziert und gängelt, in der Wahl seiner Mittel dabei aber zunehmend skrupellos vorgeht. Viel Gewalt, 'ne Nacht im Knast - welch' Intrige des Bösewichts! -, viele Demütigungen, wie sie sich jeder x-beliebige TV-Serien-Drehbuchautor ausdenken und komponieren kann. Der primus movens des Herrn bleibt verborgen - das soll dem Film wohl Spannung einpflanzen, trägt aber nur zu einer latenten Alles-scheißegal-Haltung seitens des Zuschauers bei, die dem Film schon im ersten Drittel das Genick zu brechen droht. Und es wird im Verlauf nicht besser, en contraire.
Ein Paradestück für uninspiriertes, unoriginelles Filmemachen. Eine halbgare Idee, die sich in ihrer Auflösung zum Schluß offenbar als existenzialistische Weitsicht empfindet, dabei aber allenfalls so ein bißchen rumgründelnd bleibt, getragen von zweifelhaften Darstellerleistungen, einem ungewitzten Drehbuch und einer geradewegs erschreckend konventionellen formalen Umsetzung. Das ist nicht nur: langweilig, sondern auch: dumm, vor allem aber: nervig. Und es korresponidert auch alles mit den ganz und gar bodenlosen Leistungen der Synchronisation, die dem Film bei der Durchführung seines Projekts, die Meßlatte in Sachen Langeweile ein paar Level höher anzusetzen, in jeder Sekunde Hilfestellung leistet.
Ganz ernsthaft möchte man die Macher fragen: Was soll die Scheiße eigentlich? Muss wirklich jeder Film gredreht werden, bloß weil einem gerade ein Geldgeber auf den Leim gegangen ist? Nee echt, Leute, versucht's beim Fernsehen, geht in die Nachrichten, wenn es Euch nur drum geht, 'ne Kamera in der Hand zu halten und technisch solide Kost abzuliefern. Aber verschont die Menschheit doch bitte mit einem solchen in jedweder Hinsicht faden Schmu.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
25.05.2004, Kino Intimes
Zunächst, wie man diesem hochkonzentrierten Film nach allen Regeln der Kunst Gewalt antut, eindrucksvoll zu lesen in der <nolink>BZ</nolink>: "Die Story: Ein ganz normaler Tag in einer amerikanischen Highschool. John (John Robinson) wird von seinem Alkoholiker-Vater (Timothy Bottoms) zur Schule begleitet, im Flur halten Nathan (Nathan Tyson) und Carrie (Carrie Finklea) Händchen, drei Freundinnen gehen zur Kantine, eine Schulklasse diskutiert über Toleranz. Zu Hause packen derweil die Schüler Alex (Alex Frost) und Eric (Eric Deulen) Sturmgewehre in ihre Sporttaschen und machen sich auf den Weg zu ihrer verhassten Schule. Ein bis ins Detail geplanter Amoklauf nimmt seinen Anfang."
 Hier scheitert die Form des Textes schon an der Form des Films, ja ganz grundlegende Inkompatibilitäten tun sich auf. Elephant hat keine "Story", auf Linearität kann man allenfalls innerhalb einer Einstellung vertrauen, eine über den Schnitt hinaus verfolgte ist oft schon ein Entgegenkommen. Er verweigert sich geradezu dem Kausalen, ersetzt diese Lücke durch ein Netz, in dem sich alles abspielt, in dem alles miteinander verbunden ist - mehrfach sehen wir Kreuzungspunkte aus unterschiedlichen Perspektive, ohne dass dies nur ein Gimmick wäre -, aus dem heraus - und wir befinden uns ja in ihm - das Ganze nicht zu erklären ist.
Hier scheitert die Form des Textes schon an der Form des Films, ja ganz grundlegende Inkompatibilitäten tun sich auf. Elephant hat keine "Story", auf Linearität kann man allenfalls innerhalb einer Einstellung vertrauen, eine über den Schnitt hinaus verfolgte ist oft schon ein Entgegenkommen. Er verweigert sich geradezu dem Kausalen, ersetzt diese Lücke durch ein Netz, in dem sich alles abspielt, in dem alles miteinander verbunden ist - mehrfach sehen wir Kreuzungspunkte aus unterschiedlichen Perspektive, ohne dass dies nur ein Gimmick wäre -, aus dem heraus - und wir befinden uns ja in ihm - das Ganze nicht zu erklären ist.
Ein Film über das Wieder-Sehen-können. Über das Lernen des Sehens, des Beobachtens. Aber auch: über das Sich-Bewusstwerden dieses Lernens und Sehens. Minutenlang schwebt die Kamera durch diese Welt (es gibt ein Drinnen, ein Draußen, das Draußen ist grell, ausgeblichen hell, unwirklich, das Drinnen oft schon hyperbolisch farbsatt), durch Schulgänge, über Gesichter, Kleidungsstücke, Körper. Der Blick schärft sich für Texturen auf dem Textil, Falten in der Kleidung, man sieht beinahe schon die Mitesser dieser (unzähligen) Menschen. Solche streifen wir, fokussieren wir, manche bekommen wir nie im Schärfebereich zu Gesicht. Alles ein Teil des Ganzen, jedes Detail wie ein Fraktal, in das sich die Vertiefung lohnen würde, Versenkungen allenthalben, nie aber konzeptloses Hinein-Stürzen, in diese Welt voller Abläufe und Strukturen, die zu Beginn noch ein Chaos sind, sich aber mit der Einübung durch Wiederholung zunehmend erschließen.
Und wir lernen: Wie das alles nur ein "Außen" ist. Nicht aber: Was da für ein "Innen" ist. "Man sieht einem Menschen nicht an, ob er schwul ist", heißt es zu Beginn mal in einer Klassenrunde, "auch rosa Haare heißen noch nicht, dass der schwul ist" Man kann nicht hineinsehen, in diese Menschen (die Täter erkennen wir lange nicht als solche). Obwohl wir es doch wollen, obwohl wir uns danach sehnen, obwohl wir uns von der Kamera wünschen, mehr an Informationen zu bekommen, mehr zu erfahren: Mehr als Annäherung findet nicht statt, die Kamera weiß das. Wir wiederum wissen - was einen ungeheuren Suspense ergibt, was sich mit der trügerisch entspannten Banalität der gezeigten Ereignisse und Alltagswidrigkeiten, mit der bewussten Antidramaturgie aufs heftigste beißt (im positiven Sinne) - dass ein Schulmassaker stattfinden wird. Hier und heute. Oder besser: In diesem Film.
 Denn Elephant bleibt Film, und nicht Erklärungs-, Rationalisierungs- oder Politversuch: Am Ende des Abspanns der obligatorische Absatz mit dem fictional und den zufälligen Ähnlichkeiten zu Personen, living or dead. Auch auf ästhetischer Ebene will Elephant nichts anderes als Film sein, der über sich selbst nachdenkt. Eine Filmmeditation, wie mit dem Einbruch des Schrecklichen in die Banalität des Alltags filmisch umzugehen wäre. Und damit ist - noch nicht mal paradox eigentlich - schon sehr viel über die Realität gesagt (eine Person wird auffällig, aber nicht penetrant als Echo des Fotografs aus Blowup gekennzeichnet).
Denn Elephant bleibt Film, und nicht Erklärungs-, Rationalisierungs- oder Politversuch: Am Ende des Abspanns der obligatorische Absatz mit dem fictional und den zufälligen Ähnlichkeiten zu Personen, living or dead. Auch auf ästhetischer Ebene will Elephant nichts anderes als Film sein, der über sich selbst nachdenkt. Eine Filmmeditation, wie mit dem Einbruch des Schrecklichen in die Banalität des Alltags filmisch umzugehen wäre. Und damit ist - noch nicht mal paradox eigentlich - schon sehr viel über die Realität gesagt (eine Person wird auffällig, aber nicht penetrant als Echo des Fotografs aus Blowup gekennzeichnet).
Überhaupt das Paradoxe. Ein Film, der oft schon hypnotisch langsam ist, aber Herzrasen verursacht. Ein Film, der bisweilen sein Heil im Kosmischen sucht, dabei aber auf dem Boden bleibt, nachgerade einen erstaunlich schlüssigen Kommentar zum State of the Art der Realität darstellt. Für Elise und ein Egoshooter im gleichen Nerd-Kulturuniversum. Sehen und nicht sehen als deckungsgleicher Akt.
Ein in jeder Hinsicht eleganter, großer, aufregender Film. Noch viel wäre zu schreiben, sehr viel.
P.S.: The Shining (weil ich es wichtig finde, den Film hier noch zu erwähnen, weil der mir immer wieder im Kopf rumspukte, während der Sichtung, ohne dass ich da über bloß vage Äußerungen hinauskäme, aber ich meine, dass Gus van Sant seinen Film durchaus in einem korrespondieren Verhältnis zu Kubricks Film sieht.)
imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de
Zunächst, wie man diesem hochkonzentrierten Film nach allen Regeln der Kunst Gewalt antut, eindrucksvoll zu lesen in der <nolink>BZ</nolink>: "Die Story: Ein ganz normaler Tag in einer amerikanischen Highschool. John (John Robinson) wird von seinem Alkoholiker-Vater (Timothy Bottoms) zur Schule begleitet, im Flur halten Nathan (Nathan Tyson) und Carrie (Carrie Finklea) Händchen, drei Freundinnen gehen zur Kantine, eine Schulklasse diskutiert über Toleranz. Zu Hause packen derweil die Schüler Alex (Alex Frost) und Eric (Eric Deulen) Sturmgewehre in ihre Sporttaschen und machen sich auf den Weg zu ihrer verhassten Schule. Ein bis ins Detail geplanter Amoklauf nimmt seinen Anfang."
 Hier scheitert die Form des Textes schon an der Form des Films, ja ganz grundlegende Inkompatibilitäten tun sich auf. Elephant hat keine "Story", auf Linearität kann man allenfalls innerhalb einer Einstellung vertrauen, eine über den Schnitt hinaus verfolgte ist oft schon ein Entgegenkommen. Er verweigert sich geradezu dem Kausalen, ersetzt diese Lücke durch ein Netz, in dem sich alles abspielt, in dem alles miteinander verbunden ist - mehrfach sehen wir Kreuzungspunkte aus unterschiedlichen Perspektive, ohne dass dies nur ein Gimmick wäre -, aus dem heraus - und wir befinden uns ja in ihm - das Ganze nicht zu erklären ist.
Hier scheitert die Form des Textes schon an der Form des Films, ja ganz grundlegende Inkompatibilitäten tun sich auf. Elephant hat keine "Story", auf Linearität kann man allenfalls innerhalb einer Einstellung vertrauen, eine über den Schnitt hinaus verfolgte ist oft schon ein Entgegenkommen. Er verweigert sich geradezu dem Kausalen, ersetzt diese Lücke durch ein Netz, in dem sich alles abspielt, in dem alles miteinander verbunden ist - mehrfach sehen wir Kreuzungspunkte aus unterschiedlichen Perspektive, ohne dass dies nur ein Gimmick wäre -, aus dem heraus - und wir befinden uns ja in ihm - das Ganze nicht zu erklären ist.Ein Film über das Wieder-Sehen-können. Über das Lernen des Sehens, des Beobachtens. Aber auch: über das Sich-Bewusstwerden dieses Lernens und Sehens. Minutenlang schwebt die Kamera durch diese Welt (es gibt ein Drinnen, ein Draußen, das Draußen ist grell, ausgeblichen hell, unwirklich, das Drinnen oft schon hyperbolisch farbsatt), durch Schulgänge, über Gesichter, Kleidungsstücke, Körper. Der Blick schärft sich für Texturen auf dem Textil, Falten in der Kleidung, man sieht beinahe schon die Mitesser dieser (unzähligen) Menschen. Solche streifen wir, fokussieren wir, manche bekommen wir nie im Schärfebereich zu Gesicht. Alles ein Teil des Ganzen, jedes Detail wie ein Fraktal, in das sich die Vertiefung lohnen würde, Versenkungen allenthalben, nie aber konzeptloses Hinein-Stürzen, in diese Welt voller Abläufe und Strukturen, die zu Beginn noch ein Chaos sind, sich aber mit der Einübung durch Wiederholung zunehmend erschließen.
Und wir lernen: Wie das alles nur ein "Außen" ist. Nicht aber: Was da für ein "Innen" ist. "Man sieht einem Menschen nicht an, ob er schwul ist", heißt es zu Beginn mal in einer Klassenrunde, "auch rosa Haare heißen noch nicht, dass der schwul ist" Man kann nicht hineinsehen, in diese Menschen (die Täter erkennen wir lange nicht als solche). Obwohl wir es doch wollen, obwohl wir uns danach sehnen, obwohl wir uns von der Kamera wünschen, mehr an Informationen zu bekommen, mehr zu erfahren: Mehr als Annäherung findet nicht statt, die Kamera weiß das. Wir wiederum wissen - was einen ungeheuren Suspense ergibt, was sich mit der trügerisch entspannten Banalität der gezeigten Ereignisse und Alltagswidrigkeiten, mit der bewussten Antidramaturgie aufs heftigste beißt (im positiven Sinne) - dass ein Schulmassaker stattfinden wird. Hier und heute. Oder besser: In diesem Film.
 Denn Elephant bleibt Film, und nicht Erklärungs-, Rationalisierungs- oder Politversuch: Am Ende des Abspanns der obligatorische Absatz mit dem fictional und den zufälligen Ähnlichkeiten zu Personen, living or dead. Auch auf ästhetischer Ebene will Elephant nichts anderes als Film sein, der über sich selbst nachdenkt. Eine Filmmeditation, wie mit dem Einbruch des Schrecklichen in die Banalität des Alltags filmisch umzugehen wäre. Und damit ist - noch nicht mal paradox eigentlich - schon sehr viel über die Realität gesagt (eine Person wird auffällig, aber nicht penetrant als Echo des Fotografs aus Blowup gekennzeichnet).
Denn Elephant bleibt Film, und nicht Erklärungs-, Rationalisierungs- oder Politversuch: Am Ende des Abspanns der obligatorische Absatz mit dem fictional und den zufälligen Ähnlichkeiten zu Personen, living or dead. Auch auf ästhetischer Ebene will Elephant nichts anderes als Film sein, der über sich selbst nachdenkt. Eine Filmmeditation, wie mit dem Einbruch des Schrecklichen in die Banalität des Alltags filmisch umzugehen wäre. Und damit ist - noch nicht mal paradox eigentlich - schon sehr viel über die Realität gesagt (eine Person wird auffällig, aber nicht penetrant als Echo des Fotografs aus Blowup gekennzeichnet).Überhaupt das Paradoxe. Ein Film, der oft schon hypnotisch langsam ist, aber Herzrasen verursacht. Ein Film, der bisweilen sein Heil im Kosmischen sucht, dabei aber auf dem Boden bleibt, nachgerade einen erstaunlich schlüssigen Kommentar zum State of the Art der Realität darstellt. Für Elise und ein Egoshooter im gleichen Nerd-Kulturuniversum. Sehen und nicht sehen als deckungsgleicher Akt.
Ein in jeder Hinsicht eleganter, großer, aufregender Film. Noch viel wäre zu schreiben, sehr viel.
P.S.: The Shining (weil ich es wichtig finde, den Film hier noch zu erwähnen, weil der mir immer wieder im Kopf rumspukte, während der Sichtung, ohne dass ich da über bloß vage Äußerungen hinauskäme, aber ich meine, dass Gus van Sant seinen Film durchaus in einem korrespondieren Verhältnis zu Kubricks Film sieht.)
imdb | mrqe | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
21.03.2004, Heimkino
 The Gathering ist ein Paradebeispiel für uninspiriertes, bloß plot-basiertes Filmemachen. Dabei ist die Idee für einen zweitklassigen Horrorfilm mal gar nicht schlecht: Ausgehend vom Fund einer im Erdboden verschütteten Kirche aus dem 1. Jahrhundert, entdeckt ein Forscher ein faszinierendes Phänomen: Die Konterfeis der in der Kirche bildhauerisch abgebildeten Figuren - sensationslüsterne Schauer der Kreuzigung - finden sich in allen möglichen Artefakten der Kunst und Kultur (und in jüngeren Jahren: der Medien). Die stets gleichen Gesichter beobachten die Pest, Atombombentests und sind auf Aufnahmen von rassistischen Pogromen zu sehen. Zunächst dazu parallel erzählt der Film die Geschichte einer jungen US-Amerikanerin im britischen Hinterland, die ihr Gedächtnis verloren hat und ihre Identität sucht. Dass sie mit den Figuren in der Kirche in Zusammenhang steht, zeichnet sich schon bald ab.
The Gathering ist ein Paradebeispiel für uninspiriertes, bloß plot-basiertes Filmemachen. Dabei ist die Idee für einen zweitklassigen Horrorfilm mal gar nicht schlecht: Ausgehend vom Fund einer im Erdboden verschütteten Kirche aus dem 1. Jahrhundert, entdeckt ein Forscher ein faszinierendes Phänomen: Die Konterfeis der in der Kirche bildhauerisch abgebildeten Figuren - sensationslüsterne Schauer der Kreuzigung - finden sich in allen möglichen Artefakten der Kunst und Kultur (und in jüngeren Jahren: der Medien). Die stets gleichen Gesichter beobachten die Pest, Atombombentests und sind auf Aufnahmen von rassistischen Pogromen zu sehen. Zunächst dazu parallel erzählt der Film die Geschichte einer jungen US-Amerikanerin im britischen Hinterland, die ihr Gedächtnis verloren hat und ihre Identität sucht. Dass sie mit den Figuren in der Kirche in Zusammenhang steht, zeichnet sich schon bald ab.
Etwas mehr Wagemut, ein bißchen Lust an der Konventionslosigkeit und The Gathering hätte ein solider, wenn nicht sogar formidabler, kleiner Horrorfilm werden können. Er gibt sich aber auf allen Ebenen mit Mediokrität zufrieden und bleibt so, trotz einiger netter Momente, erschreckend lauwarm. Die Groschenromangeschichte ist sich selbst zufrieden und wird formal derart lustlos dargeboten, dass man den Machern dringend einen Berufswechsel nahelegen möchte. Nichts gegen lustvolle Trivialität, aber saft- und kraftlose wird hier nicht geduldet.
Und die Christina Ricci sollte sich mal überlegen, wie lange sie noch von ihrem Püppchen-Bonus zehren will. Ist ja geradezu schrecklich, was für Gurken die sich in den letzten Jahren in die Filmografie bugsiert hat.
web: imdb | mrqe | angelaufen.de | filmz.de
filmtagebuch: christina ricci | horror
 The Gathering ist ein Paradebeispiel für uninspiriertes, bloß plot-basiertes Filmemachen. Dabei ist die Idee für einen zweitklassigen Horrorfilm mal gar nicht schlecht: Ausgehend vom Fund einer im Erdboden verschütteten Kirche aus dem 1. Jahrhundert, entdeckt ein Forscher ein faszinierendes Phänomen: Die Konterfeis der in der Kirche bildhauerisch abgebildeten Figuren - sensationslüsterne Schauer der Kreuzigung - finden sich in allen möglichen Artefakten der Kunst und Kultur (und in jüngeren Jahren: der Medien). Die stets gleichen Gesichter beobachten die Pest, Atombombentests und sind auf Aufnahmen von rassistischen Pogromen zu sehen. Zunächst dazu parallel erzählt der Film die Geschichte einer jungen US-Amerikanerin im britischen Hinterland, die ihr Gedächtnis verloren hat und ihre Identität sucht. Dass sie mit den Figuren in der Kirche in Zusammenhang steht, zeichnet sich schon bald ab.
The Gathering ist ein Paradebeispiel für uninspiriertes, bloß plot-basiertes Filmemachen. Dabei ist die Idee für einen zweitklassigen Horrorfilm mal gar nicht schlecht: Ausgehend vom Fund einer im Erdboden verschütteten Kirche aus dem 1. Jahrhundert, entdeckt ein Forscher ein faszinierendes Phänomen: Die Konterfeis der in der Kirche bildhauerisch abgebildeten Figuren - sensationslüsterne Schauer der Kreuzigung - finden sich in allen möglichen Artefakten der Kunst und Kultur (und in jüngeren Jahren: der Medien). Die stets gleichen Gesichter beobachten die Pest, Atombombentests und sind auf Aufnahmen von rassistischen Pogromen zu sehen. Zunächst dazu parallel erzählt der Film die Geschichte einer jungen US-Amerikanerin im britischen Hinterland, die ihr Gedächtnis verloren hat und ihre Identität sucht. Dass sie mit den Figuren in der Kirche in Zusammenhang steht, zeichnet sich schon bald ab.Etwas mehr Wagemut, ein bißchen Lust an der Konventionslosigkeit und The Gathering hätte ein solider, wenn nicht sogar formidabler, kleiner Horrorfilm werden können. Er gibt sich aber auf allen Ebenen mit Mediokrität zufrieden und bleibt so, trotz einiger netter Momente, erschreckend lauwarm. Die Groschenromangeschichte ist sich selbst zufrieden und wird formal derart lustlos dargeboten, dass man den Machern dringend einen Berufswechsel nahelegen möchte. Nichts gegen lustvolle Trivialität, aber saft- und kraftlose wird hier nicht geduldet.
Und die Christina Ricci sollte sich mal überlegen, wie lange sie noch von ihrem Püppchen-Bonus zehren will. Ist ja geradezu schrecklich, was für Gurken die sich in den letzten Jahren in die Filmografie bugsiert hat.
web: imdb | mrqe | angelaufen.de | filmz.de
filmtagebuch: christina ricci | horror
° ° °
Thema: Filmtagebuch
15. Mai 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Mit The Punisher kehrt das US-Actionkino zu einzigartiger Güte zurück. Action, das bedeutet Bewegung, Actionkino, das bedeutet: Das Spektakel auf der Leinwand entspricht dem Spektakel vor der Kameralinse. THE PUNISHER nimmt das beim Wort: Autoachsen werden klanggewaltig überbelastet, Fahrzeuge werden nach allen Regeln der Kunst demoliert, was explodiert, ist danach auch jenseits des Films nurmehr schrottplatzreif: Von der Unverbindlichkeit computergenerierter Pixel, die sich gegenseitig neutralisieren, fehlt jede Spur. The Punisher ist Kino der Physis - und dabei nach Dutzenden von leblosen Actiongames-Filmen ein Labsaal für die Seele. Denn trotz aller Anachronismen in der Inszenierung (oder besser: trotz seines Aufgriffs anachronistischer Verfahren, die er aber zeitgemäß einzusetzen weiß) macht The Punisher auch unverhohlen Spaß: Jungskino der schönen Sorte.
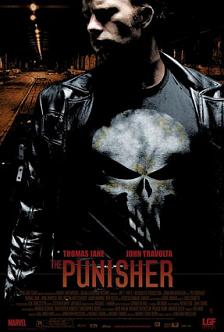 Die allgemein bekannte Story zeigt sich vor allem in der Gewichtung der Nachbarn des Punishers (Thomas Jane) von der späten "Welcome back, Frank"-Reihe inspiriert, ergänzt aber an einigen Stellen mit dramaturgischem Effekt: So muss Frank Castles gesammelte Familie, also auch entfernte Verwandte, in einer in Ausmaß und Inszenierung unglaublichen Vendetta-Aktion dran glauben, wenn Howard Saint (John Travolta) als hochrangiger Syndikatsverbrecher den Tod des eigenen Sohns rächt; der ließ sein Leben während eines FBI-Einsatzes, in dem Castle - so beginnt der Film - die Rolle des Maulwurfs übernommen hatte. Überhaupt stehen sich so nun zwei Rachegeschichten gegenüber, zwei Duellisten, die sich umkreisen und den Raum zwischen sich zunehmend verringern: Dem Noir-Szenario verleiht dies eine ungemeine Würze, der ohnehin graue Charakter des Punishers erfährt, nicht zuletzt auch durch seine spätere massive Trinksucht, deutlichere Ambivalenz, von der Legitimität seiner "Mission" ganz zu schweigen.
Die allgemein bekannte Story zeigt sich vor allem in der Gewichtung der Nachbarn des Punishers (Thomas Jane) von der späten "Welcome back, Frank"-Reihe inspiriert, ergänzt aber an einigen Stellen mit dramaturgischem Effekt: So muss Frank Castles gesammelte Familie, also auch entfernte Verwandte, in einer in Ausmaß und Inszenierung unglaublichen Vendetta-Aktion dran glauben, wenn Howard Saint (John Travolta) als hochrangiger Syndikatsverbrecher den Tod des eigenen Sohns rächt; der ließ sein Leben während eines FBI-Einsatzes, in dem Castle - so beginnt der Film - die Rolle des Maulwurfs übernommen hatte. Überhaupt stehen sich so nun zwei Rachegeschichten gegenüber, zwei Duellisten, die sich umkreisen und den Raum zwischen sich zunehmend verringern: Dem Noir-Szenario verleiht dies eine ungemeine Würze, der ohnehin graue Charakter des Punishers erfährt, nicht zuletzt auch durch seine spätere massive Trinksucht, deutlichere Ambivalenz, von der Legitimität seiner "Mission" ganz zu schweigen.
Wunderbar ist vor allem der souveräne Umgang des Films mit den vielen Traditionen, die er aufgreift, ohne aber diesen Aufgriff in den Fokus seiner Bemühungen zu nehmen: Seine Wurzeln liegen ästhetisch im Film Noir, die der Struktur der Erzählung im Western, die seiner Motive im urbanen Copthriller der 70er Jahre und die seiner Mittel im US-Actionkino der 80er Jahre - von Schwarzenegger über Dudikoff und Stallone. Doch um geekige spot-the-reference-Spiele geht es hier nicht, im Gegenteil zieht The Punisher aus diesen Wegbereitern lediglich das Beste, um es im eigenen Sinne anzuwenden. Dass er dabei seinen Selbstjustizkomplex weniger als soziopolitisches (und entsprechend faschistoides) Projekt, sondern eher als Pulp-Motiv in einem hermetischen Pulp-Universum ist dabei nur angenehm: Die Comicfigur des Punishers trat in den 70er Jahren zu einer Zeit in Erscheinung, als die populäre Kultur in den USA voll wahr mit ähnlich angelegten Figuren, die das Gesetz in die eigenen Hand nahmen. So kann man die Besetzung von Castles Vater mit einem gut gealterten Roy Scheider vielleicht auch als latente Anspielung auf French Connection (USA 1971; Kritik) wahrnehmen. Und an einer Stelle wird (zumindest im Originalton, in der Synchronisation wird dies wohl entfallen) mit einem entnommenen One-Liner eindeutig Brian de Palmas selbst schon artifiziell gehaltenes Selbstjustizepos Die Unbestechlichen (USA 1987) zitiert, eine Tötungssequenz erinnert zudem auf struktureller Ebene frappant an eine ähnliche Konstellation aus dem ersten Mad Max (Australien 1979). Auf politischer Ebene wird hier nichts eingeklagt, die Zeichen sprechen eine klare Sprache: Rache- und Selbstjustizthematiken stellen nach wie vor den Stoff für unterhaltsame, spannende Filme.
 Die bemerkenswerte Grimmigkeit, die The Punisher entwickelt, wird hie und da durch einen prächtig funktionierenden schwarzen Humor gebrochen. Allein die genüsslich lang dargebotene und ungemein einnehmend inszenierte Auseinandersetzung mit dem "Russen" ringt einem, trotz einiger drastischer Härten, einige Lacher ab, wenn im Parallelschnitt dazu die freakigen Nachbarn des Punishers zu italienischer Opernmusik durch die Küche tanzen - hier entwickeln sich beinahe schon Slapstickqualitäten. An diesen mag sich die derbe Gewalt zwar zum Teil reiben, doch behält der Film in diesen gelegentlichen Balance-Akten zwischen Noir-Düsternis und ironischem Possenspiel meist mühelos die Haltung.
Die bemerkenswerte Grimmigkeit, die The Punisher entwickelt, wird hie und da durch einen prächtig funktionierenden schwarzen Humor gebrochen. Allein die genüsslich lang dargebotene und ungemein einnehmend inszenierte Auseinandersetzung mit dem "Russen" ringt einem, trotz einiger drastischer Härten, einige Lacher ab, wenn im Parallelschnitt dazu die freakigen Nachbarn des Punishers zu italienischer Opernmusik durch die Küche tanzen - hier entwickeln sich beinahe schon Slapstickqualitäten. An diesen mag sich die derbe Gewalt zwar zum Teil reiben, doch behält der Film in diesen gelegentlichen Balance-Akten zwischen Noir-Düsternis und ironischem Possenspiel meist mühelos die Haltung.
Natürlich herrscht nicht nur eitel Sonnenschein. Sicher lässt sich unter anderem anmerken, dass John Travoltas Verkörperung von Howard Saint zuweilen etwas blass bleibt. Dass manche pathetische Szenen in ihrer unironischen Auflösung beinahe schon wieder (unfreiwillig) ironisch gebrochen wirken und dass manche Auftritte des Punishers, vor allem seine Anhänglichkeit an das Shirt mit dem bekannten Motiv, zuweilen etwas kindisches umgibt, ebenso. Doch was soll's, geschenkt: The Punisher ist den überwältigenden Teil seiner Spielzeit ganz formidables Kino des Spektakels, mit einem angenehm ernstgenommenen Plot und genügend eye candy, um das nur staunen wollende Filmgeek-Kind im Innern des alles durchschauenden Filmsouveräns mit links wieder zum Leben zu erwecken. Und dieses freut sich schon jetzt auf das unausweichliche Sequel, auf ein hoffentlich noch krachigeres, düstereres und lauteres.
Ab 10. Juni im Kino.
The Punisher (USA 2004)
Regie: Jonathan Hensleigh; Drehbuch: J.Hensleigh, Michael France; Kamera: Conrad W. Hall; Schnitt: Steven Kemper; Darsteller: Thomas Jane, John Travolta, Laura Harring, Omar Avila, James Carpinello, Mark Collie, Russ Comegys, Antoni Corone, Rick Elmhurst, Ben Foster, Michael Reardon, u.a.
mrqe | filmz.de
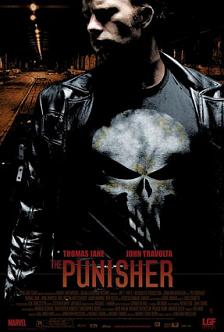 Die allgemein bekannte Story zeigt sich vor allem in der Gewichtung der Nachbarn des Punishers (Thomas Jane) von der späten "Welcome back, Frank"-Reihe inspiriert, ergänzt aber an einigen Stellen mit dramaturgischem Effekt: So muss Frank Castles gesammelte Familie, also auch entfernte Verwandte, in einer in Ausmaß und Inszenierung unglaublichen Vendetta-Aktion dran glauben, wenn Howard Saint (John Travolta) als hochrangiger Syndikatsverbrecher den Tod des eigenen Sohns rächt; der ließ sein Leben während eines FBI-Einsatzes, in dem Castle - so beginnt der Film - die Rolle des Maulwurfs übernommen hatte. Überhaupt stehen sich so nun zwei Rachegeschichten gegenüber, zwei Duellisten, die sich umkreisen und den Raum zwischen sich zunehmend verringern: Dem Noir-Szenario verleiht dies eine ungemeine Würze, der ohnehin graue Charakter des Punishers erfährt, nicht zuletzt auch durch seine spätere massive Trinksucht, deutlichere Ambivalenz, von der Legitimität seiner "Mission" ganz zu schweigen.
Die allgemein bekannte Story zeigt sich vor allem in der Gewichtung der Nachbarn des Punishers (Thomas Jane) von der späten "Welcome back, Frank"-Reihe inspiriert, ergänzt aber an einigen Stellen mit dramaturgischem Effekt: So muss Frank Castles gesammelte Familie, also auch entfernte Verwandte, in einer in Ausmaß und Inszenierung unglaublichen Vendetta-Aktion dran glauben, wenn Howard Saint (John Travolta) als hochrangiger Syndikatsverbrecher den Tod des eigenen Sohns rächt; der ließ sein Leben während eines FBI-Einsatzes, in dem Castle - so beginnt der Film - die Rolle des Maulwurfs übernommen hatte. Überhaupt stehen sich so nun zwei Rachegeschichten gegenüber, zwei Duellisten, die sich umkreisen und den Raum zwischen sich zunehmend verringern: Dem Noir-Szenario verleiht dies eine ungemeine Würze, der ohnehin graue Charakter des Punishers erfährt, nicht zuletzt auch durch seine spätere massive Trinksucht, deutlichere Ambivalenz, von der Legitimität seiner "Mission" ganz zu schweigen.Wunderbar ist vor allem der souveräne Umgang des Films mit den vielen Traditionen, die er aufgreift, ohne aber diesen Aufgriff in den Fokus seiner Bemühungen zu nehmen: Seine Wurzeln liegen ästhetisch im Film Noir, die der Struktur der Erzählung im Western, die seiner Motive im urbanen Copthriller der 70er Jahre und die seiner Mittel im US-Actionkino der 80er Jahre - von Schwarzenegger über Dudikoff und Stallone. Doch um geekige spot-the-reference-Spiele geht es hier nicht, im Gegenteil zieht The Punisher aus diesen Wegbereitern lediglich das Beste, um es im eigenen Sinne anzuwenden. Dass er dabei seinen Selbstjustizkomplex weniger als soziopolitisches (und entsprechend faschistoides) Projekt, sondern eher als Pulp-Motiv in einem hermetischen Pulp-Universum ist dabei nur angenehm: Die Comicfigur des Punishers trat in den 70er Jahren zu einer Zeit in Erscheinung, als die populäre Kultur in den USA voll wahr mit ähnlich angelegten Figuren, die das Gesetz in die eigenen Hand nahmen. So kann man die Besetzung von Castles Vater mit einem gut gealterten Roy Scheider vielleicht auch als latente Anspielung auf French Connection (USA 1971; Kritik) wahrnehmen. Und an einer Stelle wird (zumindest im Originalton, in der Synchronisation wird dies wohl entfallen) mit einem entnommenen One-Liner eindeutig Brian de Palmas selbst schon artifiziell gehaltenes Selbstjustizepos Die Unbestechlichen (USA 1987) zitiert, eine Tötungssequenz erinnert zudem auf struktureller Ebene frappant an eine ähnliche Konstellation aus dem ersten Mad Max (Australien 1979). Auf politischer Ebene wird hier nichts eingeklagt, die Zeichen sprechen eine klare Sprache: Rache- und Selbstjustizthematiken stellen nach wie vor den Stoff für unterhaltsame, spannende Filme.
 Die bemerkenswerte Grimmigkeit, die The Punisher entwickelt, wird hie und da durch einen prächtig funktionierenden schwarzen Humor gebrochen. Allein die genüsslich lang dargebotene und ungemein einnehmend inszenierte Auseinandersetzung mit dem "Russen" ringt einem, trotz einiger drastischer Härten, einige Lacher ab, wenn im Parallelschnitt dazu die freakigen Nachbarn des Punishers zu italienischer Opernmusik durch die Küche tanzen - hier entwickeln sich beinahe schon Slapstickqualitäten. An diesen mag sich die derbe Gewalt zwar zum Teil reiben, doch behält der Film in diesen gelegentlichen Balance-Akten zwischen Noir-Düsternis und ironischem Possenspiel meist mühelos die Haltung.
Die bemerkenswerte Grimmigkeit, die The Punisher entwickelt, wird hie und da durch einen prächtig funktionierenden schwarzen Humor gebrochen. Allein die genüsslich lang dargebotene und ungemein einnehmend inszenierte Auseinandersetzung mit dem "Russen" ringt einem, trotz einiger drastischer Härten, einige Lacher ab, wenn im Parallelschnitt dazu die freakigen Nachbarn des Punishers zu italienischer Opernmusik durch die Küche tanzen - hier entwickeln sich beinahe schon Slapstickqualitäten. An diesen mag sich die derbe Gewalt zwar zum Teil reiben, doch behält der Film in diesen gelegentlichen Balance-Akten zwischen Noir-Düsternis und ironischem Possenspiel meist mühelos die Haltung.Natürlich herrscht nicht nur eitel Sonnenschein. Sicher lässt sich unter anderem anmerken, dass John Travoltas Verkörperung von Howard Saint zuweilen etwas blass bleibt. Dass manche pathetische Szenen in ihrer unironischen Auflösung beinahe schon wieder (unfreiwillig) ironisch gebrochen wirken und dass manche Auftritte des Punishers, vor allem seine Anhänglichkeit an das Shirt mit dem bekannten Motiv, zuweilen etwas kindisches umgibt, ebenso. Doch was soll's, geschenkt: The Punisher ist den überwältigenden Teil seiner Spielzeit ganz formidables Kino des Spektakels, mit einem angenehm ernstgenommenen Plot und genügend eye candy, um das nur staunen wollende Filmgeek-Kind im Innern des alles durchschauenden Filmsouveräns mit links wieder zum Leben zu erwecken. Und dieses freut sich schon jetzt auf das unausweichliche Sequel, auf ein hoffentlich noch krachigeres, düstereres und lauteres.
Ab 10. Juni im Kino.
The Punisher (USA 2004)
Regie: Jonathan Hensleigh; Drehbuch: J.Hensleigh, Michael France; Kamera: Conrad W. Hall; Schnitt: Steven Kemper; Darsteller: Thomas Jane, John Travolta, Laura Harring, Omar Avila, James Carpinello, Mark Collie, Russ Comegys, Antoni Corone, Rick Elmhurst, Ben Foster, Michael Reardon, u.a.
mrqe | filmz.de
° ° °
lol