Thema: Berlinale 2004
12. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
 Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.
Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.Gelassen, oft beinahe schon kühl - manche Einstellungen scheinen gar die Perspektive von in Deckenecken angebrachten Überwachsungskameras zu simulieren - , protokolliert der Film das Ende einer Beziehung. Das ist wörtlich zu nehmen: Gescheitert war man schon weit, vermutlich Jahre früher, hier nun aber geht es, mit wenigen Ausnahmen: kammerspielartig, in einer Berliner Ikea-Wohnung mit twen-haftem Bildungsbürgerkolorit, nur noch um die letzten Stunden. Um jene Momente, in denen über Jahre entstandene Geschwulste und Versteifungen sich nochmals miteinander verkanten und das sukzessive über die Jahre hinweg vollzogene Scheitern - an dem Anderen, am eigenen Leben, an Vorstellungen, Erwartungshaltungen und Ängsten - sich einmal noch geballt schmerzlich spürbar werden lässt. Auch und gerade für den Zuschauer, der, insofern sich auf die besondere Form des Films eingelassen werden kann, oft selbst nicht anders kann, als sich voller Unbehagen im Sessel zu winden.
 Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.
Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.Ein Film vor allem auch über Räume und deren Beziehungen zueinander. Wie man als Einzelner nicht in zwei abgeschlossenen Räumen gleichzeitig sein kann. Zu Beginn ist sie (Anne Ratte-Polle) auf dem Balkon, draußen, von drinnen gefilmt, tritt dann ein zu ihm (Frank Giering), der auf der Couch liegt und liest, wie immer eigentlich. Nebenan ist das kleine Kind im Wagen und schläft. Bald schon treten die Eltern ein, sie kommen zu Besuch, verschwinden sogleich auch wieder: Auch hier Verknöcherung. Später dann geht sie zur Disco, ist weg, er bleibt zurück, verzweifelt wartend. Zur Disco hin fährt sie in einem Auto, ein Kokon, durch dessen Sichtfenster die Lichter der Großstadt nur Flecken bleiben, die Tropfen außen auf der Scheibe scheinen Tränen zu ähneln, die der Scheibenwischer hastig verdrängt. Dann später wieder tritt sie ein, es kommt erneut zum Streit, er verweist sie im Affekt der Wohnung, sie kehrt mit ihrem Lover zurück: Ein einzigartiger Moment ist das, wenn er, der Gatte, dessen Perspektive über weite Strecken geteilt wird, sich des Raumes sicher scheint, er offensichtlich auch sicher ist, bis dann aber die Kamera, mit einem einzigen Schwenk der Kamera, den Hinterkopf des Lovers anschneidet, der in dieses Kabinett des Beziehungsschreckens eingedrungen ist und einen Raum weiter steht. Bald steht er im Hausflur, das Kind nebenan im Raum beginnt zu schreien, erhält dann, endlich, ein Gesicht: Es steht im Raum nun, ist bei der Mutter, die sich nun die Frage stellt, ob den Raum zu verlassen wirklich die rechte Lösung ist, zumal, wie sich andeutet, auch der nächste Raum, der des Lovers, allenfalls ein gleiches Gefängnis scheint. Alle drei scheinen zu zerfallen, sind selber Räume, hermetisch abgeschlossene, zur Kommunikation nicht fähig: Solipsismus.
Von Beginn an ein großartiger Film, der das Publikum wohl spalten wird. Die Presse ist bereits gespalten: Bei der morgendlichen Vorführung im Berlinale-Palast für die Journalisten herrschte zum Teil ausgelassene Heiterkeit über den bewusst (und effektiv) hölzernen Stil des Films, despektierliche Auslassungen hagelte es bisweilen im Minutentakt. Kein leichter Film, gewiss. Aber die Überheblichkeit, mit der sich darüber ausgelassen wird, korrespondiert, zumindest in diesem Falle, offensichtlich auch mit der bornierten Dummheit oder aber dem ausgeprägten Zynismus des, mit Verlaub, Geschmeißes.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbwerb. Zudem ab 19. Februar im Kino.
>> Die Nacht singt ihre Lieder (Deutschland 2004)
>> Regie: Romuald Karmakar
>> Drehbuch: Martin Rosefeld (Theaterstück: Jon Fosse)
>> Darsteller: Anne Ratte-Polle, Frank Giering, Manfred Zapatka, u.a.
imdb | offizielle Site | filmz.de | angelaufen.de
° ° °
Thema: Berlinale 2004
 Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht.
Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht. Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren.
Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren. Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.
Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.Es gibt nicht viel zu berichten. Ähnlich wie Mein Essen mit André, ebenfalls ein nahezu reiner Dialogfilm, ist hier die Devise: Nicht lesen, sondern selber sehen! Oder aber, um Ekkehard Knörer zu zitieren, der in seiner Kritik einen mir unbekannten Schweizer Kollegen zitiert, der, wie der Film, schlicht und effizient alles auf den Punkt gebracht hat: "S'isch e wundrbare Film." Ganz genau!
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb.
>> Before Sunset (USA 2004)
>> Regie: Richard Linklater
>> Drehbuch: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke
>> Darsteller: Julie Delpy, Ethan Hawke
imdb
° ° °
Thema: Berlinale 2004
11. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren
 Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)
Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)Ein Geniestreich die Besetzung Bob Dylans als Bewunderer Billy the Kids. Nachdem sich Kid in denkbar cooler Weise selbstständig aus seiner Gefangenschaft befreit, schließt sich Dylan dem Outlaw an. Ein Geniestreich auch die Entscheidung, den Soundtrack mit Dylans Musik zu bestreiten. Das verleiht der Geschichte zusätzliche Bedeutung als melancholischer Abgesang auf die gute alte Zeit, so sieht das Peckinpah zumindest, in der man zwar beim Whiskysaufen eingegrabenen Hähnen die Köpfe wegschoß, aber ansonsten einem moralischen Kodex verhaftet seinen Mann stand. Damit ist es vorbei, wenn Pat Garrett dem Auftrag schmieriger Geschäftsleute folgt und the Kid exekutiert. Peckinpahs Film hat nicht ganz das Format von "The Wild Bunch", ist dennoch Großes Kino mit unvergesslichen Szenen. Der Film wurde bei seiner Veröfentlichung drastisch gekürzt, Peckinpah hat Zeter und Mordio geschrien. In der Retrsopektive läuft die ursprüngliche, knapp 20 Minuten längere Fassung. Trotz der furchtbar zugerichteten Tonspur: unbedingt ansehen.
Retrospektive: The Outfit (USA 1973/74, John Flynn)
Robert Duvall in seiner ersten Hauptrolle, Karen Black an seiner Seite. Die Vorlage: Richard Starks alias Donald E. Westlakes Roman, an dessen Fiktion sich bereits John Boorman (Point Blank) und Jean-Luc Godard (Made in U.S.A) versucht haben, mit großem Erfolg. John Flynns Film will knallharter Neo-Noir Stoff sein, direkt, erbarmungslos, mit knappen Dialogen den Zynismus der Figuren auf den Punkt bringend. Der Film ist nicht frei von unfreiwilliger Komik, das Drehbuch vergallopiert sich in seinem Ansatz zusehends. Dennoch sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, kompromisslos.
Retrospektive: Shampoo (USA 1974/75, Hal Ashby)
Die Geschichte vom rammelnden Starfriseur in Beverly Hills, verdichtet in seiner Struktur - der Film spielt am Wahlabend des 5.November 1968, als Nixon an die Macht kam - ist mehr noch als Ashbys The Last Detail sarkastischer Geselschaftskommentar, beinahe schon Sittengemälde. Obwohl Shampoo bekannter ist, funktioniert meiner Meinung nach das Prinzip der Entlarvung nicht annähernd so gut wie in The Last Detail. Auch hier gibt es zwar unfassbar witzige Momente, speziell in der Charakterisierung des Friseurs, gespielt von Warren Beautty, die Geschichte ist jedoch in seiner Dramaturgie bereits stärker dem Mainstream Kino verhaftet, markiert bereits deutlich eine Abkehr vom klassischen New Hollywood. Es werden neu entstandene Erwartungshaltungen bedient, der Held, auch wenn es am Ende für ihn kein Happy End gibt, durchläuft eine Entwicklung, die ihn neugeboren aus der Handlung hervorgehen läßt. Das verweist bereits sehr stark auf die heute bis zum Exzess durchgehechelte Odyssee des Helden.
Thomas Reuthebuch
° ° °
Thema: Berlinale 2004
11. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren
 Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.
Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.Bis dorthin sind die Szenen von einer permanent spürbaren unterschwelligen Bedrohung geprägt, bis in die friedlich anmutende Szene hinein, in der Yeo-Jins Vater sich liebevoll um seine schlafende Tochter bemüht. Am Frühstückstisch genügen dem Film zwei knappe Sätze, um die der Kleinfamilie innewohnende Tragik, die Mutter ist kürzlich verstorben, und den beruflichen Background des Vaters, er ist Kriminalbeamter, zu umreißen.
Die Inszenierung schreitet in klaren Schritten ihre Handlung ab, der Soundtrack konterkariert die Unaufhaltsamkeit der Tragödie mit melancholischer Musik. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis sich die Befürchtungen des Zuschauers um die Figuren einlösen werden, und wenn Jae-Young sich nach dem Sturz in ihrem Blut krümmt, hat das eine Intensität, die nur schwer auszuhalten ist. Man glaubt zu wissen, besonders wenn man die bisherigen Filme Kim Ki Duks kennt, ohin das fhren wird.
Allerdings, in zunehmenden Maße kippen die bei "The Isle" oder auch dem später entstandenen "Bad Guy" noch so verstörend-poetischen Bilder ins Groteske, etwa wenn ein vom Vater in den Freitod getriebener Freier auf dem Boden aufschlägt, im Off, und sein auf dem Asphalt verspritztes Hirn langsam ins Bild fließt. Auch wenn der Film am Ende, in den letzten Szenen, nachdem Vater und Tochter gemeinsam das Grab der verstorbenen Ehefrau/Mutter aufsuchen, noch einmal auf eine transzendentale Ebene zurückfindet, wird der Verdacht bald zur Gewissheit.
Kim Ki Duk hat sich in seinem selbst erschaffenen Universum assoziativer Bildverästelung abgearbeitet. Samaria ist, vor allem wenn man die großartigen Arbeiten seines Regisseurs in den letzten Jahre in Betracht zieht, eine Enttäuschung. Vielleicht sogar die größte Enttäuschung des Festivals, bislang.
Thomas Reuthebuch
° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren
 Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation.
Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation. Jerry Schatzbergs Film landete in der Retrospektive in einer komplett neu restaurierten Fassung, ein Glücksfall für das Publikum, wirkten beim komplizierten Color Matching auch der Regisseur selbst und sein Kameramann Adam Holender mit. Die frisch gezogene Kopie trägt damit in nicht unerheblichem Maße zu einer atemberaubenden Zeitreise bei, die uns die Möglichkeit eröffnet, Schatzbergs dem Cinema Verite verhafteten Film in einer Art und Weise wiederzuentdecken, die an das ursprüngliche Kinoerlebnis im Jahr 1971 heranreicht.
Die bedrückende Authentizität des Films zerstreut jedoch sehr schnell die Freude am ästhetischen Genuß, zieht den Zuschauer mit unwiederstehlicher Sogwirkung in seine Geschichte, die sich ausschließlich in einem klar abgesteckten Rahmen abspielt, an der 72.ten Ecke Broadway, eben am titelgebenden "Needle Park", einem Drogenumschlagplatz für Manhattans Junkieszene.
Kitty Winn gewann zwar den Oscar für die beste Hauptrolle, es ist aber Al Pacino, der den Film unvergesslich werden läßt. Er spielt den Hustler Bobby, manisch, immer in Bewegung, eine faszinierend anzusehende Demonstration von der Technik des Method Acing beeinflusster Schauspielkunst. Es war seine erste große Rolle und man findet bereits hier all das wieder, was ihn zu einem der größten Filmschauspieler unserer Zeit werden ließ.
Schatzbergs Inszenierungsstil, kühl, kontrolliert, die unbarmherzige Umgebung in schäbige Farben gießend, zeigt uns ein New York, in das kein Tageslicht zu dringen scheint. Es ist ein langer Weg von der verbrähmten Drogenromantik der 60er Jahre bis hierhin, die Diskrepanz zu "Easy Rider" etwa könnte kaum größer sein.
Der erbarmungslos anmutenden Montagetechnik, die in abrupten Schnitten die Entwicklungsstufen der Protagonisten hart aneinanderreiht, kommt gesteigerte Bedeutung zu. Als Pacino einen Kurierjob erledigt, reicht die Andeutung eines Polizisten, der sich aus dem Schatten einer Häuserwand löst. In der nächsten Einstellung finden wir ihn unter der Dusche im Knast, mit anderen Inhaftierten scherzend, voll in seinem Element. Nächste Einstellung: Pacino tritt in die Freiheit, läuft an einer trostlosen Häuserzeile entlang. Hinter ihm taucht Helen auf, die ihn verraten hat. Sie will wissen, ob er nachtragend sei. Pacino entgegnet: "Well". Sie schließt zu ihm auf. Die beiden gehen nebeneinander, ohne sich anzusehen. Schnitt. Schwarzblende. Abspann. Keine Musik, kein Geräusch im Kinosaal. So macht man das.
Thomas Reuthebuch
° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thomas.reuthebuch | 0 Kommentare | Kommentieren
 Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn.
Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn. Ashby entwickelt aus dieser Prämisse mit Drehbuchautor Robert Towne eine bitterböse Satire mit einem überragenden Jack Nicholson, in deren Kern nicht nur die erfolgreiche Überführung alberner Militärromantik steht, sondern darüber hinaus nicht weniger als eine treffsichere und schließlich ergreifende Studie ausweglos erscheinender, sich aus Angst und Hilflosigkeit speisender Ohnmacht. Das darf man sich nun nicht etwa als Sozialstudie vorstellen sondern als, in seiner glasklaren Struktur am ehesten an eine mythologische Reise erinnerndes Road Movie. Dabei zeichnet sich Ashbys Inszenierung immer wieder durch seine genaue Beobachtung und dessen Fähigkeit zur Überführung ins Groteske aus.
Bereits der bierernste Aufbruch der drei aus dem Stützpunkt in einer lächerlich anmutenden Rostlaube, begleitet von schmissiger Militärmusik, bietet einen Vorgeschmack dieses durchgängigen Prinzips. Das Drehbuch schließlich bietet in seiner intelligenten Durchdeklinierung der sich ständig verändernden Dreierkonstellation jede Menge Fleisch für Ashbys Inszenierungsstil. Jack Nicholson ist dabei stets Verbündeter des Regisseurs als auch Dreh- und Angelpunkt der Dramaturgie innerhalb der Sequenzen, die den Film, respektive die Reise, in schöner Regelmäßigkeit in einzelne, sich am Ende immer weiter verdichtende Episoden auffächert.
Am beeindruckendsten sicherlich die bedrückende Darstellung der bereits angesprochenen Ausweglosigkeit Budduskys. Auch wenn der Film immer wieder Situationen herstellt, die man in Ermangelung eines treffenden deutschen Begriffs am ehesten mit "deadpan humor" umschreiben kann, verweisen die Figuren in ihrem offensichtlich ungebrochenen Obrigkeitsdenken und dem daraus resultierenden fehlendem Bewußtsein, geradezu exemplarisch auf die tiefgreifende verheerende Wirkung, die sich für das rückwärtsgewandte Individuum in einer sich ständig erneuernden Gesellschaft ergibt.
Das spannende an "The Last Detail" ist denn auch die Perspektive, Budduskys Perspektive, eines Verlierers, der intellektuell von den Veränderungen überfordert ist, emotional dieser Überforderung mit Aggression begegnet, der aber dennoch von Ashby niemals vorgeführt wird. Das ist schon ein Kunststück, speziell wenn man sich vor Augen führt, wie weit der Film in der Darstellung der Erbärmlichkeit seiner Figuren geht. Wenn sich die drei etwa in einem Stundenhotel hemmungslos besaufen, demonstriert Buddusky stolz seine "Kunst", die des "Signalmans", eine wenig elaborierte Aneinanderreihung einfachster Bewegungsabläufe, die selbst Meadows wenig später problemlos imitieren kann. Bei einer Hippieparty, in der Ashby mit unverhohlener Ironie die Erlösungshoffnungen der amerikanischen Jugend in fernöstliche Religionen persifliert, versucht der jodelnd-balzende Buddusky bei einem Mädchen (Nancy Allen) mit seiner lächerlich-kitschigen Masche vom harten Leben auf der See zu landen.
"The Last Detail" vermittelt durch die Ziellosigkeit seiner Figuren auch ein Gefühl für die anonyme Ödnis der USA, für die Austauschbarkeit seiner urbanen Landschaften, die endlos sich hinziehende Langeweile an den Ausfallstraßen der Großstädte. Jack Nicholson erhielt für seine aggressive, energiegeladene, dann wieder zart und einfühlsam angelegte Rolle die Goldene Palme beim Filmfestival von Cannes. Für den Oscar als bester Hauptdarsteller war er genauso nominiert wie Randy Quaid als bester Nebendarsteller und Robert Towne für das beste Originaldrehbuch.
Thomas Reuthebuch
° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
 Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.
Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.In den 20er Jahren finden sich in einem gutbürgerlichen Landhaus im Berliner Umland, weil die Eltern verreist sind, für ein ausgedehntes Wochenende die beiden Geschwister Guenter (August Diehl) und Hilde (Anna Maria Mühe) und der eher verarmte Dichter Paul (Daniel Brühl) ein. Nach etwas romantischer Schwärmerei steht fest: Paul und Guenter gründen einen Selbstmörderclub, dessen Mitglieder sich richten, sobald die Liebe sie verlassen hat. Am Abend finden sich weitere Freunde und Bekannte zu einer ausgelassenen Party ein. Ökonomien fordern ihren Tribut: Guenter liebt Hans, mit dem err mal was hatte, der hat aber nun was mit Hilde, die mit allen anderen auch was hat und in die aber Paul verliebt ist. Zwei Tage später sind Tote zu beklagen. Basierend auf einer wahren Geschichte.
 Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.
Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.Dass der Film sich letztendlich nur in solchem Einerlei ergießen wird, steht als Drohung schon von Anbeginn im Raume, wenn man sich, neben all dem eh schon Ärgerlichen der ästhetischen wie narrativen Auflösung, das da folgen mag, auch noch mit einem der unelegantesten Kniffe der Dramaturgie beginnen lässt: Der inhaftierte Paul sitzt in der Wache, eine Art Testament wird verlesen, kurzer Blick auf die Medienberichterstattung der Ereignisse, dann Verhör und Paul verschwindet aus dem Bild, ins Off, von wo aus er seine illustrierten Erinnerungen an die letzten Tage kommentiert. Warum dieses bornierte Element deutschen Geschichtchen-Erzählkinos aus den Köpfen der Drehbuchautoren nicht rauszukriegen ist, bleibt auch bis auf weiteres zu fragen. Es funktioniert nur selten, meist nie, und ist mindestens ebenso häufig schlicht nicht notwendig. Und auch Was nützt die Liebe in Gedanken?" kann aus dieser Exposition kein Kapital schlagen, steht sich dadurch dramaturgisch eigentlich schon im Weg: Wer nun den Freitod wählen wird und wer nicht, ist somit nicht mehr von Belang, für die nächste Frage - Wie konnte es nur soweit kommen? - gibt der Film schlicht zu wenig her.
Bleibt einmal mehr die Erkenntnis: Auch ein auf hohem technischen Niveau an die Wand gefahrener Wagen wird in der Statistik lediglich als Versicherungsfall aufgeführt.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Panorama. Ab 12.02. zudem regulär im Kino.
Was nützt die Liebe in Gedanken? (Achim von Borries, Deutschland 2004)
Regie: Achim von Borries; Drehbuch: Achim von Borries, Hendrik Handloegten, Annette Hess, Alexander Pfeuffer; Darsteller: August Diehl, Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske, u.a.
Regie: Achim von Borries; Drehbuch: Achim von Borries, Hendrik Handloegten, Annette Hess, Alexander Pfeuffer; Darsteller: August Diehl, Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske, u.a.
imdb | offizielle Site
° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Ein schöner, bald schon alltäglicher Brauch: Der Griff vor einer Retrospektive-Vorführung zum Auslagentisch, wo sich Kopien zeitgenössischer Kritiken zum nächsten Film finden lassen, eine deutsche aus dem Feuilleton und eine englische aus einer Fachzeitschrift zumeist.
Schön ist da, wie nun gerade entdeckt, dass es diese Kritikenretrospektive komplett auch zum hier zum Download gibt, beim Filmmuseum Berlin, das für die Retrospektive mitverantwortlich zeichnet.
Zwar etwas mühsig nur als einzelne pdf-Dateien, aber immerhin.
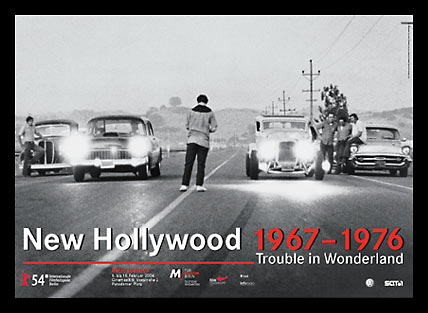
Schön ist da, wie nun gerade entdeckt, dass es diese Kritikenretrospektive komplett auch zum hier zum Download gibt, beim Filmmuseum Berlin, das für die Retrospektive mitverantwortlich zeichnet.
Zwar etwas mühsig nur als einzelne pdf-Dateien, aber immerhin.
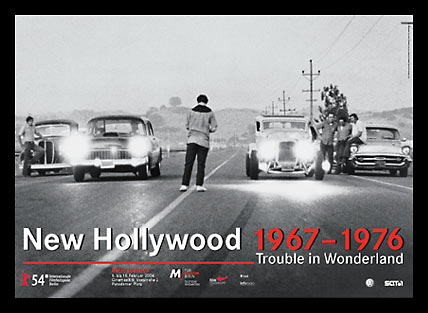
° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Ich gebe gerne zu: Manchmal, wenn etwas Zeit zwischen zwei Filmen ist, schlendere ich gerne ganz bewusst zu diesem Plakat hier, das vor dem Hyatt Hotel zu sehen ist. Dort natürlich großformatig und mit dem englischen Titel Nightsongs versehen, was das schlicht atemberaubend wunderschöne Bild nicht ganz so zukleistert.


° ° °
Thema: Berlinale 2004
10. Februar 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
 Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.
Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.Der Kritiker hats schwer auf einem Festival: Einerseits ist man ja Filmenthusiast wie jeder ander auch und will soviel wie möglich sehen. Andererseits muss man sich seinen Akkreditierungspass auch irgendwie rechtfertigen und was schreiben - nach Möglichkeit auch Sinnvolles -, seinen Lesern fühlt man sich schließlich auch irgendwie verpflichtet. Aber wer steht schon gerne eine Stunde lang vor dem Writing Room an, wenn währenddessen in der Retrospektive doch gerade ein unheimlich wichtiger Film läuft? Und dann will einem auch nicht zu jedem Film was einfallen, was niederzuschreiben wert wäre, die Zeit ist zudem begrenzt, die Sinne von zwischen drei bis fünf Filmen täglich eh schon überlastet, der Biorhythmus hoffnungslos im Eimer. Also sortiert man aus, schweren Herzens oft: Vieles bleibt liegen.
Deswegen nun: Short Cuts, in loser Folge. Kurze Eindrücke, ehrliche Eingeständnisse, wenn man überfordert war, Notizen, die es nicht zur Kritik gebracht haben.
The Last Detail (Retrospektive; Hal Asbhy, USA 1973) ist ein entspanntes Roadmovie mit satirischen Untertönen. Sehr laid-back und smooth, könnte man sagen, ideal jedenfalls für ein Matinée (und er lief auch morgens um 11): In den Sessel kuscheln und den Episoden einfach beim Plätschern zusehen. Schön, wenn Filme ihr eigentliches Anliegen - erste Szenen im Militärbunker, letzte Szenen im Militärknast - so ansprechend verstecken, ohne aber es zu leugnen. Dieser Kontrast macht auch in der Narration Sinn: Das eigentlich Schreckliche blenden wir aus, um das Schreckliche damit infolge nur noch schrecklicher zu machen. Sicherlich keine der größten Leistungen der Retrospektive, aber immerhin doch sehr charming und obendrein war die Kopie auch in recht guter Qualität (eine der 15 neugezogenen?). imdb
Weit weniger gut war die Qualität der Kopie von The Cool World (Retrospektive; USA 1964) von Shirley Clarke: Sehr unscharfe, eigentlich schon milchige Bilder mit ordentlich Laufstreifen und ähnlichem, kratziger Ton wie von alten Shellackplatten. Das ist ein Problem für den Film, der viel mit Reißschwenks, dynamischem Schnitt und hektischer Jazzmusik arbeitet. Folge deshalb: Nach gut einer Stunde pochende Kopfschmerzen. Trotzdem meine ich, Qualitäten erkannt zu haben: In der Montage kreuzt die Regisseurin dokumentarische Aufnahmen vom Straßenleben Harlems mit denen ihrer fiktiven Narration, von ein paar jugendlichen Schwarzen, die, beeindruckt von den cats, den coolen Gangstern, ebenfalls eine Karriere als Kriminelle einschlagen wollen, daran aber letztendlich, ähnlich wie im Verlauf die Vorbilder, scheitern. Es entsteht ein Patchwork aus Milieuschilderung, Zeitdokument und Krimi, das nicht ohne Reiz ist. Vielleicht sogar ähnlich wichtig wie Melvin van Peebles' Sweet Sweetback's Baaaadaaaasss Song? Angemerkt sei, dass der Film etwas zu alt ist für eine Retro, die sich auf die Jahre zwischen '67 und '76 konzentriert, ist mir nur gerade noch aufgefallen, aber egal. imdb
Nur wenige Jahre später entstanden und, wenn ich das jetzt richtig überblicke, in einer ähnlichen Ecke New Yorks angesiedelt wie auch der großartige David Holzman's Diary: The Panic in Needle Park (Retrospektive; Jerry Schatzberg, USA 1971). Die Konsequenz der Milieu- und auch Elendsschilderung ähnelt bisweilen sogar Clarkes Film, zumindest aber ist auch in diesem (Anti-)Drogenfilm ganz schön viel ganz schön schmutzig. Die Materialästhetik unterstreicht dies, trotz neugezogener Kopie, zudem: Selten war Fixen im Kino schmuddeliger anzusehen. Die Größe des Films besteht dann allerdings darin, dass er sich trotzdem an diese Menschen ranwagt, ganz dicht oft sogar, alles akribisch festhält, nie aber in den Duktus der moralischen Empörung verfällt (oder aber: sein Thema glorifiziert). Ein zutiefst menschlicher Film, der, zum Glück, dennoch nicht menschelt. Und wie er am abrupten Ende dann sowohl Hoffnung als auch Defätismus in ein Bild, in einen kurzen Moment packt, das ist ebenfalls sehr groß. Bei der Sichtung leider recht müde gewesen, deswegen war er hier und da etwas lang - eine erneute solche unter besseren Bedingungen meinerseits wird sich hiermit vorgenommen. imdb
° ° °
lol