Thema: Filmtagebuch
31. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
30.12.2003, Cubix Alexanderplatz
Man hat auch schon bessere Hommagen an Filme vergangener Dekaden gesehen. Vielleicht lag's aber auch nur daran, dass die Ära von Rock Hudson und Doris Day nicht unbedingt zu meinen Spezialgebieten gehört, wenngleich ich mich daran erinnern kann, in meinen ersten bewusst wahrgenommenen Lebensjahren einige dieser Filme im TV gesehen zu haben. Wie auch immer: Ein zwiespältiges Filmerlebnis.
 Gewiss, die Optik ist zum Teil großartig: Bonbonfarbene Kostüme, der wunderbare Vorspann von Asylum, der (die?) auch schon den recht ähnlichen Titel zu Spielbergs Catch me if you can (USA 2002) gestaltete, die direkt aus den referierten Filmen herausgeklaubten Rückprojektionen während der Autofahrten, wie natürlich der absolute Overkill an stylishen Interieurs verwöhnen das Auge in einer Weise, wie man es sich eigentlich von Spielbergs recht fußlahmer juveniler Hetzjagd erwartet hatte.
Gewiss, die Optik ist zum Teil großartig: Bonbonfarbene Kostüme, der wunderbare Vorspann von Asylum, der (die?) auch schon den recht ähnlichen Titel zu Spielbergs Catch me if you can (USA 2002) gestaltete, die direkt aus den referierten Filmen herausgeklaubten Rückprojektionen während der Autofahrten, wie natürlich der absolute Overkill an stylishen Interieurs verwöhnen das Auge in einer Weise, wie man es sich eigentlich von Spielbergs recht fußlahmer juveniler Hetzjagd erwartet hatte.
Doch auf diesen Pluspunkten ruht sich der Filmbeinahe schon etwas zu sehr aus und verspielt andernweitig leichtsinnig das erwirtschaftete Kapital. Kurz und schmerzlos: Das Drehbuch hat den Film schlicht und ergreifend nicht im Griff. Zwar gibt es immer wieder Momente, die einen - wie etwa in dieser Splitscreen-Sequenz, als McGregor und die Zellweger miteinander telefonieren und die währenddessen durchgeführte Gymnastik in der Organisation des Bildes für allerlei anzügliche Anspielungen sorgt - zwischen peinlich berührt und herzlich amüsiert schmunzeln lassen, aber diese oft genug mit Verve seitens der Schauspieler und der Menschen hinter der Kamera inszenierten Momente wechseln sich dann doch mit eher langatmigen Sequenzen ab, in denen der Film auf der Stelle tritt, sich zu sehr auf 60ies-Schauwerte verlässt und die schlußendlich einfach zu lange dauern. Dies mag vielleicht ja wirklich dem Tempo und der Struktur der filmhistorischen Vorlage entsprechen, nur hätte man hier, zumal man auch andernweitig recht frei damit umging, ein etwas rasanteres Erzähltempo wagen dürfen. In diesen zähen Momenten lässt auch die Inszenierung etwas zu wünschen übrig: Nicht selten filmt die Kamera einfach nur ab, selbst längere Dialoge werden häufig einfach nur in einer langen Halbnahen gefilmt, mit beiden Darstellern ohne Schnitt. Auch hier scheint man sich dem Original zu sehr verpflichtet gefühlt zu haben, gleichso, als wäre eine Hommage einfach nur eine Kopie.
Anstatt also das Emblematische herauszufiltern und mit zeitgenössischen Mitteln zu überhöhen (wie das Tarantino etwa in seinen Filmen, vor allem natürlich in Kill Bill so wunderbar macht), verpufft Down with Love zur teilweise zwar recht nett anzusehenden, über weite Strecken dann aber eben doch recht faden Mode- und Art deco-Ausstellung. Dann kann man sich eigentlich auch gleich die historischen Originale ansehen, die wurden wenigstens noch auf richtigem Technicolor gedreht (und nicht, wie dieser Film, was der Abspann verrät, auf Filmmaterial von Kodak, dessen Eastman-Color damals, bittere Ironie des Schicksals, das weit teurere Technicolor-Material binnen kürzester Zeit vom Markt verdrängte).
imdb | mrqe | angelaufen.de | links@filmz.de
Man hat auch schon bessere Hommagen an Filme vergangener Dekaden gesehen. Vielleicht lag's aber auch nur daran, dass die Ära von Rock Hudson und Doris Day nicht unbedingt zu meinen Spezialgebieten gehört, wenngleich ich mich daran erinnern kann, in meinen ersten bewusst wahrgenommenen Lebensjahren einige dieser Filme im TV gesehen zu haben. Wie auch immer: Ein zwiespältiges Filmerlebnis.
 Gewiss, die Optik ist zum Teil großartig: Bonbonfarbene Kostüme, der wunderbare Vorspann von Asylum, der (die?) auch schon den recht ähnlichen Titel zu Spielbergs Catch me if you can (USA 2002) gestaltete, die direkt aus den referierten Filmen herausgeklaubten Rückprojektionen während der Autofahrten, wie natürlich der absolute Overkill an stylishen Interieurs verwöhnen das Auge in einer Weise, wie man es sich eigentlich von Spielbergs recht fußlahmer juveniler Hetzjagd erwartet hatte.
Gewiss, die Optik ist zum Teil großartig: Bonbonfarbene Kostüme, der wunderbare Vorspann von Asylum, der (die?) auch schon den recht ähnlichen Titel zu Spielbergs Catch me if you can (USA 2002) gestaltete, die direkt aus den referierten Filmen herausgeklaubten Rückprojektionen während der Autofahrten, wie natürlich der absolute Overkill an stylishen Interieurs verwöhnen das Auge in einer Weise, wie man es sich eigentlich von Spielbergs recht fußlahmer juveniler Hetzjagd erwartet hatte. Doch auf diesen Pluspunkten ruht sich der Filmbeinahe schon etwas zu sehr aus und verspielt andernweitig leichtsinnig das erwirtschaftete Kapital. Kurz und schmerzlos: Das Drehbuch hat den Film schlicht und ergreifend nicht im Griff. Zwar gibt es immer wieder Momente, die einen - wie etwa in dieser Splitscreen-Sequenz, als McGregor und die Zellweger miteinander telefonieren und die währenddessen durchgeführte Gymnastik in der Organisation des Bildes für allerlei anzügliche Anspielungen sorgt - zwischen peinlich berührt und herzlich amüsiert schmunzeln lassen, aber diese oft genug mit Verve seitens der Schauspieler und der Menschen hinter der Kamera inszenierten Momente wechseln sich dann doch mit eher langatmigen Sequenzen ab, in denen der Film auf der Stelle tritt, sich zu sehr auf 60ies-Schauwerte verlässt und die schlußendlich einfach zu lange dauern. Dies mag vielleicht ja wirklich dem Tempo und der Struktur der filmhistorischen Vorlage entsprechen, nur hätte man hier, zumal man auch andernweitig recht frei damit umging, ein etwas rasanteres Erzähltempo wagen dürfen. In diesen zähen Momenten lässt auch die Inszenierung etwas zu wünschen übrig: Nicht selten filmt die Kamera einfach nur ab, selbst längere Dialoge werden häufig einfach nur in einer langen Halbnahen gefilmt, mit beiden Darstellern ohne Schnitt. Auch hier scheint man sich dem Original zu sehr verpflichtet gefühlt zu haben, gleichso, als wäre eine Hommage einfach nur eine Kopie.
Anstatt also das Emblematische herauszufiltern und mit zeitgenössischen Mitteln zu überhöhen (wie das Tarantino etwa in seinen Filmen, vor allem natürlich in Kill Bill so wunderbar macht), verpufft Down with Love zur teilweise zwar recht nett anzusehenden, über weite Strecken dann aber eben doch recht faden Mode- und Art deco-Ausstellung. Dann kann man sich eigentlich auch gleich die historischen Originale ansehen, die wurden wenigstens noch auf richtigem Technicolor gedreht (und nicht, wie dieser Film, was der Abspann verrät, auf Filmmaterial von Kodak, dessen Eastman-Color damals, bittere Ironie des Schicksals, das weit teurere Technicolor-Material binnen kürzester Zeit vom Markt verdrängte).
imdb | mrqe | angelaufen.de | links@filmz.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
27. Dezember 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
27.12.2003, Heimkino
 Sehr schade: Der 3D-Effekt stellt sich auf der Mattscheibe natürlich nicht ein. Dafür aber wird man, in Folge der besonderen Inszenierung, mit einigen visuellen Gewitztheiten entschädigt, die den Film schlußendlich dennoch zu einem aufregenden Erlebnis gestalten. Immer wieder wird der Zuschauer von der Bildfläche torpediert: Polizisten richten ihr Gewehr frontal in die Kamera, ein Messerwerfer bewirft das Publikum mit scharfen Klingen, ein Gorilla stürmt die Kamera, Leichen fallen nicht nur vom Schornstein in den Kamin, sondern auch von oben im Bildvordergrund ins Bild und dergleichen noch vieles mehr. Das Konzept ist klar: Nicht die altebekannte Bewegung aus dem Hintergrund in den Vordergrund konstruiert Dynamik, das Publikum selbst ist Ziel der ausholendsten Bewegungen.
Sehr schade: Der 3D-Effekt stellt sich auf der Mattscheibe natürlich nicht ein. Dafür aber wird man, in Folge der besonderen Inszenierung, mit einigen visuellen Gewitztheiten entschädigt, die den Film schlußendlich dennoch zu einem aufregenden Erlebnis gestalten. Immer wieder wird der Zuschauer von der Bildfläche torpediert: Polizisten richten ihr Gewehr frontal in die Kamera, ein Messerwerfer bewirft das Publikum mit scharfen Klingen, ein Gorilla stürmt die Kamera, Leichen fallen nicht nur vom Schornstein in den Kamin, sondern auch von oben im Bildvordergrund ins Bild und dergleichen noch vieles mehr. Das Konzept ist klar: Nicht die altebekannte Bewegung aus dem Hintergrund in den Vordergrund konstruiert Dynamik, das Publikum selbst ist Ziel der ausholendsten Bewegungen.
Und dann die zahlreichen Morde und Entführungen, deren Inszenierung zwar sicher noch weit von der Zeigefreudigkeit der teilweise durchaus vergleichbaren italienischen Gialli der 60er entfernt ist, aber dennoch einigen Nervenkitzel bieten. Vor allem der spannende Überfall im Dachatelier eines Malers wäre da zu nennen. Der Mörder bleibt nur ein Schatten an der Wand, doch die handwerklich geschickte mise-en-scène, der tolle Schnitt und natürlich, für einen us-amerikanischen Gruselfilme dieser Jahre beinahe schon ungewöhnlich, die besondere Betonung der rein optischen Ebene machen aus dieser Sequenz ein kleines Fest für den Genrefreund. Alles in allem, trotz eingangs erwähnten Abstrichs, eine kleine Überraschung für mich, da ich doch eigentlich mit nahezu keinen Erwartungen an den mir bis dahin noch nicht untergekommenen Film herangetreten bin. Ein schöner untergegangener Klassiker.
Das schöne Covermotiv ist übrigens Stefan Haas' sehr schöner Website http://www.bmovies.de entnommen. Ein kleiner Tempel für Freunde gepflegter Genrenostalgie, der zum stundenlangen Stöbern enilädt. Herzliche Empfehlung natürlich!
imdb | mrqe | bmovies.de
 Sehr schade: Der 3D-Effekt stellt sich auf der Mattscheibe natürlich nicht ein. Dafür aber wird man, in Folge der besonderen Inszenierung, mit einigen visuellen Gewitztheiten entschädigt, die den Film schlußendlich dennoch zu einem aufregenden Erlebnis gestalten. Immer wieder wird der Zuschauer von der Bildfläche torpediert: Polizisten richten ihr Gewehr frontal in die Kamera, ein Messerwerfer bewirft das Publikum mit scharfen Klingen, ein Gorilla stürmt die Kamera, Leichen fallen nicht nur vom Schornstein in den Kamin, sondern auch von oben im Bildvordergrund ins Bild und dergleichen noch vieles mehr. Das Konzept ist klar: Nicht die altebekannte Bewegung aus dem Hintergrund in den Vordergrund konstruiert Dynamik, das Publikum selbst ist Ziel der ausholendsten Bewegungen.
Sehr schade: Der 3D-Effekt stellt sich auf der Mattscheibe natürlich nicht ein. Dafür aber wird man, in Folge der besonderen Inszenierung, mit einigen visuellen Gewitztheiten entschädigt, die den Film schlußendlich dennoch zu einem aufregenden Erlebnis gestalten. Immer wieder wird der Zuschauer von der Bildfläche torpediert: Polizisten richten ihr Gewehr frontal in die Kamera, ein Messerwerfer bewirft das Publikum mit scharfen Klingen, ein Gorilla stürmt die Kamera, Leichen fallen nicht nur vom Schornstein in den Kamin, sondern auch von oben im Bildvordergrund ins Bild und dergleichen noch vieles mehr. Das Konzept ist klar: Nicht die altebekannte Bewegung aus dem Hintergrund in den Vordergrund konstruiert Dynamik, das Publikum selbst ist Ziel der ausholendsten Bewegungen.Und dann die zahlreichen Morde und Entführungen, deren Inszenierung zwar sicher noch weit von der Zeigefreudigkeit der teilweise durchaus vergleichbaren italienischen Gialli der 60er entfernt ist, aber dennoch einigen Nervenkitzel bieten. Vor allem der spannende Überfall im Dachatelier eines Malers wäre da zu nennen. Der Mörder bleibt nur ein Schatten an der Wand, doch die handwerklich geschickte mise-en-scène, der tolle Schnitt und natürlich, für einen us-amerikanischen Gruselfilme dieser Jahre beinahe schon ungewöhnlich, die besondere Betonung der rein optischen Ebene machen aus dieser Sequenz ein kleines Fest für den Genrefreund. Alles in allem, trotz eingangs erwähnten Abstrichs, eine kleine Überraschung für mich, da ich doch eigentlich mit nahezu keinen Erwartungen an den mir bis dahin noch nicht untergekommenen Film herangetreten bin. Ein schöner untergegangener Klassiker.
Das schöne Covermotiv ist übrigens Stefan Haas' sehr schöner Website http://www.bmovies.de entnommen. Ein kleiner Tempel für Freunde gepflegter Genrenostalgie, der zum stundenlangen Stöbern enilädt. Herzliche Empfehlung natürlich!
imdb | mrqe | bmovies.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
18. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
17.12.2003, Heimkino
 Im Kino damals konnte ich bisweilen herzlich auflachen, die erneute Sichtung unter Heimkinobedingungen gestaltete sich dann aber doch beinahe als Geduldsprobe. Gewiss, das Thema ist reizvoll und seine Umsetzung erfrischend unbekümmert. Aber irgendwie schleppt man sich doch sehr, bis man zu jenen schwarzhumorigen Momenten kommt, die dann, weil man sie ja eben doch schon kennt, höchstens noch das Schmunzeln des Wiedererkennens und Erinnerns hervorrufen. Und das ist irgendwie das Traurige an diesem Film, dass man da Zeuge wird, wie er sich - trotz damaligen Titelbilds auf dem Filmdienst - langsam, aber sicher aus der Wahrnehmung und der Filmgeschichte verabschiedet. Das macht beinahe schon etwas böse, dass ein zwar sichtlich ambitionierter Filmemacher dann doch nicht mit genügend Ehrgeiz an seinen Film herangeht, um ihm ein kleines Quentchen Zeitlosigkeit zu verleihen. Und das übel versöhnliche Ende stieß mir schon damals im Kino etwas auf, jetzt scheint es den vorangegangen Film noch auf der Zielgeraden desavouieren zu wollen.
Im Kino damals konnte ich bisweilen herzlich auflachen, die erneute Sichtung unter Heimkinobedingungen gestaltete sich dann aber doch beinahe als Geduldsprobe. Gewiss, das Thema ist reizvoll und seine Umsetzung erfrischend unbekümmert. Aber irgendwie schleppt man sich doch sehr, bis man zu jenen schwarzhumorigen Momenten kommt, die dann, weil man sie ja eben doch schon kennt, höchstens noch das Schmunzeln des Wiedererkennens und Erinnerns hervorrufen. Und das ist irgendwie das Traurige an diesem Film, dass man da Zeuge wird, wie er sich - trotz damaligen Titelbilds auf dem Filmdienst - langsam, aber sicher aus der Wahrnehmung und der Filmgeschichte verabschiedet. Das macht beinahe schon etwas böse, dass ein zwar sichtlich ambitionierter Filmemacher dann doch nicht mit genügend Ehrgeiz an seinen Film herangeht, um ihm ein kleines Quentchen Zeitlosigkeit zu verleihen. Und das übel versöhnliche Ende stieß mir schon damals im Kino etwas auf, jetzt scheint es den vorangegangen Film noch auf der Zielgeraden desavouieren zu wollen.
Immerhin: Da doch alles noch recht gut in Erinnerung war, konnte sich auf die für einen Arthaus-Film doch ungewöhnlich dynamische Kameraarbeit konzentriert werden. Kaum eine Szene, die als Totale gefilmt wäre, in der von vorneherein alles klar ist. Immer ist die Kamera in Bewegung, umkreist die Darsteller, ergänzt am Rande die Bildinformationen. Schade indes, dass es Premiere vorzieht, solche Arbeit mit zweifelhaftem Drang zum Vollbild zunichte zu machen: Rechts und links wird das Widescreenbild einfach abgeschnitten, was bereits im Vorspann, wenn nur die halben Einblendungen zu sehen sind, mißmutig stimmt. Vielleicht lag's dann eben doch nur daran: Dass man von vorneherein wusste, eh nur zwei Drittel des Films zu Gesicht zu bekommen. Unbegreiflich, wie willfährig man - neben Zensur,schlechten Synchronisationen oder generellen Unterschlagungen - noch immer mit Filmen umgeht.
imdb | mrqe | angelaufen.de
 Im Kino damals konnte ich bisweilen herzlich auflachen, die erneute Sichtung unter Heimkinobedingungen gestaltete sich dann aber doch beinahe als Geduldsprobe. Gewiss, das Thema ist reizvoll und seine Umsetzung erfrischend unbekümmert. Aber irgendwie schleppt man sich doch sehr, bis man zu jenen schwarzhumorigen Momenten kommt, die dann, weil man sie ja eben doch schon kennt, höchstens noch das Schmunzeln des Wiedererkennens und Erinnerns hervorrufen. Und das ist irgendwie das Traurige an diesem Film, dass man da Zeuge wird, wie er sich - trotz damaligen Titelbilds auf dem Filmdienst - langsam, aber sicher aus der Wahrnehmung und der Filmgeschichte verabschiedet. Das macht beinahe schon etwas böse, dass ein zwar sichtlich ambitionierter Filmemacher dann doch nicht mit genügend Ehrgeiz an seinen Film herangeht, um ihm ein kleines Quentchen Zeitlosigkeit zu verleihen. Und das übel versöhnliche Ende stieß mir schon damals im Kino etwas auf, jetzt scheint es den vorangegangen Film noch auf der Zielgeraden desavouieren zu wollen.
Im Kino damals konnte ich bisweilen herzlich auflachen, die erneute Sichtung unter Heimkinobedingungen gestaltete sich dann aber doch beinahe als Geduldsprobe. Gewiss, das Thema ist reizvoll und seine Umsetzung erfrischend unbekümmert. Aber irgendwie schleppt man sich doch sehr, bis man zu jenen schwarzhumorigen Momenten kommt, die dann, weil man sie ja eben doch schon kennt, höchstens noch das Schmunzeln des Wiedererkennens und Erinnerns hervorrufen. Und das ist irgendwie das Traurige an diesem Film, dass man da Zeuge wird, wie er sich - trotz damaligen Titelbilds auf dem Filmdienst - langsam, aber sicher aus der Wahrnehmung und der Filmgeschichte verabschiedet. Das macht beinahe schon etwas böse, dass ein zwar sichtlich ambitionierter Filmemacher dann doch nicht mit genügend Ehrgeiz an seinen Film herangeht, um ihm ein kleines Quentchen Zeitlosigkeit zu verleihen. Und das übel versöhnliche Ende stieß mir schon damals im Kino etwas auf, jetzt scheint es den vorangegangen Film noch auf der Zielgeraden desavouieren zu wollen. Immerhin: Da doch alles noch recht gut in Erinnerung war, konnte sich auf die für einen Arthaus-Film doch ungewöhnlich dynamische Kameraarbeit konzentriert werden. Kaum eine Szene, die als Totale gefilmt wäre, in der von vorneherein alles klar ist. Immer ist die Kamera in Bewegung, umkreist die Darsteller, ergänzt am Rande die Bildinformationen. Schade indes, dass es Premiere vorzieht, solche Arbeit mit zweifelhaftem Drang zum Vollbild zunichte zu machen: Rechts und links wird das Widescreenbild einfach abgeschnitten, was bereits im Vorspann, wenn nur die halben Einblendungen zu sehen sind, mißmutig stimmt. Vielleicht lag's dann eben doch nur daran: Dass man von vorneherein wusste, eh nur zwei Drittel des Films zu Gesicht zu bekommen. Unbegreiflich, wie willfährig man - neben Zensur,schlechten Synchronisationen oder generellen Unterschlagungen - noch immer mit Filmen umgeht.
imdb | mrqe | angelaufen.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
16. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
16.12.2003, Heimkino
Aus der beinahe schon vormodernen Idylle der Vorspannbilder entwickelt Peckinpah binnen kürzester Zeit ein grimmiges, existenzialistisches Passionsspiel. Als die Autos das Anwesen des Patriarchen verlassen, tritt mit einem Mal die Moderne in diese Welt, die zuvor auch ohne weiteres als Wildwest-Welt aus dem 19. Jahrhundert, aus den alten Filmen Peckinpahs lesbar gewesen wäre, ein Flugzeug schließlich, dessen Abflug in die Szene eingeschnitten wird, zerstreut letzte Zweifel: Wir sind im Hier und Jetzt, in der Moderne der Industriestaaten, wo die unüberlegt ausgesprochenen drakonischen Anweisungen des mexikanischen Patriarchen nur ein Blutbad zur Folge haben können. Beinahe Peckinpahs bester Film?
imdb | mrqe
Aus der beinahe schon vormodernen Idylle der Vorspannbilder entwickelt Peckinpah binnen kürzester Zeit ein grimmiges, existenzialistisches Passionsspiel. Als die Autos das Anwesen des Patriarchen verlassen, tritt mit einem Mal die Moderne in diese Welt, die zuvor auch ohne weiteres als Wildwest-Welt aus dem 19. Jahrhundert, aus den alten Filmen Peckinpahs lesbar gewesen wäre, ein Flugzeug schließlich, dessen Abflug in die Szene eingeschnitten wird, zerstreut letzte Zweifel: Wir sind im Hier und Jetzt, in der Moderne der Industriestaaten, wo die unüberlegt ausgesprochenen drakonischen Anweisungen des mexikanischen Patriarchen nur ein Blutbad zur Folge haben können. Beinahe Peckinpahs bester Film?
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
10. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Zur DVD-Veröffentlichung von Rivers and Tides, ein Portrait des Land--Art-Künstlers Andy Goldsworthy
"Kunst" ist immer auch die mutwillige Veränderung des Zustandes einer Ressource in einen anderen, eine vorher so nicht da gewesene Form oder Zusammensetzung. Gefühlskalt liesse sich auch Zerstörung auf diese Art fast wortgenau definieren. Der Zusammenhang zwischen Kunst und Zerstörung ist somit ein ganz immanenter der Wesensverwandtschaft.
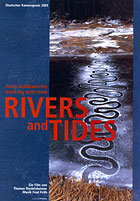 Kunst macht auch Andy Goldsworthy - vergängliche Kunst, um genau zu sein. Somit ist ein wesentlicher Aspekt seiner Werke immer auch die "Zerstörung" - nicht nur die der Ressourcen jedoch, sondern vor allem auch die des Kunstwerkes an sich, denn der in der schottischen Provinz lebende Künstler bedient sich eher ungewohnter Materialien und Entstehungsorte seiner Werke. Aus Laub entsteht eine mäanderförmige, kunstvolle Aneinanderreihung, die ein Flussbett hinab schwimmt, grobschlächtige Felsbrocken ergeben in der Summe der einzelnen Teile überdimensionale Gesteinskegel, die sorgfältig ausbalanciert in ansonsten unberührten Naturlandschaften oder neben selten befahrenen Gebirgsstraßen stehen, dutzende Eiszapfen ergeben, sorgfältig zurechtgebissen und sachte aneinander geschmolzen, schlangenförmige Symbole des Flusses und seines Verlaufs, die sich elegant und ihrer eigenen Wesensart entgegengesetzt an Gesteinsbrocken anschmiegen. Eine für museale Auswertungen sichtlich undankbare Kunst also, denn Goldsworthy ist "Land-Art"-Künstler und darüber hinaus noch mehr: ein wortkarger Philosoph der Schönheit des einzelnen Moments, für den die Welt nicht nur im winzigen Detail entsteht, sondern dort bereits entstanden ist, der versucht, die Gegebenheiten der Natur und ihrer Kräfte mittels seiner Kunst zu erfassen und zu verstehen, um dabei hinter den alles bestimmenden menschlichen Blick auf die Natur zu kommen. Was zunächst wie kitsch-überladene Naturmystik anmutet und vielleicht auch nach esoterischer Beliebigkeit klingt, entpuppt sich schnell als das genaue Gegenteil: nicht zuletzt die Gesetze der Physik und die empathische Umsetzung ihrer strengen Reglements in Fingerspitzengefühl und respektvolle Besonnenheit sind die Bedingungen, die die Brillanz und die scheinbare Leichtigkeit dieser Kunstwerke erst ermöglichen - ein naher Verwandter des Stalkers aus Andrej Tarkowskijs gleichnamigen Film gewissermaßen. Der Kameramann und Regisseur Thomas Riedelsheimer hat den zurückgezogen lebenden Künstler über 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist dabei Rivers And Tides - eine Dokumentation.
Kunst macht auch Andy Goldsworthy - vergängliche Kunst, um genau zu sein. Somit ist ein wesentlicher Aspekt seiner Werke immer auch die "Zerstörung" - nicht nur die der Ressourcen jedoch, sondern vor allem auch die des Kunstwerkes an sich, denn der in der schottischen Provinz lebende Künstler bedient sich eher ungewohnter Materialien und Entstehungsorte seiner Werke. Aus Laub entsteht eine mäanderförmige, kunstvolle Aneinanderreihung, die ein Flussbett hinab schwimmt, grobschlächtige Felsbrocken ergeben in der Summe der einzelnen Teile überdimensionale Gesteinskegel, die sorgfältig ausbalanciert in ansonsten unberührten Naturlandschaften oder neben selten befahrenen Gebirgsstraßen stehen, dutzende Eiszapfen ergeben, sorgfältig zurechtgebissen und sachte aneinander geschmolzen, schlangenförmige Symbole des Flusses und seines Verlaufs, die sich elegant und ihrer eigenen Wesensart entgegengesetzt an Gesteinsbrocken anschmiegen. Eine für museale Auswertungen sichtlich undankbare Kunst also, denn Goldsworthy ist "Land-Art"-Künstler und darüber hinaus noch mehr: ein wortkarger Philosoph der Schönheit des einzelnen Moments, für den die Welt nicht nur im winzigen Detail entsteht, sondern dort bereits entstanden ist, der versucht, die Gegebenheiten der Natur und ihrer Kräfte mittels seiner Kunst zu erfassen und zu verstehen, um dabei hinter den alles bestimmenden menschlichen Blick auf die Natur zu kommen. Was zunächst wie kitsch-überladene Naturmystik anmutet und vielleicht auch nach esoterischer Beliebigkeit klingt, entpuppt sich schnell als das genaue Gegenteil: nicht zuletzt die Gesetze der Physik und die empathische Umsetzung ihrer strengen Reglements in Fingerspitzengefühl und respektvolle Besonnenheit sind die Bedingungen, die die Brillanz und die scheinbare Leichtigkeit dieser Kunstwerke erst ermöglichen - ein naher Verwandter des Stalkers aus Andrej Tarkowskijs gleichnamigen Film gewissermaßen. Der Kameramann und Regisseur Thomas Riedelsheimer hat den zurückgezogen lebenden Künstler über 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist dabei Rivers And Tides - eine Dokumentation.
Das wichtigste Element seiner Kunst blieb bislang ungenannt: Zeit. "I'm working with time", wie Goldsworthy selbst behauptet. Sie bestimmt den vergänglichen und brüchigen Charakter seines Werkes und manifestiert sich beispielsweise in den Gezeiten, die einen Gesteinskegel überfluten, in Flussbiegungen, die seine Blattkompositionen aus dem Blickfeld nehmen, in Gräsern, die zwischen arrangierten Farnen empor wachsen oder auch in langsam schmelzenden Eisskulpturen. Was Wunder also, dass Goldsworthy auch in der hohen Disziplin der Fotografie bewandert ist: ist doch erst sie es, die - schon fast ein ironisches Augenzwinkern in Richtung Walter Benjamin - dem Kunstwerk seine letztendliche Aura verleihen kann, die als zwischengeschaltetes Medium erst eine Rezeption auf breiter Basis ermöglicht, und dem Betrachter der Abbildung den Eindruck vermittelt, etwas großartiges zu sehen, etwas was nur kurz, oft nur einen Augenschlag länger als es für den letztendlich entscheidenden Druck auf den Auslöser gebraucht hat, existierte und letztendlich Bild wurde. Das Kunstwerk wird auf den Schlusspunkt seines Entstehungsprozesses reduziert und durch die Wahl des Standortes der Kamera, also die Perspektive der fertigen Fotografie, interpretiert. Erst derart beliebig reproduzierbar beginnt das Kunstwerk in der kollektiven Wahrnehmung zu existieren. Eine Not, die zur Tugend wurde: die Fotografie war das notwendige, aber auch naheliegenste Mittel, um seine Mentoren an der Kunstschule von seinen Ambitionen zu überzeugen. Mittlerweile gehen Goldsworthys Arbeiten in Form von Fotografien rund um die Welt und werden auch hierzulande, seit einer Auswertung in mehreren Fotobänden des Verlags Zweitausendeins, begeistert aufgenommen.
 Das andere Kunstwerk von dem hier hauptsächlich die Rede ist, der Film Rivers And Tides, nun wiederum nutzt die Prämissen der eigenen Möglichkeitenen und bereichert die bereits Bild gewordene Performance-Kunst wieder um beider ureigentliches Element: Zeit. Und damit auch eng zusammenhängend: die alternative Perspektive der räumlich "entfesselten" Kamera. Auf diese Art gewinnen die von einigen auch als "kultisch" oder elitär abgetanen Bilder der Naturornamente den Charme des Experimentierens und Ausprobierens mit dem Material wieder zurück. Die Freude am Spieltrieb rückt näher ins Zentrum als die Freude am elitären Zurschaustellen des fertigen Produkts. Das Kunstwerk erhält die zeitliche Dimensionen zurück, die Reduktion aufs fertige Ergebnis wird revidiert. Da sich der Film zudem auch angenehm um eine "un-werkhafte" Annäherung bemüht, fühlt sich der Zuschauer nie belehrt, sondern nimmt stets unmittelbar an den Schaffungsprozessen des sympathisch zurückhaltenden Schotten teil, taucht ein in seine Philosophie der Kunst ohne den Muff von Seminarraum und Diavortrag überhaupt erst entstehen zu lassen.
Das andere Kunstwerk von dem hier hauptsächlich die Rede ist, der Film Rivers And Tides, nun wiederum nutzt die Prämissen der eigenen Möglichkeitenen und bereichert die bereits Bild gewordene Performance-Kunst wieder um beider ureigentliches Element: Zeit. Und damit auch eng zusammenhängend: die alternative Perspektive der räumlich "entfesselten" Kamera. Auf diese Art gewinnen die von einigen auch als "kultisch" oder elitär abgetanen Bilder der Naturornamente den Charme des Experimentierens und Ausprobierens mit dem Material wieder zurück. Die Freude am Spieltrieb rückt näher ins Zentrum als die Freude am elitären Zurschaustellen des fertigen Produkts. Das Kunstwerk erhält die zeitliche Dimensionen zurück, die Reduktion aufs fertige Ergebnis wird revidiert. Da sich der Film zudem auch angenehm um eine "un-werkhafte" Annäherung bemüht, fühlt sich der Zuschauer nie belehrt, sondern nimmt stets unmittelbar an den Schaffungsprozessen des sympathisch zurückhaltenden Schotten teil, taucht ein in seine Philosophie der Kunst ohne den Muff von Seminarraum und Diavortrag überhaupt erst entstehen zu lassen.
So beobachten wir en detail den Fertigungsprozess der fragilen Konstrukte, erleben nicht selten das tragische Scheitern kurz vor der Vollendung, das dennoch nie in Resignation umschlägt, erfreuen uns an der Perfektion und eigentümlichen Schönheit der Resultate und verabschieden uns letzten Endes wehmütig von ihnen, wenn sie im Fluss fortgetragen, vom Wind verworfen, kurz: weiterbearbeitet werden, wie Goldsworthy sagt. Beide Kunstwerke, Goldsworthys Skulpturen und der Film darüber, gehen eine fruchtbare Allianz ein und unterstreichen gegenseitig die Brillanz des anderen, wobei sich Riedelsheimer stets bewusst bleibt, dass seine Kamera nur das zweitrangige Element darstellt. So gewinnt beispielsweise ein sorgfältig angefertigtes Iglu, bestehend aus aufeinandergeschichteten, in sich austariert ruhenden Holzscheiten direkt am Ufer eines von den Gezeiten abhängigen Gewässers, durch eine sich langsam herantastende Kranfahrt der Kamera noch eine zusätzliche Ebene, die dem Betrachter zuvor nicht bewusst war. Riedelsheimer nutzt die Bedingungen der im positiven Sinne manipulativen Möglichkeiten des Films, um das Objekt der Begierde auf eine zuvor nicht vorhandene Stufe der Rezeption zu heben: Der voyeuristische Blick der Kamera wird ausnahmsweise zum symbiotischen Blick: beide Kunstwerke geben und nehmen dankbar einander im Basar der Möglichkeiten. Dies nur ein Beispiel unzähliger solcher magic moments, die die Grundessenz des Kinos, seit jeher ein Ort des Glücksversprechens und - wortwörtlich - der Erleuchtung, darstellen. So gewinnt eben auch der Raum - die andere Koordinate des Films! - Beachtung in der Rezeption des Kunstwerkes über den Umweg seine technisch reproduzierbaren Konservierbarkeit:. Sonnenstrahlen, die zufällig eine Eisskulptur berühren und sie aus Perspektive der Kamera von innen glühend erscheinen lassen, werden zum festen Bestandteil des Kunstwerkes und seiner technischen Konservierung in Filmform. Das sich noch im Werden begriffene Kunstwerk offenbart mittels verschiedenster Perspektiven und Kameraauflösungen mehr und mehr seinen verschiedenartigen Charakter: Erst der Blickwinkel aus der Vogelperspektive ist es, der einer aus Steinen aufgeschichteten Mauer, quer durch eine Waldlandschaft in den USA, ihren ganz eigenwilligen Charakter zu verleihen scheint, ihn zumindest aber offensichtlich macht. So erschließen sich nach und nach durch verschiedene Blickwinkel auf das Kunstwerk - sowohl längs ihrer Entstehungsgeschichte als auch unter dem Gesichtspunkt ihrer räumlichen Bedingungen - neue Herangehensweisen an das fertige Kunstwerk.
Darüber hinaus montiert Riedelsheimer regelmäßig Aufnahmen aus der sowohl zeitlich als auch geografisch näheren Umgebung des Künstlers parallel in seine Dokumentation - Fußballspieler aus Goldsworthys Wahlheimatdorf zum Beispiel gerieren dergestalt, vertieft in ihrem Spiel und der Kamera nicht gewahr, zum Symbol des Goldsworthy'schen Ansatzes von "Geben und Nehmen", "Impulse setzen und annehmen". Wellenbewegungen und andere Naturspielereien reihen, meist im "Close-Up" gefilmt, Goldsworthys Werke ein in die Launen und Schönheiten der Natur und unterstreichen, meist mit Kommentaren des Künstlers aus dem Off garniert, maßgebliche Wesensarten seiner Kunst. "Was unter der Oberfläche steckt, beeinflusst die Oberfläche!" lässt Riedelsheimer Goldsworthy die eigenen Arbeiten an einer Lehmwand eines Museums, die ihr Geheimnis erst im Laufe ihrer Trocknung offenbaren würde, kommentieren und montiert dazu parallel eine Groß-Aufnahme eines seichten Baches aus der Vogelperspektive, dessen Wellenformen ganz augenscheinlich durch die darin liegenden, flachen Steine beeinflusst werden. Durch das stete Beifügen solcher ergänzender Bilder und Metaphern entsteht ein Gesamtbild aus Allegorien, der einfühlsamen Darstellung räumlicher Gegebenheiten und einer eigenen Philosophie der Einsamkeit und Meditation, welches wie seine Hauptattraktionen tief in sich ruhend geschlossen erscheint und so deren suggestive Aussagekraft noch zusätzlich unterstreicht. Freudig geben und dankbar nehmen, lautet die Devise und in diesen wechselseitig fruchtbaren Bildprozessen wird sie nur noch mehr manifest.
Aussagekräftig sind auch Goldsworthys Hände, haben doch die Arbeiten mit den Elementen der Natur quasi beiläufig über die Jahre hinweg ein weiteres Kunstwerk geschaffen, auf das uns erst Riedelsheimer mit seiner suggestiven Kamera aufmerksam macht. Verdächtig häufig bleibt diese im Close-Up-Verfahren an den Händen des Land-Art-Künstlers hängen: Pflaster werden hier quasi nebenbei im Spiegel ihrer eigenen Vergänglichkeit dokumentiert, mal wachsende, mal schrumpfende, mal empfindlich ans eigene Schmerzempfinden appellierende Hämatome wandern über die Haut, in welcher sich schon lange tiefe Risse und Falten eingegerbt haben, unzählige Schichten Horn zeugen von einer eigenen Entstehungsgeschichte. Bedingt durch Goldsworthys Arbeitsweise, die sich um des Fingerspitzengefühls und auch der Höflichkeit willen Handschuhe verbietet, hat sich auch hier eine Landschaft gebildet, die einlädt, offen in ihr zu lesen, ganz genau wie der Künstler dies auch in seinen zu gestaltenden Landschaften tut. Seiner Sicht nach hinterlassen Zeit und Menschen "Schichten" auf und in der Landschaft und er fühlt sich dazu berufen, seinen eigenen Beitrag dazu beizufügen. Der Lauf der Natur - oder besser: der physikalischen Gesetze - verlangt stets wechselseitig seinen eigenen Tribut, doch sieht Goldsworthy dies eher als Bereicherung denn als unbequeme Komponente der Kunst: wenn die Gezeiten seine Steinkegel schlucken, so sieht er dies als Geschenk an und wird Zeuge von etwas, was, so Goldsworthy, er sich selbst nie hätte erhoffen können. Natur und Kultur ausnahmsweise mal in sich vereint - auch hier ein Geben und Nehmen auf dem bereits angesprochenen Basar der Möglichkeiten.
Das letzte Bild schließlich zeigt Andy Goldsworthy, der in Kanada freudig Schnee in den Wind wirft und sichtlich fasziniert den Spielereien des Schneegestöbers in der Luft hinterher sieht, ohne dabei in eine Vulgär-Naturmystik zu verfallen. Dies ist durchaus symbolisch für den gerade gesehenen Film zu verstehen, der mit Finesse die Wunder aus dem Verhältnis zwischen (letzlich nur so empfundenen) Zufälligkeiten und bewusst forcierten Prozessen beleuchtet. Es gelingt ein intelligenter Kommentar zur Kunst (filmischer wie aktionistischer) und dem Verhältnis ihres Autors dazu.
Eine qualitativ hochwertige DVD erschien in diesen Tagen bei absolutMedien in Berlin. Diese Kritik erschien zuvor bei F.LM - Texte zum Film.
>> Rivers and Tides (Deutschland 2001)
>> Regie/Kamera/Buch: Thomas Riedelsheimer
>> Mitwirkende: Andy Goldsworthy u.a.
imdb | mrqe | goldsworthy online
"Kunst" ist immer auch die mutwillige Veränderung des Zustandes einer Ressource in einen anderen, eine vorher so nicht da gewesene Form oder Zusammensetzung. Gefühlskalt liesse sich auch Zerstörung auf diese Art fast wortgenau definieren. Der Zusammenhang zwischen Kunst und Zerstörung ist somit ein ganz immanenter der Wesensverwandtschaft.
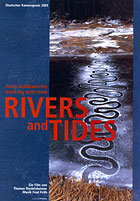 Kunst macht auch Andy Goldsworthy - vergängliche Kunst, um genau zu sein. Somit ist ein wesentlicher Aspekt seiner Werke immer auch die "Zerstörung" - nicht nur die der Ressourcen jedoch, sondern vor allem auch die des Kunstwerkes an sich, denn der in der schottischen Provinz lebende Künstler bedient sich eher ungewohnter Materialien und Entstehungsorte seiner Werke. Aus Laub entsteht eine mäanderförmige, kunstvolle Aneinanderreihung, die ein Flussbett hinab schwimmt, grobschlächtige Felsbrocken ergeben in der Summe der einzelnen Teile überdimensionale Gesteinskegel, die sorgfältig ausbalanciert in ansonsten unberührten Naturlandschaften oder neben selten befahrenen Gebirgsstraßen stehen, dutzende Eiszapfen ergeben, sorgfältig zurechtgebissen und sachte aneinander geschmolzen, schlangenförmige Symbole des Flusses und seines Verlaufs, die sich elegant und ihrer eigenen Wesensart entgegengesetzt an Gesteinsbrocken anschmiegen. Eine für museale Auswertungen sichtlich undankbare Kunst also, denn Goldsworthy ist "Land-Art"-Künstler und darüber hinaus noch mehr: ein wortkarger Philosoph der Schönheit des einzelnen Moments, für den die Welt nicht nur im winzigen Detail entsteht, sondern dort bereits entstanden ist, der versucht, die Gegebenheiten der Natur und ihrer Kräfte mittels seiner Kunst zu erfassen und zu verstehen, um dabei hinter den alles bestimmenden menschlichen Blick auf die Natur zu kommen. Was zunächst wie kitsch-überladene Naturmystik anmutet und vielleicht auch nach esoterischer Beliebigkeit klingt, entpuppt sich schnell als das genaue Gegenteil: nicht zuletzt die Gesetze der Physik und die empathische Umsetzung ihrer strengen Reglements in Fingerspitzengefühl und respektvolle Besonnenheit sind die Bedingungen, die die Brillanz und die scheinbare Leichtigkeit dieser Kunstwerke erst ermöglichen - ein naher Verwandter des Stalkers aus Andrej Tarkowskijs gleichnamigen Film gewissermaßen. Der Kameramann und Regisseur Thomas Riedelsheimer hat den zurückgezogen lebenden Künstler über 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist dabei Rivers And Tides - eine Dokumentation.
Kunst macht auch Andy Goldsworthy - vergängliche Kunst, um genau zu sein. Somit ist ein wesentlicher Aspekt seiner Werke immer auch die "Zerstörung" - nicht nur die der Ressourcen jedoch, sondern vor allem auch die des Kunstwerkes an sich, denn der in der schottischen Provinz lebende Künstler bedient sich eher ungewohnter Materialien und Entstehungsorte seiner Werke. Aus Laub entsteht eine mäanderförmige, kunstvolle Aneinanderreihung, die ein Flussbett hinab schwimmt, grobschlächtige Felsbrocken ergeben in der Summe der einzelnen Teile überdimensionale Gesteinskegel, die sorgfältig ausbalanciert in ansonsten unberührten Naturlandschaften oder neben selten befahrenen Gebirgsstraßen stehen, dutzende Eiszapfen ergeben, sorgfältig zurechtgebissen und sachte aneinander geschmolzen, schlangenförmige Symbole des Flusses und seines Verlaufs, die sich elegant und ihrer eigenen Wesensart entgegengesetzt an Gesteinsbrocken anschmiegen. Eine für museale Auswertungen sichtlich undankbare Kunst also, denn Goldsworthy ist "Land-Art"-Künstler und darüber hinaus noch mehr: ein wortkarger Philosoph der Schönheit des einzelnen Moments, für den die Welt nicht nur im winzigen Detail entsteht, sondern dort bereits entstanden ist, der versucht, die Gegebenheiten der Natur und ihrer Kräfte mittels seiner Kunst zu erfassen und zu verstehen, um dabei hinter den alles bestimmenden menschlichen Blick auf die Natur zu kommen. Was zunächst wie kitsch-überladene Naturmystik anmutet und vielleicht auch nach esoterischer Beliebigkeit klingt, entpuppt sich schnell als das genaue Gegenteil: nicht zuletzt die Gesetze der Physik und die empathische Umsetzung ihrer strengen Reglements in Fingerspitzengefühl und respektvolle Besonnenheit sind die Bedingungen, die die Brillanz und die scheinbare Leichtigkeit dieser Kunstwerke erst ermöglichen - ein naher Verwandter des Stalkers aus Andrej Tarkowskijs gleichnamigen Film gewissermaßen. Der Kameramann und Regisseur Thomas Riedelsheimer hat den zurückgezogen lebenden Künstler über 4 Jahre lang mit der Kamera begleitet. Herausgekommen ist dabei Rivers And Tides - eine Dokumentation.Das wichtigste Element seiner Kunst blieb bislang ungenannt: Zeit. "I'm working with time", wie Goldsworthy selbst behauptet. Sie bestimmt den vergänglichen und brüchigen Charakter seines Werkes und manifestiert sich beispielsweise in den Gezeiten, die einen Gesteinskegel überfluten, in Flussbiegungen, die seine Blattkompositionen aus dem Blickfeld nehmen, in Gräsern, die zwischen arrangierten Farnen empor wachsen oder auch in langsam schmelzenden Eisskulpturen. Was Wunder also, dass Goldsworthy auch in der hohen Disziplin der Fotografie bewandert ist: ist doch erst sie es, die - schon fast ein ironisches Augenzwinkern in Richtung Walter Benjamin - dem Kunstwerk seine letztendliche Aura verleihen kann, die als zwischengeschaltetes Medium erst eine Rezeption auf breiter Basis ermöglicht, und dem Betrachter der Abbildung den Eindruck vermittelt, etwas großartiges zu sehen, etwas was nur kurz, oft nur einen Augenschlag länger als es für den letztendlich entscheidenden Druck auf den Auslöser gebraucht hat, existierte und letztendlich Bild wurde. Das Kunstwerk wird auf den Schlusspunkt seines Entstehungsprozesses reduziert und durch die Wahl des Standortes der Kamera, also die Perspektive der fertigen Fotografie, interpretiert. Erst derart beliebig reproduzierbar beginnt das Kunstwerk in der kollektiven Wahrnehmung zu existieren. Eine Not, die zur Tugend wurde: die Fotografie war das notwendige, aber auch naheliegenste Mittel, um seine Mentoren an der Kunstschule von seinen Ambitionen zu überzeugen. Mittlerweile gehen Goldsworthys Arbeiten in Form von Fotografien rund um die Welt und werden auch hierzulande, seit einer Auswertung in mehreren Fotobänden des Verlags Zweitausendeins, begeistert aufgenommen.
 Das andere Kunstwerk von dem hier hauptsächlich die Rede ist, der Film Rivers And Tides, nun wiederum nutzt die Prämissen der eigenen Möglichkeitenen und bereichert die bereits Bild gewordene Performance-Kunst wieder um beider ureigentliches Element: Zeit. Und damit auch eng zusammenhängend: die alternative Perspektive der räumlich "entfesselten" Kamera. Auf diese Art gewinnen die von einigen auch als "kultisch" oder elitär abgetanen Bilder der Naturornamente den Charme des Experimentierens und Ausprobierens mit dem Material wieder zurück. Die Freude am Spieltrieb rückt näher ins Zentrum als die Freude am elitären Zurschaustellen des fertigen Produkts. Das Kunstwerk erhält die zeitliche Dimensionen zurück, die Reduktion aufs fertige Ergebnis wird revidiert. Da sich der Film zudem auch angenehm um eine "un-werkhafte" Annäherung bemüht, fühlt sich der Zuschauer nie belehrt, sondern nimmt stets unmittelbar an den Schaffungsprozessen des sympathisch zurückhaltenden Schotten teil, taucht ein in seine Philosophie der Kunst ohne den Muff von Seminarraum und Diavortrag überhaupt erst entstehen zu lassen.
Das andere Kunstwerk von dem hier hauptsächlich die Rede ist, der Film Rivers And Tides, nun wiederum nutzt die Prämissen der eigenen Möglichkeitenen und bereichert die bereits Bild gewordene Performance-Kunst wieder um beider ureigentliches Element: Zeit. Und damit auch eng zusammenhängend: die alternative Perspektive der räumlich "entfesselten" Kamera. Auf diese Art gewinnen die von einigen auch als "kultisch" oder elitär abgetanen Bilder der Naturornamente den Charme des Experimentierens und Ausprobierens mit dem Material wieder zurück. Die Freude am Spieltrieb rückt näher ins Zentrum als die Freude am elitären Zurschaustellen des fertigen Produkts. Das Kunstwerk erhält die zeitliche Dimensionen zurück, die Reduktion aufs fertige Ergebnis wird revidiert. Da sich der Film zudem auch angenehm um eine "un-werkhafte" Annäherung bemüht, fühlt sich der Zuschauer nie belehrt, sondern nimmt stets unmittelbar an den Schaffungsprozessen des sympathisch zurückhaltenden Schotten teil, taucht ein in seine Philosophie der Kunst ohne den Muff von Seminarraum und Diavortrag überhaupt erst entstehen zu lassen. So beobachten wir en detail den Fertigungsprozess der fragilen Konstrukte, erleben nicht selten das tragische Scheitern kurz vor der Vollendung, das dennoch nie in Resignation umschlägt, erfreuen uns an der Perfektion und eigentümlichen Schönheit der Resultate und verabschieden uns letzten Endes wehmütig von ihnen, wenn sie im Fluss fortgetragen, vom Wind verworfen, kurz: weiterbearbeitet werden, wie Goldsworthy sagt. Beide Kunstwerke, Goldsworthys Skulpturen und der Film darüber, gehen eine fruchtbare Allianz ein und unterstreichen gegenseitig die Brillanz des anderen, wobei sich Riedelsheimer stets bewusst bleibt, dass seine Kamera nur das zweitrangige Element darstellt. So gewinnt beispielsweise ein sorgfältig angefertigtes Iglu, bestehend aus aufeinandergeschichteten, in sich austariert ruhenden Holzscheiten direkt am Ufer eines von den Gezeiten abhängigen Gewässers, durch eine sich langsam herantastende Kranfahrt der Kamera noch eine zusätzliche Ebene, die dem Betrachter zuvor nicht bewusst war. Riedelsheimer nutzt die Bedingungen der im positiven Sinne manipulativen Möglichkeiten des Films, um das Objekt der Begierde auf eine zuvor nicht vorhandene Stufe der Rezeption zu heben: Der voyeuristische Blick der Kamera wird ausnahmsweise zum symbiotischen Blick: beide Kunstwerke geben und nehmen dankbar einander im Basar der Möglichkeiten. Dies nur ein Beispiel unzähliger solcher magic moments, die die Grundessenz des Kinos, seit jeher ein Ort des Glücksversprechens und - wortwörtlich - der Erleuchtung, darstellen. So gewinnt eben auch der Raum - die andere Koordinate des Films! - Beachtung in der Rezeption des Kunstwerkes über den Umweg seine technisch reproduzierbaren Konservierbarkeit:. Sonnenstrahlen, die zufällig eine Eisskulptur berühren und sie aus Perspektive der Kamera von innen glühend erscheinen lassen, werden zum festen Bestandteil des Kunstwerkes und seiner technischen Konservierung in Filmform. Das sich noch im Werden begriffene Kunstwerk offenbart mittels verschiedenster Perspektiven und Kameraauflösungen mehr und mehr seinen verschiedenartigen Charakter: Erst der Blickwinkel aus der Vogelperspektive ist es, der einer aus Steinen aufgeschichteten Mauer, quer durch eine Waldlandschaft in den USA, ihren ganz eigenwilligen Charakter zu verleihen scheint, ihn zumindest aber offensichtlich macht. So erschließen sich nach und nach durch verschiedene Blickwinkel auf das Kunstwerk - sowohl längs ihrer Entstehungsgeschichte als auch unter dem Gesichtspunkt ihrer räumlichen Bedingungen - neue Herangehensweisen an das fertige Kunstwerk.
Darüber hinaus montiert Riedelsheimer regelmäßig Aufnahmen aus der sowohl zeitlich als auch geografisch näheren Umgebung des Künstlers parallel in seine Dokumentation - Fußballspieler aus Goldsworthys Wahlheimatdorf zum Beispiel gerieren dergestalt, vertieft in ihrem Spiel und der Kamera nicht gewahr, zum Symbol des Goldsworthy'schen Ansatzes von "Geben und Nehmen", "Impulse setzen und annehmen". Wellenbewegungen und andere Naturspielereien reihen, meist im "Close-Up" gefilmt, Goldsworthys Werke ein in die Launen und Schönheiten der Natur und unterstreichen, meist mit Kommentaren des Künstlers aus dem Off garniert, maßgebliche Wesensarten seiner Kunst. "Was unter der Oberfläche steckt, beeinflusst die Oberfläche!" lässt Riedelsheimer Goldsworthy die eigenen Arbeiten an einer Lehmwand eines Museums, die ihr Geheimnis erst im Laufe ihrer Trocknung offenbaren würde, kommentieren und montiert dazu parallel eine Groß-Aufnahme eines seichten Baches aus der Vogelperspektive, dessen Wellenformen ganz augenscheinlich durch die darin liegenden, flachen Steine beeinflusst werden. Durch das stete Beifügen solcher ergänzender Bilder und Metaphern entsteht ein Gesamtbild aus Allegorien, der einfühlsamen Darstellung räumlicher Gegebenheiten und einer eigenen Philosophie der Einsamkeit und Meditation, welches wie seine Hauptattraktionen tief in sich ruhend geschlossen erscheint und so deren suggestive Aussagekraft noch zusätzlich unterstreicht. Freudig geben und dankbar nehmen, lautet die Devise und in diesen wechselseitig fruchtbaren Bildprozessen wird sie nur noch mehr manifest.
Aussagekräftig sind auch Goldsworthys Hände, haben doch die Arbeiten mit den Elementen der Natur quasi beiläufig über die Jahre hinweg ein weiteres Kunstwerk geschaffen, auf das uns erst Riedelsheimer mit seiner suggestiven Kamera aufmerksam macht. Verdächtig häufig bleibt diese im Close-Up-Verfahren an den Händen des Land-Art-Künstlers hängen: Pflaster werden hier quasi nebenbei im Spiegel ihrer eigenen Vergänglichkeit dokumentiert, mal wachsende, mal schrumpfende, mal empfindlich ans eigene Schmerzempfinden appellierende Hämatome wandern über die Haut, in welcher sich schon lange tiefe Risse und Falten eingegerbt haben, unzählige Schichten Horn zeugen von einer eigenen Entstehungsgeschichte. Bedingt durch Goldsworthys Arbeitsweise, die sich um des Fingerspitzengefühls und auch der Höflichkeit willen Handschuhe verbietet, hat sich auch hier eine Landschaft gebildet, die einlädt, offen in ihr zu lesen, ganz genau wie der Künstler dies auch in seinen zu gestaltenden Landschaften tut. Seiner Sicht nach hinterlassen Zeit und Menschen "Schichten" auf und in der Landschaft und er fühlt sich dazu berufen, seinen eigenen Beitrag dazu beizufügen. Der Lauf der Natur - oder besser: der physikalischen Gesetze - verlangt stets wechselseitig seinen eigenen Tribut, doch sieht Goldsworthy dies eher als Bereicherung denn als unbequeme Komponente der Kunst: wenn die Gezeiten seine Steinkegel schlucken, so sieht er dies als Geschenk an und wird Zeuge von etwas, was, so Goldsworthy, er sich selbst nie hätte erhoffen können. Natur und Kultur ausnahmsweise mal in sich vereint - auch hier ein Geben und Nehmen auf dem bereits angesprochenen Basar der Möglichkeiten.
Das letzte Bild schließlich zeigt Andy Goldsworthy, der in Kanada freudig Schnee in den Wind wirft und sichtlich fasziniert den Spielereien des Schneegestöbers in der Luft hinterher sieht, ohne dabei in eine Vulgär-Naturmystik zu verfallen. Dies ist durchaus symbolisch für den gerade gesehenen Film zu verstehen, der mit Finesse die Wunder aus dem Verhältnis zwischen (letzlich nur so empfundenen) Zufälligkeiten und bewusst forcierten Prozessen beleuchtet. Es gelingt ein intelligenter Kommentar zur Kunst (filmischer wie aktionistischer) und dem Verhältnis ihres Autors dazu.
Eine qualitativ hochwertige DVD erschien in diesen Tagen bei absolutMedien in Berlin. Diese Kritik erschien zuvor bei F.LM - Texte zum Film.
>> Rivers and Tides (Deutschland 2001)
>> Regie/Kamera/Buch: Thomas Riedelsheimer
>> Mitwirkende: Andy Goldsworthy u.a.
imdb | mrqe | goldsworthy online
° ° °
Thema: Filmtagebuch
09. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Aus gegebenem Anlass meine etwas relativierende Kritik zu Good Bye, Lenin! Sie erschien zuvor in leicht abgewandelter Form im Rahmen meiner diesjährigen Berlinaleberichterstattung für F.LM - Texte zum Film.
Während die PDS um ihre letzten Mandate im Bundestag zu kämpfen hat, ist die Zeichenwelt der DDR endgültig im Zitatenhimmel des Pop angekommen. Diesen Schluss zumindest legt Wolfgang Beckers Good Bye, Lenin nahe: Auf 79 Quadratmetern schönster Plattenwohnung muss Alexander Kerner (Daniel Brühl) die DDR für seine Mutter wiederbeleben, denn die ist nach der Flucht des Gatten in den Westen vor vielen Jahren stramme Sozialistin geworden, im idealistischen Sinne natürlich - zu einer Parteibonzin hat der Mut des Drehbuchs offenbar nicht gereicht. Obendrein hat sie die Wende, nach einem Herzinfarkt kurz zuvor, im Koma verbracht. Der womögliche Schock, sich nicht mehr im sozialistischen Vaterland zu befinden, sondern nunmehr den Klauen des Klassenfeindes ohne territoriale wie soziale Rückzugsmöglichkeit ausgeliefert zu sein, könnte einen 2. Infarkt provozieren und somit das Leben kosten. Soweit die Grundvoraussetzungen der Geschichte.
 Good Bye, Lenin! ist unterm Strich vor allem nett, somit aber eben auch herzlich belanglos. Der eine oder andere gelungene Witz, die eine oder andere wehmütig nostalgische Erinnerung - so passender-, wie leider aber eben auch naheliegenderweise im Super8-Format umgesetzt - mögen gelungen sein und unwidersprochen ihren Zweck erfüllen, ansonsten aber herrscht über weite Strecken eine Leere, die vor allem im mangelnden Wagemut des zugrundeliegenden Drehbuchs begründet ist. Eine beißende Satire auf Befindlichkeiten, hüben wie drüben, hätte der Film werden können, ein ebenso witziger wie menschlicher Einblick in ost-deutsche Lebenswelten, widergespiegelt im Trubel der Wendezeit. Aus welchen Gründen auch immer hat man sich aber dazu entschlossen, einen Film zu drehen, der es irgendwie jedem recht machen will, der keinen vor der Kopf stoßen möchte und sich somit infolgedessen vor allem im handzahmen Kitsch ausruht.
Good Bye, Lenin! ist unterm Strich vor allem nett, somit aber eben auch herzlich belanglos. Der eine oder andere gelungene Witz, die eine oder andere wehmütig nostalgische Erinnerung - so passender-, wie leider aber eben auch naheliegenderweise im Super8-Format umgesetzt - mögen gelungen sein und unwidersprochen ihren Zweck erfüllen, ansonsten aber herrscht über weite Strecken eine Leere, die vor allem im mangelnden Wagemut des zugrundeliegenden Drehbuchs begründet ist. Eine beißende Satire auf Befindlichkeiten, hüben wie drüben, hätte der Film werden können, ein ebenso witziger wie menschlicher Einblick in ost-deutsche Lebenswelten, widergespiegelt im Trubel der Wendezeit. Aus welchen Gründen auch immer hat man sich aber dazu entschlossen, einen Film zu drehen, der es irgendwie jedem recht machen will, der keinen vor der Kopf stoßen möchte und sich somit infolgedessen vor allem im handzahmen Kitsch ausruht.
 Und mal ganz ehrlich: Witze über Honecker-Bilder - ja genau, jenes mit dem blauen Hintergrund ist gemeint - an der Wand, Nudossi-Kult und Club-Cola-Zitat sind nun wirklich schon lange nicht mehr abendfüllend. Die Klischees sind soweit altbekannt, die Strategien zur Vereinnahmung - Marke nennen, Marke zeigen, unter dem Vorzeichen des behaupteten Kultes, an dem sich ausnahmslos jeder - ob mit, ob ohne "credibility" - beteiligen kann: Ein alter Hut. Diese Strategie funktioniert ja schon bei den Witzen über die Grünen und ähnliche Gutmenschelei von Florian Illies noch nicht einmal mehr bedingt, warum sollte es also hier - wenn auch mit, zugegeben, anderer Thematik - auf einmal frisch und sexy wirken? Dass die Geschichte zudem allerlei erzählerisches Beiwerk - eine Liebesgeschichte, ein wenig Schmalz von alten Wunden - mitbringt, das zwar ebenfalls recht nett ist, aber eben doch nur wie Anbiederung wirkt, um auch wirklich niemandes mediokrem Filmgeschmack zu nahe zu treten, ist nur noch obligatorisch angesichts des herrschenden Mangels an Inspiration und Experimentierfreudigkeit. Ähnliches gilt für den entliehenen Soundtrack, den man zuvor auch schon weitgehend bei der fabelhaften Amélie zu hören bekam.
Und mal ganz ehrlich: Witze über Honecker-Bilder - ja genau, jenes mit dem blauen Hintergrund ist gemeint - an der Wand, Nudossi-Kult und Club-Cola-Zitat sind nun wirklich schon lange nicht mehr abendfüllend. Die Klischees sind soweit altbekannt, die Strategien zur Vereinnahmung - Marke nennen, Marke zeigen, unter dem Vorzeichen des behaupteten Kultes, an dem sich ausnahmslos jeder - ob mit, ob ohne "credibility" - beteiligen kann: Ein alter Hut. Diese Strategie funktioniert ja schon bei den Witzen über die Grünen und ähnliche Gutmenschelei von Florian Illies noch nicht einmal mehr bedingt, warum sollte es also hier - wenn auch mit, zugegeben, anderer Thematik - auf einmal frisch und sexy wirken? Dass die Geschichte zudem allerlei erzählerisches Beiwerk - eine Liebesgeschichte, ein wenig Schmalz von alten Wunden - mitbringt, das zwar ebenfalls recht nett ist, aber eben doch nur wie Anbiederung wirkt, um auch wirklich niemandes mediokrem Filmgeschmack zu nahe zu treten, ist nur noch obligatorisch angesichts des herrschenden Mangels an Inspiration und Experimentierfreudigkeit. Ähnliches gilt für den entliehenen Soundtrack, den man zuvor auch schon weitgehend bei der fabelhaften Amélie zu hören bekam.
Die DDR, das scheint der Film nahe legen zu wollen, ist von nun an bloßer Zitatenfundus, eine Schatzkammer an Klischees und Vorstellungen, die nunmehr zwecks augenzwinkernder Kult-Anleihen zur Plünderung freigegeben worden ist. Eine solche Verschiebung von Ikonen in den Bereich des "Camps" ist auch per se nichts schlechtes, ganz im Gegenteil. Das Problem jedoch in diesem Falle: Wann war die sprichwörtliche "Zone" in den Bilderwelten des Westens - Becker ist Wessi, unnötig eigentlich zu erwähnen - jemals etwas anderes?
>> Good Bye, Lenin! (Deutschland 2003)
>> Regie: Wolfgang Becker
>> Darsteller: Daniel Brühl, Katrin Saß u.a.
imdb | mrqe | angelaufen.de | filmz.de
Kommentare zur Verleihung des europäischen Filmpreises [via angelaufen.de]:
tagesspiegel | taz | spiegel | welt
Während die PDS um ihre letzten Mandate im Bundestag zu kämpfen hat, ist die Zeichenwelt der DDR endgültig im Zitatenhimmel des Pop angekommen. Diesen Schluss zumindest legt Wolfgang Beckers Good Bye, Lenin nahe: Auf 79 Quadratmetern schönster Plattenwohnung muss Alexander Kerner (Daniel Brühl) die DDR für seine Mutter wiederbeleben, denn die ist nach der Flucht des Gatten in den Westen vor vielen Jahren stramme Sozialistin geworden, im idealistischen Sinne natürlich - zu einer Parteibonzin hat der Mut des Drehbuchs offenbar nicht gereicht. Obendrein hat sie die Wende, nach einem Herzinfarkt kurz zuvor, im Koma verbracht. Der womögliche Schock, sich nicht mehr im sozialistischen Vaterland zu befinden, sondern nunmehr den Klauen des Klassenfeindes ohne territoriale wie soziale Rückzugsmöglichkeit ausgeliefert zu sein, könnte einen 2. Infarkt provozieren und somit das Leben kosten. Soweit die Grundvoraussetzungen der Geschichte.
 Good Bye, Lenin! ist unterm Strich vor allem nett, somit aber eben auch herzlich belanglos. Der eine oder andere gelungene Witz, die eine oder andere wehmütig nostalgische Erinnerung - so passender-, wie leider aber eben auch naheliegenderweise im Super8-Format umgesetzt - mögen gelungen sein und unwidersprochen ihren Zweck erfüllen, ansonsten aber herrscht über weite Strecken eine Leere, die vor allem im mangelnden Wagemut des zugrundeliegenden Drehbuchs begründet ist. Eine beißende Satire auf Befindlichkeiten, hüben wie drüben, hätte der Film werden können, ein ebenso witziger wie menschlicher Einblick in ost-deutsche Lebenswelten, widergespiegelt im Trubel der Wendezeit. Aus welchen Gründen auch immer hat man sich aber dazu entschlossen, einen Film zu drehen, der es irgendwie jedem recht machen will, der keinen vor der Kopf stoßen möchte und sich somit infolgedessen vor allem im handzahmen Kitsch ausruht.
Good Bye, Lenin! ist unterm Strich vor allem nett, somit aber eben auch herzlich belanglos. Der eine oder andere gelungene Witz, die eine oder andere wehmütig nostalgische Erinnerung - so passender-, wie leider aber eben auch naheliegenderweise im Super8-Format umgesetzt - mögen gelungen sein und unwidersprochen ihren Zweck erfüllen, ansonsten aber herrscht über weite Strecken eine Leere, die vor allem im mangelnden Wagemut des zugrundeliegenden Drehbuchs begründet ist. Eine beißende Satire auf Befindlichkeiten, hüben wie drüben, hätte der Film werden können, ein ebenso witziger wie menschlicher Einblick in ost-deutsche Lebenswelten, widergespiegelt im Trubel der Wendezeit. Aus welchen Gründen auch immer hat man sich aber dazu entschlossen, einen Film zu drehen, der es irgendwie jedem recht machen will, der keinen vor der Kopf stoßen möchte und sich somit infolgedessen vor allem im handzahmen Kitsch ausruht. Und mal ganz ehrlich: Witze über Honecker-Bilder - ja genau, jenes mit dem blauen Hintergrund ist gemeint - an der Wand, Nudossi-Kult und Club-Cola-Zitat sind nun wirklich schon lange nicht mehr abendfüllend. Die Klischees sind soweit altbekannt, die Strategien zur Vereinnahmung - Marke nennen, Marke zeigen, unter dem Vorzeichen des behaupteten Kultes, an dem sich ausnahmslos jeder - ob mit, ob ohne "credibility" - beteiligen kann: Ein alter Hut. Diese Strategie funktioniert ja schon bei den Witzen über die Grünen und ähnliche Gutmenschelei von Florian Illies noch nicht einmal mehr bedingt, warum sollte es also hier - wenn auch mit, zugegeben, anderer Thematik - auf einmal frisch und sexy wirken? Dass die Geschichte zudem allerlei erzählerisches Beiwerk - eine Liebesgeschichte, ein wenig Schmalz von alten Wunden - mitbringt, das zwar ebenfalls recht nett ist, aber eben doch nur wie Anbiederung wirkt, um auch wirklich niemandes mediokrem Filmgeschmack zu nahe zu treten, ist nur noch obligatorisch angesichts des herrschenden Mangels an Inspiration und Experimentierfreudigkeit. Ähnliches gilt für den entliehenen Soundtrack, den man zuvor auch schon weitgehend bei der fabelhaften Amélie zu hören bekam.
Und mal ganz ehrlich: Witze über Honecker-Bilder - ja genau, jenes mit dem blauen Hintergrund ist gemeint - an der Wand, Nudossi-Kult und Club-Cola-Zitat sind nun wirklich schon lange nicht mehr abendfüllend. Die Klischees sind soweit altbekannt, die Strategien zur Vereinnahmung - Marke nennen, Marke zeigen, unter dem Vorzeichen des behaupteten Kultes, an dem sich ausnahmslos jeder - ob mit, ob ohne "credibility" - beteiligen kann: Ein alter Hut. Diese Strategie funktioniert ja schon bei den Witzen über die Grünen und ähnliche Gutmenschelei von Florian Illies noch nicht einmal mehr bedingt, warum sollte es also hier - wenn auch mit, zugegeben, anderer Thematik - auf einmal frisch und sexy wirken? Dass die Geschichte zudem allerlei erzählerisches Beiwerk - eine Liebesgeschichte, ein wenig Schmalz von alten Wunden - mitbringt, das zwar ebenfalls recht nett ist, aber eben doch nur wie Anbiederung wirkt, um auch wirklich niemandes mediokrem Filmgeschmack zu nahe zu treten, ist nur noch obligatorisch angesichts des herrschenden Mangels an Inspiration und Experimentierfreudigkeit. Ähnliches gilt für den entliehenen Soundtrack, den man zuvor auch schon weitgehend bei der fabelhaften Amélie zu hören bekam.Die DDR, das scheint der Film nahe legen zu wollen, ist von nun an bloßer Zitatenfundus, eine Schatzkammer an Klischees und Vorstellungen, die nunmehr zwecks augenzwinkernder Kult-Anleihen zur Plünderung freigegeben worden ist. Eine solche Verschiebung von Ikonen in den Bereich des "Camps" ist auch per se nichts schlechtes, ganz im Gegenteil. Das Problem jedoch in diesem Falle: Wann war die sprichwörtliche "Zone" in den Bilderwelten des Westens - Becker ist Wessi, unnötig eigentlich zu erwähnen - jemals etwas anderes?
>> Good Bye, Lenin! (Deutschland 2003)
>> Regie: Wolfgang Becker
>> Darsteller: Daniel Brühl, Katrin Saß u.a.
imdb | mrqe | angelaufen.de | filmz.de
Kommentare zur Verleihung des europäischen Filmpreises [via angelaufen.de]:
tagesspiegel | taz | spiegel | welt
° ° °
Thema: Filmtagebuch
08. Dezember 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
07.12.2003, Filmtheater am Friedrichshain
 Ein Film über den allzu offensichtlichen Anschein. Geschickt, wie Eastwood von Beginn an die Karten offenlegt und eine beinahe schon zu übersichtliche schematische Struktur entwickelt, die aber im Verlauf zunehmend das Komplexe in sich zu erkennen gibt, bis dann schließlich, ganz zum Schluß, nicht etwa ein überkonstruiertes Drehbuch mit einem gimmick ending überrascht, sondern sich innerhalb des eigentlich stets Bekannten neue Optionen auftun, die in dieser Form zuvor kaum erkennbar waren. Die Perspektive der Ermittler ist die des Zuschauers, nahezu jedenfalls, Holzwege - wiewohl nicht unbedingt die gleichen - werden diesseits wie jenseits der Leinwand begangen: Man ist, dies wird auch ausgesprochen, befangen. In der sozialen Mechanik, die sich da unheilvoll entfaktet, gefangen: Die Kamera, die in diesem Geflecht den Ausweg oft panisch zu suchen scheint, sehr oft den Himmel anschreit, nur selten die überblickende Totale über die "Flats" gewährt, am Ende dann, grimmig, in einer langen Fahrt nur in den Fluß eintauchen kann: Dorthin wo die Leichen liegen. Schwärze, kein Entkommen möglich hier.
Ein Film über den allzu offensichtlichen Anschein. Geschickt, wie Eastwood von Beginn an die Karten offenlegt und eine beinahe schon zu übersichtliche schematische Struktur entwickelt, die aber im Verlauf zunehmend das Komplexe in sich zu erkennen gibt, bis dann schließlich, ganz zum Schluß, nicht etwa ein überkonstruiertes Drehbuch mit einem gimmick ending überrascht, sondern sich innerhalb des eigentlich stets Bekannten neue Optionen auftun, die in dieser Form zuvor kaum erkennbar waren. Die Perspektive der Ermittler ist die des Zuschauers, nahezu jedenfalls, Holzwege - wiewohl nicht unbedingt die gleichen - werden diesseits wie jenseits der Leinwand begangen: Man ist, dies wird auch ausgesprochen, befangen. In der sozialen Mechanik, die sich da unheilvoll entfaktet, gefangen: Die Kamera, die in diesem Geflecht den Ausweg oft panisch zu suchen scheint, sehr oft den Himmel anschreit, nur selten die überblickende Totale über die "Flats" gewährt, am Ende dann, grimmig, in einer langen Fahrt nur in den Fluß eintauchen kann: Dorthin wo die Leichen liegen. Schwärze, kein Entkommen möglich hier.
imdb | mrqe | angelaufen.de | eastwood:tv-termine
 Ein Film über den allzu offensichtlichen Anschein. Geschickt, wie Eastwood von Beginn an die Karten offenlegt und eine beinahe schon zu übersichtliche schematische Struktur entwickelt, die aber im Verlauf zunehmend das Komplexe in sich zu erkennen gibt, bis dann schließlich, ganz zum Schluß, nicht etwa ein überkonstruiertes Drehbuch mit einem gimmick ending überrascht, sondern sich innerhalb des eigentlich stets Bekannten neue Optionen auftun, die in dieser Form zuvor kaum erkennbar waren. Die Perspektive der Ermittler ist die des Zuschauers, nahezu jedenfalls, Holzwege - wiewohl nicht unbedingt die gleichen - werden diesseits wie jenseits der Leinwand begangen: Man ist, dies wird auch ausgesprochen, befangen. In der sozialen Mechanik, die sich da unheilvoll entfaktet, gefangen: Die Kamera, die in diesem Geflecht den Ausweg oft panisch zu suchen scheint, sehr oft den Himmel anschreit, nur selten die überblickende Totale über die "Flats" gewährt, am Ende dann, grimmig, in einer langen Fahrt nur in den Fluß eintauchen kann: Dorthin wo die Leichen liegen. Schwärze, kein Entkommen möglich hier.
Ein Film über den allzu offensichtlichen Anschein. Geschickt, wie Eastwood von Beginn an die Karten offenlegt und eine beinahe schon zu übersichtliche schematische Struktur entwickelt, die aber im Verlauf zunehmend das Komplexe in sich zu erkennen gibt, bis dann schließlich, ganz zum Schluß, nicht etwa ein überkonstruiertes Drehbuch mit einem gimmick ending überrascht, sondern sich innerhalb des eigentlich stets Bekannten neue Optionen auftun, die in dieser Form zuvor kaum erkennbar waren. Die Perspektive der Ermittler ist die des Zuschauers, nahezu jedenfalls, Holzwege - wiewohl nicht unbedingt die gleichen - werden diesseits wie jenseits der Leinwand begangen: Man ist, dies wird auch ausgesprochen, befangen. In der sozialen Mechanik, die sich da unheilvoll entfaktet, gefangen: Die Kamera, die in diesem Geflecht den Ausweg oft panisch zu suchen scheint, sehr oft den Himmel anschreit, nur selten die überblickende Totale über die "Flats" gewährt, am Ende dann, grimmig, in einer langen Fahrt nur in den Fluß eintauchen kann: Dorthin wo die Leichen liegen. Schwärze, kein Entkommen möglich hier.imdb | mrqe | angelaufen.de | eastwood:tv-termine
° ° °
Thema: Filmtagebuch
06. Dezember 03 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
06.12.2003, Heimkino

Wohl einer der schönsten, melancholischsten und visionärsten Filme über den Schmerz des In-die-Welt-Geworfen-Seins. Ausführlicheres von meiner Seite hier.
imdb | mrqe | nero:tv-termine

Wohl einer der schönsten, melancholischsten und visionärsten Filme über den Schmerz des In-die-Welt-Geworfen-Seins. Ausführlicheres von meiner Seite hier.
imdb | mrqe | nero:tv-termine
° ° °
Thema: Filmtagebuch
Gutbürgerliche Wochenendausflüge mit Tier und Kegel sind in Michael Hanekes Filmen mit Vorsicht zu genießen. Das weiß man seit Funny Games (Österreich 1997). Die Stimmung in der hier beobachteten Familie scheint von Beginn an etwas gedämpft: Wortkarg, wenn nicht verschreckt reserviert räumt man den Wagen aus, das mitten im Wald gelegene Häuschen erweckt kaum Vertrauen. Heimelig ist das hier nicht, auch sehen Wochenendausflüge meist anders aus, werden freudiger begangen. Warum trägt der Kleine seinen kleinen Vogel im Käfig mit sich? Man scheint länger bleiben zu wollen. Drinnen dann der Schock: Das Haus ist besetzt, eine andere Familie hat sich eingenistet. Man wird bedroht, mit Waffengewalt geplündert. Unvermittelt dann ein Schuss, der Vater: tot. Die Mutter Anne (Isabelle Huppert) darf mit Sohn Ben (Lucas Biscombe) und Tochter Eva (Anais Demoustier) das Gelände verlassen, was stutzig macht. Wäre es nicht im Sinne der Mörder, Zeugen aus dem Weg zu räumen, sie zumindest in Gewahrsam zu halten?
 Eine Welt nach dem Zusammenbruch sozialer Verbindlich- und Verlässlichkeiten. Haneke zeichnet sein offenbar apokalyptisches Szenario nicht als historisch-politischen Weltentwurf, sondern in Form einer Verschiebung oft kleinster kultureller Details der individuellen Alltagswahrnehmung: Die Überlebenden dieses Gewaltausbruchs ziehen wie Flüchtlinge durch nebeldiesige Bildlandschaften, schlagen verzweifelt an die Türen der einstigen Nachbarn, in deren Fenstern noch Licht brennt, allein die Türen bleiben verschlossen. Auf dem Marktplatz im Dorf werden Kühe auf einem Scheiterhaufen verbrannt, hier und dort findet sich eine gnädige Seele, die ein wenig Essen spendet. Man habe ja selbst eigentlich nichts, fügt man noch hastig hinzu, das Gesicht bleibt dem Bildkader vorenthalten. Allenthalben herrscht Misstrauen, Angst, Kälte. Was geschehen war, wie es dazu kommen konnte: Das interessiert Haneke nicht, noch nicht mal in Form von Andeutungen. Politische, soziale und historische Sphären sind in Wolfzeit von keiner Bedeutung. Hier soll es um Universelles gehen, Gedankenexperiment also, Aussagen über den Mensch als solchen.
Eine Welt nach dem Zusammenbruch sozialer Verbindlich- und Verlässlichkeiten. Haneke zeichnet sein offenbar apokalyptisches Szenario nicht als historisch-politischen Weltentwurf, sondern in Form einer Verschiebung oft kleinster kultureller Details der individuellen Alltagswahrnehmung: Die Überlebenden dieses Gewaltausbruchs ziehen wie Flüchtlinge durch nebeldiesige Bildlandschaften, schlagen verzweifelt an die Türen der einstigen Nachbarn, in deren Fenstern noch Licht brennt, allein die Türen bleiben verschlossen. Auf dem Marktplatz im Dorf werden Kühe auf einem Scheiterhaufen verbrannt, hier und dort findet sich eine gnädige Seele, die ein wenig Essen spendet. Man habe ja selbst eigentlich nichts, fügt man noch hastig hinzu, das Gesicht bleibt dem Bildkader vorenthalten. Allenthalben herrscht Misstrauen, Angst, Kälte. Was geschehen war, wie es dazu kommen konnte: Das interessiert Haneke nicht, noch nicht mal in Form von Andeutungen. Politische, soziale und historische Sphären sind in Wolfzeit von keiner Bedeutung. Hier soll es um Universelles gehen, Gedankenexperiment also, Aussagen über den Mensch als solchen.
Und dieser ist, so sagt man gerne, sich selbst ein Wolf. Ganz so absolut scheint Haneke das nicht ausdrücken zu wollen, stellt es aber zumindest als einen von vielen Aspekten in den Raum. Ein namenlos bleibender Junge (Hakim Taleb), der durch die Wildnis streift, schließt sich den drei Desolaten an, wenn auch stets in Distanz verweilend. Ein Hund hat ihm in die Hand gebissen, er selbst erscheint als streunender Hund zwischen interessiertem Schnuppern, Argwohn und offener Aggressivität. Er plündert herumliegende Leichen, untersucht Tierkadaver, ob sich da nicht noch was Essbares fände, stiehlt und legt den Dreien Gleiches nahe. Zusammen findet man, in einem stillgelegten Bahnhof, eine kleine Gemeinde des Elends, die sich, gleichsam als Gegenentwurf zum atomisierenden Egoismus des Jungen, mittels selbstauferlegter Regeln ein wenig soziale Heimeligkeit zurückerobern möchte. Hier findet man, wenn schon kein Zuhause, doch ein klein wenig Tröstlichkeitssurrogat für das zoon politikon, das Gesellschaftswesen. Der Junge umkreist diese Kommune argwöhnisch wie ein Trabant, bleibt in den nahen Wäldern verschanzt, nachdem er sich nach der Ankunft umgehend als Dieb profilieren musste und, sofern sich die Gelegenheit bietet, dies auch bleibt.
Dass diese Kommune keineswegs einem Paradies der Postapokalypse entspricht, ist so naheliegend wie schnell ersichtlich. Die Knappheit der Ressourcen sorgt für Spannungen untereinander, soziale Konflikte bilden sich, zumal dann, wenn alte Ressentiments - Redneck-Prototypen mit geschulterter Flinte treffen auf einen polnischen Einwohner ihrer früheren Gemeinde - aufbrechen. Neue Mythen werden, am Rande, in den Raum gestellt: Die 36 Gerechten, die Brüder des Feuers, allesamt mehr oder weniger Versuche, in der Sinnlosigkeit dieser neuen Existenzform sinnstiftend zu fungieren. Und wer nicht handeln kann, kann, als Frau, auch andere Dienste anbieten. Bald schon ist diese neue Gemeinde auf imposante Größe angewachsen, zusammen wartet man an den Gleisen auf den rettenden Zug, der sie aus diesem Jammertal holen würde - unter diesen Wartenden bald auch die Mörder des Vaters und Gatten.
 Man kann Haneke kaum vorwerfen, seinen Film nicht mit der üblichen Sorgfalt inszeniert zu haben. Ganz im Gegenteil zeichnet sich Wolfzeit durch den gewohnt besonnenen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel aus. Haneke verteilt die üblichen Spitzen gegen etwaige Behaglichkeiten im Kinosaal und fordert damit emotional heraus. Dass er das kann, dass er es hier, wie immer, tut, sei unbestritten. Seine Bilder sind trostlos, grau, nicht selten gar zur Gänze schwarz, weil nur mit Naturlicht gedreht wurde und vieles nachts stattfindet. Doch die Nähe zu den Figuren, die das impliziert, das Sich-Winden auf dem Kinostuhl, wenn Haneke seine Geschichte vom Weltverlust und dem Verfall des Menschen unter diesen Bedingungen erzählt, all das führt zu nichts, bleibt lediglich Betrug am Zuschauer.
Man kann Haneke kaum vorwerfen, seinen Film nicht mit der üblichen Sorgfalt inszeniert zu haben. Ganz im Gegenteil zeichnet sich Wolfzeit durch den gewohnt besonnenen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel aus. Haneke verteilt die üblichen Spitzen gegen etwaige Behaglichkeiten im Kinosaal und fordert damit emotional heraus. Dass er das kann, dass er es hier, wie immer, tut, sei unbestritten. Seine Bilder sind trostlos, grau, nicht selten gar zur Gänze schwarz, weil nur mit Naturlicht gedreht wurde und vieles nachts stattfindet. Doch die Nähe zu den Figuren, die das impliziert, das Sich-Winden auf dem Kinostuhl, wenn Haneke seine Geschichte vom Weltverlust und dem Verfall des Menschen unter diesen Bedingungen erzählt, all das führt zu nichts, bleibt lediglich Betrug am Zuschauer.
Das recht alte Gedankenexperiment, das hier fortgeführt werden soll, erscheint durch Hanekes moralische Lektion weder ergänzt noch sind die Schlussfolgerungen sonderlich originelle: Dass der Verlust sozialer Verbindlichkeiten ressourcenökonomische Prekärsituationen nach sich zieht, entsprechend Menschen, der Natur nun ausgeliefert, zu Bestien zu machen in der Lage ist, dass der Mensch als solcher dadurch zerrieben wird, verloren geht, das hat sich Haneke beileibe nicht selbst ausgedacht, sondern ist grundlegendes Element jeder apokalyptischen Erzählung in Kino und Literatur der letzten Jahrzehnte. Gerade und besonders auch in den Haneke verhassten Genrefilmen. Dass Tiere, Alte, Kinder sowohl körperlich wie auch emotional und psychisch unter solchen Bedingungen erste Opfer wären, Familienstrukturen sich aufreiben, Verzweiflungstaten bis hin zum Selbstmord und -opfer Konjunktur haben und, letztendlich, die offenkundige Verzweiflung des beschwörenden "Alles wird gut!" zum letztmöglichen Strohhalm wird, all das ist ebenso wenig neue Erkenntnis und deshalb, was die bloße Aussagekraft betrifft, bestenfalls redundant, eigentlich schon banal.
Und so widerfährt Wolfzeit, der so überaus vielversprechend beginnt, das schlimmste, was einem Film mit dieser Intention geschehen kann: Er wird im Verlauf, wiewohl nicht in narrativen Details, so doch aber im wesentlichen sträflich erahnbar. Die Spitzen, die fast schon genüsslich verteilt werden, die Drastik der Bilder, wenn etwa einem Pferd vor laufender Kamera die Kehle aufgeschlitzt wird, und die so strikte wie angesichts des Stoffes auffällige Verweigerung einschlägiger Genrekonzessionen scheinen allesamt bloß einem einzigen Zweck verpflichtet zu sein: Der Inszenierung ihres Urhebers als von sich eingenommenem Mahner zur Moral, als Erretter der Filmkunst vor dem Profanen des Genre-Einerlei. Das ist, gelinde gesagt, zu wenig.
Kinostart am 01.01.2004 im Verleih der Ventura Film. Kritik auch erschienen bei jump-cut.de.
>> Wolfzeit (Le temps du loup, Frankreich 2003)
>> Regie/Drehbuch: Michael Haneke
>> Darsteller: Isabelle Huppert, Patrice Chereau, Maurice Benichou, Lucas Biscombe, u.a.
imdb | huppert:tv-termine
 Eine Welt nach dem Zusammenbruch sozialer Verbindlich- und Verlässlichkeiten. Haneke zeichnet sein offenbar apokalyptisches Szenario nicht als historisch-politischen Weltentwurf, sondern in Form einer Verschiebung oft kleinster kultureller Details der individuellen Alltagswahrnehmung: Die Überlebenden dieses Gewaltausbruchs ziehen wie Flüchtlinge durch nebeldiesige Bildlandschaften, schlagen verzweifelt an die Türen der einstigen Nachbarn, in deren Fenstern noch Licht brennt, allein die Türen bleiben verschlossen. Auf dem Marktplatz im Dorf werden Kühe auf einem Scheiterhaufen verbrannt, hier und dort findet sich eine gnädige Seele, die ein wenig Essen spendet. Man habe ja selbst eigentlich nichts, fügt man noch hastig hinzu, das Gesicht bleibt dem Bildkader vorenthalten. Allenthalben herrscht Misstrauen, Angst, Kälte. Was geschehen war, wie es dazu kommen konnte: Das interessiert Haneke nicht, noch nicht mal in Form von Andeutungen. Politische, soziale und historische Sphären sind in Wolfzeit von keiner Bedeutung. Hier soll es um Universelles gehen, Gedankenexperiment also, Aussagen über den Mensch als solchen.
Eine Welt nach dem Zusammenbruch sozialer Verbindlich- und Verlässlichkeiten. Haneke zeichnet sein offenbar apokalyptisches Szenario nicht als historisch-politischen Weltentwurf, sondern in Form einer Verschiebung oft kleinster kultureller Details der individuellen Alltagswahrnehmung: Die Überlebenden dieses Gewaltausbruchs ziehen wie Flüchtlinge durch nebeldiesige Bildlandschaften, schlagen verzweifelt an die Türen der einstigen Nachbarn, in deren Fenstern noch Licht brennt, allein die Türen bleiben verschlossen. Auf dem Marktplatz im Dorf werden Kühe auf einem Scheiterhaufen verbrannt, hier und dort findet sich eine gnädige Seele, die ein wenig Essen spendet. Man habe ja selbst eigentlich nichts, fügt man noch hastig hinzu, das Gesicht bleibt dem Bildkader vorenthalten. Allenthalben herrscht Misstrauen, Angst, Kälte. Was geschehen war, wie es dazu kommen konnte: Das interessiert Haneke nicht, noch nicht mal in Form von Andeutungen. Politische, soziale und historische Sphären sind in Wolfzeit von keiner Bedeutung. Hier soll es um Universelles gehen, Gedankenexperiment also, Aussagen über den Mensch als solchen. Und dieser ist, so sagt man gerne, sich selbst ein Wolf. Ganz so absolut scheint Haneke das nicht ausdrücken zu wollen, stellt es aber zumindest als einen von vielen Aspekten in den Raum. Ein namenlos bleibender Junge (Hakim Taleb), der durch die Wildnis streift, schließt sich den drei Desolaten an, wenn auch stets in Distanz verweilend. Ein Hund hat ihm in die Hand gebissen, er selbst erscheint als streunender Hund zwischen interessiertem Schnuppern, Argwohn und offener Aggressivität. Er plündert herumliegende Leichen, untersucht Tierkadaver, ob sich da nicht noch was Essbares fände, stiehlt und legt den Dreien Gleiches nahe. Zusammen findet man, in einem stillgelegten Bahnhof, eine kleine Gemeinde des Elends, die sich, gleichsam als Gegenentwurf zum atomisierenden Egoismus des Jungen, mittels selbstauferlegter Regeln ein wenig soziale Heimeligkeit zurückerobern möchte. Hier findet man, wenn schon kein Zuhause, doch ein klein wenig Tröstlichkeitssurrogat für das zoon politikon, das Gesellschaftswesen. Der Junge umkreist diese Kommune argwöhnisch wie ein Trabant, bleibt in den nahen Wäldern verschanzt, nachdem er sich nach der Ankunft umgehend als Dieb profilieren musste und, sofern sich die Gelegenheit bietet, dies auch bleibt.
Dass diese Kommune keineswegs einem Paradies der Postapokalypse entspricht, ist so naheliegend wie schnell ersichtlich. Die Knappheit der Ressourcen sorgt für Spannungen untereinander, soziale Konflikte bilden sich, zumal dann, wenn alte Ressentiments - Redneck-Prototypen mit geschulterter Flinte treffen auf einen polnischen Einwohner ihrer früheren Gemeinde - aufbrechen. Neue Mythen werden, am Rande, in den Raum gestellt: Die 36 Gerechten, die Brüder des Feuers, allesamt mehr oder weniger Versuche, in der Sinnlosigkeit dieser neuen Existenzform sinnstiftend zu fungieren. Und wer nicht handeln kann, kann, als Frau, auch andere Dienste anbieten. Bald schon ist diese neue Gemeinde auf imposante Größe angewachsen, zusammen wartet man an den Gleisen auf den rettenden Zug, der sie aus diesem Jammertal holen würde - unter diesen Wartenden bald auch die Mörder des Vaters und Gatten.
 Man kann Haneke kaum vorwerfen, seinen Film nicht mit der üblichen Sorgfalt inszeniert zu haben. Ganz im Gegenteil zeichnet sich Wolfzeit durch den gewohnt besonnenen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel aus. Haneke verteilt die üblichen Spitzen gegen etwaige Behaglichkeiten im Kinosaal und fordert damit emotional heraus. Dass er das kann, dass er es hier, wie immer, tut, sei unbestritten. Seine Bilder sind trostlos, grau, nicht selten gar zur Gänze schwarz, weil nur mit Naturlicht gedreht wurde und vieles nachts stattfindet. Doch die Nähe zu den Figuren, die das impliziert, das Sich-Winden auf dem Kinostuhl, wenn Haneke seine Geschichte vom Weltverlust und dem Verfall des Menschen unter diesen Bedingungen erzählt, all das führt zu nichts, bleibt lediglich Betrug am Zuschauer.
Man kann Haneke kaum vorwerfen, seinen Film nicht mit der üblichen Sorgfalt inszeniert zu haben. Ganz im Gegenteil zeichnet sich Wolfzeit durch den gewohnt besonnenen Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel aus. Haneke verteilt die üblichen Spitzen gegen etwaige Behaglichkeiten im Kinosaal und fordert damit emotional heraus. Dass er das kann, dass er es hier, wie immer, tut, sei unbestritten. Seine Bilder sind trostlos, grau, nicht selten gar zur Gänze schwarz, weil nur mit Naturlicht gedreht wurde und vieles nachts stattfindet. Doch die Nähe zu den Figuren, die das impliziert, das Sich-Winden auf dem Kinostuhl, wenn Haneke seine Geschichte vom Weltverlust und dem Verfall des Menschen unter diesen Bedingungen erzählt, all das führt zu nichts, bleibt lediglich Betrug am Zuschauer. Das recht alte Gedankenexperiment, das hier fortgeführt werden soll, erscheint durch Hanekes moralische Lektion weder ergänzt noch sind die Schlussfolgerungen sonderlich originelle: Dass der Verlust sozialer Verbindlichkeiten ressourcenökonomische Prekärsituationen nach sich zieht, entsprechend Menschen, der Natur nun ausgeliefert, zu Bestien zu machen in der Lage ist, dass der Mensch als solcher dadurch zerrieben wird, verloren geht, das hat sich Haneke beileibe nicht selbst ausgedacht, sondern ist grundlegendes Element jeder apokalyptischen Erzählung in Kino und Literatur der letzten Jahrzehnte. Gerade und besonders auch in den Haneke verhassten Genrefilmen. Dass Tiere, Alte, Kinder sowohl körperlich wie auch emotional und psychisch unter solchen Bedingungen erste Opfer wären, Familienstrukturen sich aufreiben, Verzweiflungstaten bis hin zum Selbstmord und -opfer Konjunktur haben und, letztendlich, die offenkundige Verzweiflung des beschwörenden "Alles wird gut!" zum letztmöglichen Strohhalm wird, all das ist ebenso wenig neue Erkenntnis und deshalb, was die bloße Aussagekraft betrifft, bestenfalls redundant, eigentlich schon banal.
Und so widerfährt Wolfzeit, der so überaus vielversprechend beginnt, das schlimmste, was einem Film mit dieser Intention geschehen kann: Er wird im Verlauf, wiewohl nicht in narrativen Details, so doch aber im wesentlichen sträflich erahnbar. Die Spitzen, die fast schon genüsslich verteilt werden, die Drastik der Bilder, wenn etwa einem Pferd vor laufender Kamera die Kehle aufgeschlitzt wird, und die so strikte wie angesichts des Stoffes auffällige Verweigerung einschlägiger Genrekonzessionen scheinen allesamt bloß einem einzigen Zweck verpflichtet zu sein: Der Inszenierung ihres Urhebers als von sich eingenommenem Mahner zur Moral, als Erretter der Filmkunst vor dem Profanen des Genre-Einerlei. Das ist, gelinde gesagt, zu wenig.
Kinostart am 01.01.2004 im Verleih der Ventura Film. Kritik auch erschienen bei jump-cut.de.
>> Wolfzeit (Le temps du loup, Frankreich 2003)
>> Regie/Drehbuch: Michael Haneke
>> Darsteller: Isabelle Huppert, Patrice Chereau, Maurice Benichou, Lucas Biscombe, u.a.
imdb | huppert:tv-termine
° ° °
Thema: Filmtagebuch
01. Dezember 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
01.12., Heimkino
 Burden of Dreams dokumentiert den teils chaotischen, teils dramatischen Schaffungsprozess Werner Herzogs wahnwitzigen Filmprojekts Fitzcarraldo (Deutschland/Peru, 1982). Eine der vielen Legenden besagt, Herzog habe sich selbst bei der Konzipierung des Films als den opernbegeisterten Fitzcarraldo im Sinn gehabt, der mitten im Dschungel Lateinamerikas ein Opernhaus errichten und dort Enrico Caruso auftreten lassen will. Dass letztendlich, nachdem Jason Robards krankheitsbedingt ausscheiden musste, Klaus Kinski diese Rolle übernahm, kam dem Film zugute, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wahre Fitzcarraldo nach wie vor Herzog selbst ist: Genau dies macht Les Blanks Dokumentation offenkundig. Seien es die dramatischen politischen Umstände, die den ersten Dreh - bereits im Jahr 1979 - sabotierten, sei es Robards' Ausscheiden aus der Produktion nach bereits drei Monaten Dreharbeit oder aber die Sysiphosarbeit, die Indianer, die zum Teil noch nie ein Kino zu Gesicht bekommen hatten, von dem Projekt zu überzeugen, wie, dem angeschlossen, die unwahrscheinliche logistische Arbeit, ein Schiff nicht nur durch Stromschnellen zu jagen, sondern, analog zur titelgebenden Figur, unter Inkaufnahme größter Risiken über einen Berg zu ziehen. Eine Zitterprobe, dieser Film, drei beschwerliche Jahre lang, der zusehends seine Spuren in Herzogs anfangs noch geradezu jugendlichem Gesicht hinterlässt. Les Blanks Film über diese Dreharbeiten ist ein spannendes Dokument, zum Teil nervenaufreibender als Herzogs Meisterwerk selbst und voller Fragen der Moral und der Notwendigkeit der steten Positionierung in einem Projekt wie diesem. Weder Herzog noch dieser Film weichen ihnen aus, immer wieder erlebt man Herzog alleine, weitab von den Dreharbeiten, über sein Projekt und seine Legitimität, sein Verhältnis zu diesem Land, dieser Kultur sinnierend. Abenteuerfilme, gerade solche, die von der Reise aus dem Herzen der eigenen Kultur hinaus in das Unbekannte erzählen, haben immer auch die Aufgabe, vom Einzelnen und seinem Schicksal abstrahierende Fragen zu stellen. Indem er das Abenteuer Fitzcarraldos zu seinem eigenen machte, den Dreharbeiten eines Abenteuerfilms ein wahrhaftiges Abenteuer zur Bedingung der Möglichkeit machte, wird Herzog - in einem anderen, in diesem Film - selbst zu jener archetypischen Figur. Ob es das alles wert war? Ein anderer Film ist die Antwort.
Burden of Dreams dokumentiert den teils chaotischen, teils dramatischen Schaffungsprozess Werner Herzogs wahnwitzigen Filmprojekts Fitzcarraldo (Deutschland/Peru, 1982). Eine der vielen Legenden besagt, Herzog habe sich selbst bei der Konzipierung des Films als den opernbegeisterten Fitzcarraldo im Sinn gehabt, der mitten im Dschungel Lateinamerikas ein Opernhaus errichten und dort Enrico Caruso auftreten lassen will. Dass letztendlich, nachdem Jason Robards krankheitsbedingt ausscheiden musste, Klaus Kinski diese Rolle übernahm, kam dem Film zugute, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wahre Fitzcarraldo nach wie vor Herzog selbst ist: Genau dies macht Les Blanks Dokumentation offenkundig. Seien es die dramatischen politischen Umstände, die den ersten Dreh - bereits im Jahr 1979 - sabotierten, sei es Robards' Ausscheiden aus der Produktion nach bereits drei Monaten Dreharbeit oder aber die Sysiphosarbeit, die Indianer, die zum Teil noch nie ein Kino zu Gesicht bekommen hatten, von dem Projekt zu überzeugen, wie, dem angeschlossen, die unwahrscheinliche logistische Arbeit, ein Schiff nicht nur durch Stromschnellen zu jagen, sondern, analog zur titelgebenden Figur, unter Inkaufnahme größter Risiken über einen Berg zu ziehen. Eine Zitterprobe, dieser Film, drei beschwerliche Jahre lang, der zusehends seine Spuren in Herzogs anfangs noch geradezu jugendlichem Gesicht hinterlässt. Les Blanks Film über diese Dreharbeiten ist ein spannendes Dokument, zum Teil nervenaufreibender als Herzogs Meisterwerk selbst und voller Fragen der Moral und der Notwendigkeit der steten Positionierung in einem Projekt wie diesem. Weder Herzog noch dieser Film weichen ihnen aus, immer wieder erlebt man Herzog alleine, weitab von den Dreharbeiten, über sein Projekt und seine Legitimität, sein Verhältnis zu diesem Land, dieser Kultur sinnierend. Abenteuerfilme, gerade solche, die von der Reise aus dem Herzen der eigenen Kultur hinaus in das Unbekannte erzählen, haben immer auch die Aufgabe, vom Einzelnen und seinem Schicksal abstrahierende Fragen zu stellen. Indem er das Abenteuer Fitzcarraldos zu seinem eigenen machte, den Dreharbeiten eines Abenteuerfilms ein wahrhaftiges Abenteuer zur Bedingung der Möglichkeit machte, wird Herzog - in einem anderen, in diesem Film - selbst zu jener archetypischen Figur. Ob es das alles wert war? Ein anderer Film ist die Antwort.
imdb | werner herzog film
 Burden of Dreams dokumentiert den teils chaotischen, teils dramatischen Schaffungsprozess Werner Herzogs wahnwitzigen Filmprojekts Fitzcarraldo (Deutschland/Peru, 1982). Eine der vielen Legenden besagt, Herzog habe sich selbst bei der Konzipierung des Films als den opernbegeisterten Fitzcarraldo im Sinn gehabt, der mitten im Dschungel Lateinamerikas ein Opernhaus errichten und dort Enrico Caruso auftreten lassen will. Dass letztendlich, nachdem Jason Robards krankheitsbedingt ausscheiden musste, Klaus Kinski diese Rolle übernahm, kam dem Film zugute, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wahre Fitzcarraldo nach wie vor Herzog selbst ist: Genau dies macht Les Blanks Dokumentation offenkundig. Seien es die dramatischen politischen Umstände, die den ersten Dreh - bereits im Jahr 1979 - sabotierten, sei es Robards' Ausscheiden aus der Produktion nach bereits drei Monaten Dreharbeit oder aber die Sysiphosarbeit, die Indianer, die zum Teil noch nie ein Kino zu Gesicht bekommen hatten, von dem Projekt zu überzeugen, wie, dem angeschlossen, die unwahrscheinliche logistische Arbeit, ein Schiff nicht nur durch Stromschnellen zu jagen, sondern, analog zur titelgebenden Figur, unter Inkaufnahme größter Risiken über einen Berg zu ziehen. Eine Zitterprobe, dieser Film, drei beschwerliche Jahre lang, der zusehends seine Spuren in Herzogs anfangs noch geradezu jugendlichem Gesicht hinterlässt. Les Blanks Film über diese Dreharbeiten ist ein spannendes Dokument, zum Teil nervenaufreibender als Herzogs Meisterwerk selbst und voller Fragen der Moral und der Notwendigkeit der steten Positionierung in einem Projekt wie diesem. Weder Herzog noch dieser Film weichen ihnen aus, immer wieder erlebt man Herzog alleine, weitab von den Dreharbeiten, über sein Projekt und seine Legitimität, sein Verhältnis zu diesem Land, dieser Kultur sinnierend. Abenteuerfilme, gerade solche, die von der Reise aus dem Herzen der eigenen Kultur hinaus in das Unbekannte erzählen, haben immer auch die Aufgabe, vom Einzelnen und seinem Schicksal abstrahierende Fragen zu stellen. Indem er das Abenteuer Fitzcarraldos zu seinem eigenen machte, den Dreharbeiten eines Abenteuerfilms ein wahrhaftiges Abenteuer zur Bedingung der Möglichkeit machte, wird Herzog - in einem anderen, in diesem Film - selbst zu jener archetypischen Figur. Ob es das alles wert war? Ein anderer Film ist die Antwort.
Burden of Dreams dokumentiert den teils chaotischen, teils dramatischen Schaffungsprozess Werner Herzogs wahnwitzigen Filmprojekts Fitzcarraldo (Deutschland/Peru, 1982). Eine der vielen Legenden besagt, Herzog habe sich selbst bei der Konzipierung des Films als den opernbegeisterten Fitzcarraldo im Sinn gehabt, der mitten im Dschungel Lateinamerikas ein Opernhaus errichten und dort Enrico Caruso auftreten lassen will. Dass letztendlich, nachdem Jason Robards krankheitsbedingt ausscheiden musste, Klaus Kinski diese Rolle übernahm, kam dem Film zugute, kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der wahre Fitzcarraldo nach wie vor Herzog selbst ist: Genau dies macht Les Blanks Dokumentation offenkundig. Seien es die dramatischen politischen Umstände, die den ersten Dreh - bereits im Jahr 1979 - sabotierten, sei es Robards' Ausscheiden aus der Produktion nach bereits drei Monaten Dreharbeit oder aber die Sysiphosarbeit, die Indianer, die zum Teil noch nie ein Kino zu Gesicht bekommen hatten, von dem Projekt zu überzeugen, wie, dem angeschlossen, die unwahrscheinliche logistische Arbeit, ein Schiff nicht nur durch Stromschnellen zu jagen, sondern, analog zur titelgebenden Figur, unter Inkaufnahme größter Risiken über einen Berg zu ziehen. Eine Zitterprobe, dieser Film, drei beschwerliche Jahre lang, der zusehends seine Spuren in Herzogs anfangs noch geradezu jugendlichem Gesicht hinterlässt. Les Blanks Film über diese Dreharbeiten ist ein spannendes Dokument, zum Teil nervenaufreibender als Herzogs Meisterwerk selbst und voller Fragen der Moral und der Notwendigkeit der steten Positionierung in einem Projekt wie diesem. Weder Herzog noch dieser Film weichen ihnen aus, immer wieder erlebt man Herzog alleine, weitab von den Dreharbeiten, über sein Projekt und seine Legitimität, sein Verhältnis zu diesem Land, dieser Kultur sinnierend. Abenteuerfilme, gerade solche, die von der Reise aus dem Herzen der eigenen Kultur hinaus in das Unbekannte erzählen, haben immer auch die Aufgabe, vom Einzelnen und seinem Schicksal abstrahierende Fragen zu stellen. Indem er das Abenteuer Fitzcarraldos zu seinem eigenen machte, den Dreharbeiten eines Abenteuerfilms ein wahrhaftiges Abenteuer zur Bedingung der Möglichkeit machte, wird Herzog - in einem anderen, in diesem Film - selbst zu jener archetypischen Figur. Ob es das alles wert war? Ein anderer Film ist die Antwort.imdb | werner herzog film
° ° °
lol