Thema: Filmtagebuch
15. Februar 15 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Was ich beim Festival geschrieben habe:
05.02.Im taz-plan der Berliner Ausgabe schreiben die Kritiker, auf welche Filme sie sich ganz besonders freuen. Ich freute mich - im Nachhinein: zurecht - auf Dominik Grafs Porträt/Hommage-Film über Michael Althen.
Am selben Tag brachte die taz mein Interview mit Frédéric Jaeger über die vom Verband der deutschen Filmkritik organisierte Parallelveranstaltung "Die Woche der Kritik". Ein Kommentar dazu: Eine Passage ("Da gibt es wenig Dissens, wenig Positionierung. Aber wir zeigen große Bereitschaft, das Spiel mitzuspielen.") wurde leider sinnentstellend redaktionell bearbeitet. Nicht die Woche spielt das Spiel mit, sondern die Player auf dem Markt. Mein Manuskript lautete an dieser Stelle: "Da gibt es wenig Dissens, wenig Positionierung. Aber große Bereitschaft, das Spiel mitzuspielen."
Aus diesem Anlass brachte die taz auch meinen Text über die "Woche der Kritik". Die Videoaufzeichnungen der dort geführten Gespräche kann man übrigens auf Youtube sehen.
06.02. Die taz veröffentlicht mein Interview mit Jan Soldat über dessen neuen Dokumentarfilm Haftanlage 4614. Eine taz-Leserin empört sich darüber sehr.
Große Freude bereitete mir Guy Maddin mit The Forbidden Room. Hier meine Besprechung beim Perlentaucher.
07.02. Nochmal die "Woche der Kritik": Mein kleiner taz-Bericht von der Auftaktveranstaltung.
Beim Perlentaucher schreibe ich über Jan Soldats Haftanlage 4614.
Werner Herzogs Queen of the Desert hat viele fassungslos zurückgelassen - durchaus nachvollziehbarerweise. Ich hatte dennoch meine rege Freude damit. Hier die Pressekonferenz.
08.02. Moderierter Social-Media-Kokolores: Das sind die BerlinaleMoments. In der taz finde ich diese ziemlich fad und untrollierbar
10.02. Mein Eintrag zu Werner Herzog im Staralbum der taz. Hier die erwähnte Pressekonferenz mit Nicole Kidman, im folgenden das Gespräch mit Joshua Oppenheimer:
12.02. Viel verspielte Freude statt bloßer Kunstreligiösität: Peter Greenaway überraschte mich mit seinem Film über Eisenstein in Mexiko sehr.
13.02.Auf der Genrenale im Kino Babylon diskutierte ein Podium über den deutschen Genrefilm. Es gab kostenfreie Donuts und einen kleinen Artikel von mir in der taz.
Filme, die mir auf dem Festival neben den bereits besprochenen sehr gut gefallen haben: Terrence Malicks Knight of Cups, Joshua Oppenheimers The Look of Silence und Dominik Grafs Was heißt hier Ende? Der Filmkritiker Michael Althen. Wer wissen will, was ich für verschwendete Lebenszeit gehalten habe, möge sich bitte hier erkundigen.
Fazit: So wenig Text, so wenig Filmkritik war noch nie auf einer Berlinale. Vielleicht ja auch ein Statement.
05.02.
06.02.
07.02.
08.02.
10.02.
12.02.
13.02.
Filme, die mir auf dem Festival neben den bereits besprochenen sehr gut gefallen haben: Terrence Malicks Knight of Cups, Joshua Oppenheimers The Look of Silence und Dominik Grafs Was heißt hier Ende? Der Filmkritiker Michael Althen. Wer wissen will, was ich für verschwendete Lebenszeit gehalten habe, möge sich bitte hier erkundigen.
Fazit: So wenig Text, so wenig Filmkritik war noch nie auf einer Berlinale. Vielleicht ja auch ein Statement.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
31. Januar 15 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Diese Woche kann man Jakob Lass' schönen "Love Steaks" werbefinanziert auf SpiegelOnline sehen. Zum Kinostart hatte ich für die taz einen Text geschrieben.

Auch eine Art, eine Romanze zu beginnen: „Boah, du schwitzt. Riecht man. Ist aber nicht schlimm.“ Die das im Fahrstuhl zu ihrem Gegenüber sagt, ist Lara (Lana Cooper), Köchin in einem Wellness-Hotel an der Ostseeküste, mitten im Nirgendwo – und Lara ist taff, aufbrausend, sie säuft gern.
Wenn Lara mit ihrem Wagen auf den Straßen im Umland die Aufmerksamkeit zugeknöpfter Polizisten auf sich zieht, hört sie dabei krachig-dreckigen Punk. Er wiederum, der so schwitzt, ist Clemens (Franz Rogowski), ein neuer Masseur im Hotel und so unsicher im Auftritt wie tollpatschig im Gebaren.
Untergebracht hat man Clemens in einer Wäschekammer in den oberen Etagen des Betriebs. Morgens holen ihn die Putzfrauen mit einem „Guten Morgen!“ aus den Federn, und wenn beide hier am Abend miteinander rummachen, zieht das den Unmut der Gäste aus dem gegenüberliegenden Flügel auf sich, die mangels Vorhänge unfreiwillige Zeugen des schönen Spaßes werden.
Ungleiche Partner also in einer Boy-meets-Girl- oder gleich Girl-gets-herself-a-Boy-Geschichte und damit beste Voraussetzungen für eine Liebesgeschichte am Strand, bei der es am Ende mitunter auch derbe was auf die Backen gibt. Das ist, in a nutshell, „Love Steaks“, der großartige Debütfilm von Jakob Lass, und ihm geht ein enormer Ruf voraus: Kaum eine zweite deutsche Produktion hat zuletzt auf so vielen Festivals abgeräumt und Preise eingefahren.
Und das sehr zu Recht, denn diesem Film sind die Bräsigkeiten des deutschen Bescheidenheits- und Konsensfilmemachens gehörig ausgetrieben: Schön flink, geradezu lebensbejahend ekstatisch saust die Kamera (Timon Schäppi) durch die Bedienstetenwelt hinter den Kulissen eines tristen, betäubend auf Wohlgefühl getrimmten Hotels. Der Schnitt (Gesa Jäger) stückelt den Film hektisch und roh, mitunter auch unter unbekümmerter Missachtung dessen, was das Lehrbuch rät.

Dann ist da noch der Ton: Aufregend anders, dreckig klingt dieser Film – eine Wohltat nach den sterilen Klangwelten des deutschen Förderkinos, der wahrgewordene Albtraum jedes Fernsehredakteurs. Die Leute nuscheln, wie Leute eben nuscheln. Es scheppert, klirrt und zischt, wie es in einem Betrieb eben scheppert, klirrt und zischt. Immer wieder durchfahren harte Sounds das Geschehen. Wenn Clemens seufzenden älteren Damen den Rücken massiert, ist es dem Film noch eine ganz besondere Freude, sich auf der Tonspur von miesem New-Age-Klangschrott verunreinigen zu lassen.
Schön, ja toll, was dieser Film sich traut. Er beweist in seinen Episoden und Vignetten erfrischenden Mut zum Humor: Mal ist er ganz lakonisch, trocken, ohne sich gemütlicher Skurrilität oder einlullender Beschaulichkeit zu beugen. Dann wieder ist er voll auf Slapstick gebürstet oder prüft die unterschiedlichen Weisen des Sprechens – etwa, wenn ein Manager Lara und Clemens tadelnd zurechtweist, dass die Hinterräume des Betriebs zu romantischen Tändeleien während der Arbeitszeit nicht zu missbrauchen sind – auf komisches Potenzial.
Burlesk anarchisch wird es schließlich, wenn Lara ihrem Clemens in den Tiefkühlräumen allerlei kaltes Fleisch in den Schritt hängt, weil sie seinen vor Frost eingefahrenen Minischwanz sehen will. Überhaupt, die beiden Hauptdarsteller: Selten hat man zuletzt im deutschen Kino zwei junge Darsteller mit derart ausgeprägter Freude am Spiel gesehen. Auch das, wie alles andere: ein tolles, schönes Kinoglück.
Von weit weg weht da der Geist der klassischen Komödien von Klaus Lemke herüber, man denkt kurz an „Sylvie“ oder „Amore“, mit denen „Love Steaks“ zumindest entfernt verwandt ist. Und das nicht zuletzt wegen vergleichbarer Produktionsbedingungen: „Love Steaks“ liegen Skizzen, aber kein festes Drehbuch zugrunde, einige Szenen entstanden aus dem Moment heraus. Gedreht und improvisiert wurde während des laufenden Hotelbetriebs unter Bedingungen, die notgedrungen erfinderisch machen.
Schon mit diesem Konzept steht man außerhalb der rigiden Vorgaben des hiesigen Fördersystems: Dem Film tut das in jeder Hinsicht gut. „Love Steaks“ atmet weder den Geist von Kultur mit großem K noch den des im deutschen Kino so nervigen Professionalismus-Gehampels von Berufszynikern. Stattdessen drehen hier Leute mit ordentlich Heißhunger ihren ersten großen Film – mit nichts als reiner Hingabe. Das macht zwar nicht reich und Sicherheiten schafft es auch nicht. Aber es macht sehr, sehr frei.

Auch eine Art, eine Romanze zu beginnen: „Boah, du schwitzt. Riecht man. Ist aber nicht schlimm.“ Die das im Fahrstuhl zu ihrem Gegenüber sagt, ist Lara (Lana Cooper), Köchin in einem Wellness-Hotel an der Ostseeküste, mitten im Nirgendwo – und Lara ist taff, aufbrausend, sie säuft gern.
Wenn Lara mit ihrem Wagen auf den Straßen im Umland die Aufmerksamkeit zugeknöpfter Polizisten auf sich zieht, hört sie dabei krachig-dreckigen Punk. Er wiederum, der so schwitzt, ist Clemens (Franz Rogowski), ein neuer Masseur im Hotel und so unsicher im Auftritt wie tollpatschig im Gebaren.
Untergebracht hat man Clemens in einer Wäschekammer in den oberen Etagen des Betriebs. Morgens holen ihn die Putzfrauen mit einem „Guten Morgen!“ aus den Federn, und wenn beide hier am Abend miteinander rummachen, zieht das den Unmut der Gäste aus dem gegenüberliegenden Flügel auf sich, die mangels Vorhänge unfreiwillige Zeugen des schönen Spaßes werden.
Ungleiche Partner also in einer Boy-meets-Girl- oder gleich Girl-gets-herself-a-Boy-Geschichte und damit beste Voraussetzungen für eine Liebesgeschichte am Strand, bei der es am Ende mitunter auch derbe was auf die Backen gibt. Das ist, in a nutshell, „Love Steaks“, der großartige Debütfilm von Jakob Lass, und ihm geht ein enormer Ruf voraus: Kaum eine zweite deutsche Produktion hat zuletzt auf so vielen Festivals abgeräumt und Preise eingefahren.
Und das sehr zu Recht, denn diesem Film sind die Bräsigkeiten des deutschen Bescheidenheits- und Konsensfilmemachens gehörig ausgetrieben: Schön flink, geradezu lebensbejahend ekstatisch saust die Kamera (Timon Schäppi) durch die Bedienstetenwelt hinter den Kulissen eines tristen, betäubend auf Wohlgefühl getrimmten Hotels. Der Schnitt (Gesa Jäger) stückelt den Film hektisch und roh, mitunter auch unter unbekümmerter Missachtung dessen, was das Lehrbuch rät.

Dann ist da noch der Ton: Aufregend anders, dreckig klingt dieser Film – eine Wohltat nach den sterilen Klangwelten des deutschen Förderkinos, der wahrgewordene Albtraum jedes Fernsehredakteurs. Die Leute nuscheln, wie Leute eben nuscheln. Es scheppert, klirrt und zischt, wie es in einem Betrieb eben scheppert, klirrt und zischt. Immer wieder durchfahren harte Sounds das Geschehen. Wenn Clemens seufzenden älteren Damen den Rücken massiert, ist es dem Film noch eine ganz besondere Freude, sich auf der Tonspur von miesem New-Age-Klangschrott verunreinigen zu lassen.
Schön, ja toll, was dieser Film sich traut. Er beweist in seinen Episoden und Vignetten erfrischenden Mut zum Humor: Mal ist er ganz lakonisch, trocken, ohne sich gemütlicher Skurrilität oder einlullender Beschaulichkeit zu beugen. Dann wieder ist er voll auf Slapstick gebürstet oder prüft die unterschiedlichen Weisen des Sprechens – etwa, wenn ein Manager Lara und Clemens tadelnd zurechtweist, dass die Hinterräume des Betriebs zu romantischen Tändeleien während der Arbeitszeit nicht zu missbrauchen sind – auf komisches Potenzial.
Burlesk anarchisch wird es schließlich, wenn Lara ihrem Clemens in den Tiefkühlräumen allerlei kaltes Fleisch in den Schritt hängt, weil sie seinen vor Frost eingefahrenen Minischwanz sehen will. Überhaupt, die beiden Hauptdarsteller: Selten hat man zuletzt im deutschen Kino zwei junge Darsteller mit derart ausgeprägter Freude am Spiel gesehen. Auch das, wie alles andere: ein tolles, schönes Kinoglück.
Von weit weg weht da der Geist der klassischen Komödien von Klaus Lemke herüber, man denkt kurz an „Sylvie“ oder „Amore“, mit denen „Love Steaks“ zumindest entfernt verwandt ist. Und das nicht zuletzt wegen vergleichbarer Produktionsbedingungen: „Love Steaks“ liegen Skizzen, aber kein festes Drehbuch zugrunde, einige Szenen entstanden aus dem Moment heraus. Gedreht und improvisiert wurde während des laufenden Hotelbetriebs unter Bedingungen, die notgedrungen erfinderisch machen.
Schon mit diesem Konzept steht man außerhalb der rigiden Vorgaben des hiesigen Fördersystems: Dem Film tut das in jeder Hinsicht gut. „Love Steaks“ atmet weder den Geist von Kultur mit großem K noch den des im deutschen Kino so nervigen Professionalismus-Gehampels von Berufszynikern. Stattdessen drehen hier Leute mit ordentlich Heißhunger ihren ersten großen Film – mit nichts als reiner Hingabe. Das macht zwar nicht reich und Sicherheiten schafft es auch nicht. Aber es macht sehr, sehr frei.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
14. Januar 15 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen im Perlentaucher)

Gegen diesen öffentlichen Raum hilft kein Adblocker: Wenn Qohen Leth (Christoph Waltz) in schwarzer Montur seine karge Behausung einer verfallenen Kathedrale verlässt, um ins Neonlicht zu treten, sieht er sich mit dem nervösen Albtraum einer durchkommerzialisierten Öffentlichkeit konfrontiert, in der maximale Individuierung und Adressierung den Gang zum Bus zum Spießrutenlauf macht. Es flimmert, quietscht und bimmelt, es flackert, schranzt und dengelt - klickibunti, jalla jalla, macht dieses ADHS-Paradies auf Speed, ein Ringen und Kämpfen, Stoßen und Drängen um die Aufmerksamkeit des sich mehr und mehr in sich verschalenden Subjekts, das sich, mit Ausnahme Qohens, längst schon die bunt-dekadente Camouflage gerettet hat und in diesem Wimmelbild von der allgegenwärtigen flashy Werbung kaum mehr zu unterscheiden ist.
Burlesker Überschuss, Ekstase des Skurrilen - ein typisches Terry-Gilliam-Feuerwerk, das die ersten Minuten von "Zero Theorem" abfackeln, inspiriert von alten Underground-Science-Fiction-Comics genauso wie von der auch schon gut ins Alter gekommenen, filmischen Postmoderne der achtziger Jahre. Ein klein wenig verzweifelt wirkt es allerdings schon, wie Gilliam hier in Sound, Look und Feeling seine Paranoia-Klassiker "Brazil" (1985) und "12 Monkeys" (1995) fortschreiben will. Und die Zeichen verweisen deutlich darauf, dass Gilliam uns hier etwas sagen möchte: Dieses London der Zukunft, ein schrilles Gadget-London, das seine Bewohner auf Werbebotschaften-Adressaten und Laufrad-Bewohner einer nicht mehr durchschaubaren, von Gadgets und Displays zugestellten Welt oder gleich zu bloßen Display-Solipsisten deklassiert, soll wohl schon auch eine Extrapolation heutiger Umstände darstellen. Nach dem Motto: Seht nur, worauf wir zusteuern, wir Smartphone- und Tablet-Sozialkrüppel. Dass Gilliam andererseits viel zu verliebt ins Gewusel und Gewimmel seiner farbenprächtigen Ausstattung ist, reibt sich daran etwas.

Inmitten des Treibens, als gehetzte Gestalt und Leerstelle zugleich: Besagter Qohen Leth, der in seiner Kathedrale dem Sinn des Lebens hinterher fuhrwerkt, im Auftrag von "Management", dem Großen Bruder dieses dystopischen Szenarios. Er fuchtelt und werkelt an obskuren Maschinen, spricht von sich im Plural, leidet an Depressionen und völliger Persönlichkeitsermangelung - und ist vielleicht gerade deshalb das letzte Exemplar des wahren Menschen, das sich Gilliam unter den hochtechnisierten Bedingungen seiner Erzählwelt vorstellen kann. Eine auf CD-ROM hinterlegte Psychotherapeutin - mitunter famos: Tilda Swinton mit Mut zur gewagten Frisur - legt den glatzköpfigen Lebenssinnsucher denn auch bald auf die Couch. Unausgesprochen bleibt dabei, dass dieser Qohen tatsächlich ein getriebener Spielball einer fremden Macht ist, die allerdings ganz außerhalb des Geschehens steht: Für Christoph Waltz ist Qohen das ideale Vehikel für seine Manierismen, deren Reiz sich nach zweimal Tarantino samt Oskar sich nun auch langsam mal erschöpft hat. Oder kurz: Die längst zu nerven beginnen.
Wie im übrigen auch Gilliams auf Krawall gebürsteter Kulturpessimismus. Wie schon in seinem "Parnassus"-Film 2009 artikuliert er hier ein Misstrauen gegen unsere gewiss auch schöne neue Welt, das sich einerseits sehr im Liebreiz deren Zerstreuungsangebote verstrickt, ihr andererseits aber auch im wesentlichen unverständig gegenüber steht. Terry Gilliam, eine Art Frank Schirrmacher des fantastischen Kinos sozusagen: Wo der Feuilletonleiter zermanschte Gehirne sah, sieht der andere einen einzigen Wust an Neurosen, Narzissmen und Depressionen. Dass gerade im Zeitalter von Social Media und mobilem Netz Menschen mehr denn je miteinander kommunizieren - wenn auch freilich nicht mit jenen im unmittelbaren Umfeld - bleibt Gillliam ebenso unzugänglich wie die Tatsache, was für ein Zeitalter der Vereinzelung und Isolation insbesondere die alte Buchgalaxis gewesen ist, nach der sich Gilliam mit seinen etwas vergilbten Vorstellungen menschlicher Imagination offenbar zu sehnen scheint.

Gegen diesen öffentlichen Raum hilft kein Adblocker: Wenn Qohen Leth (Christoph Waltz) in schwarzer Montur seine karge Behausung einer verfallenen Kathedrale verlässt, um ins Neonlicht zu treten, sieht er sich mit dem nervösen Albtraum einer durchkommerzialisierten Öffentlichkeit konfrontiert, in der maximale Individuierung und Adressierung den Gang zum Bus zum Spießrutenlauf macht. Es flimmert, quietscht und bimmelt, es flackert, schranzt und dengelt - klickibunti, jalla jalla, macht dieses ADHS-Paradies auf Speed, ein Ringen und Kämpfen, Stoßen und Drängen um die Aufmerksamkeit des sich mehr und mehr in sich verschalenden Subjekts, das sich, mit Ausnahme Qohens, längst schon die bunt-dekadente Camouflage gerettet hat und in diesem Wimmelbild von der allgegenwärtigen flashy Werbung kaum mehr zu unterscheiden ist.
Burlesker Überschuss, Ekstase des Skurrilen - ein typisches Terry-Gilliam-Feuerwerk, das die ersten Minuten von "Zero Theorem" abfackeln, inspiriert von alten Underground-Science-Fiction-Comics genauso wie von der auch schon gut ins Alter gekommenen, filmischen Postmoderne der achtziger Jahre. Ein klein wenig verzweifelt wirkt es allerdings schon, wie Gilliam hier in Sound, Look und Feeling seine Paranoia-Klassiker "Brazil" (1985) und "12 Monkeys" (1995) fortschreiben will. Und die Zeichen verweisen deutlich darauf, dass Gilliam uns hier etwas sagen möchte: Dieses London der Zukunft, ein schrilles Gadget-London, das seine Bewohner auf Werbebotschaften-Adressaten und Laufrad-Bewohner einer nicht mehr durchschaubaren, von Gadgets und Displays zugestellten Welt oder gleich zu bloßen Display-Solipsisten deklassiert, soll wohl schon auch eine Extrapolation heutiger Umstände darstellen. Nach dem Motto: Seht nur, worauf wir zusteuern, wir Smartphone- und Tablet-Sozialkrüppel. Dass Gilliam andererseits viel zu verliebt ins Gewusel und Gewimmel seiner farbenprächtigen Ausstattung ist, reibt sich daran etwas.

Inmitten des Treibens, als gehetzte Gestalt und Leerstelle zugleich: Besagter Qohen Leth, der in seiner Kathedrale dem Sinn des Lebens hinterher fuhrwerkt, im Auftrag von "Management", dem Großen Bruder dieses dystopischen Szenarios. Er fuchtelt und werkelt an obskuren Maschinen, spricht von sich im Plural, leidet an Depressionen und völliger Persönlichkeitsermangelung - und ist vielleicht gerade deshalb das letzte Exemplar des wahren Menschen, das sich Gilliam unter den hochtechnisierten Bedingungen seiner Erzählwelt vorstellen kann. Eine auf CD-ROM hinterlegte Psychotherapeutin - mitunter famos: Tilda Swinton mit Mut zur gewagten Frisur - legt den glatzköpfigen Lebenssinnsucher denn auch bald auf die Couch. Unausgesprochen bleibt dabei, dass dieser Qohen tatsächlich ein getriebener Spielball einer fremden Macht ist, die allerdings ganz außerhalb des Geschehens steht: Für Christoph Waltz ist Qohen das ideale Vehikel für seine Manierismen, deren Reiz sich nach zweimal Tarantino samt Oskar sich nun auch langsam mal erschöpft hat. Oder kurz: Die längst zu nerven beginnen.
Wie im übrigen auch Gilliams auf Krawall gebürsteter Kulturpessimismus. Wie schon in seinem "Parnassus"-Film 2009 artikuliert er hier ein Misstrauen gegen unsere gewiss auch schöne neue Welt, das sich einerseits sehr im Liebreiz deren Zerstreuungsangebote verstrickt, ihr andererseits aber auch im wesentlichen unverständig gegenüber steht. Terry Gilliam, eine Art Frank Schirrmacher des fantastischen Kinos sozusagen: Wo der Feuilletonleiter zermanschte Gehirne sah, sieht der andere einen einzigen Wust an Neurosen, Narzissmen und Depressionen. Dass gerade im Zeitalter von Social Media und mobilem Netz Menschen mehr denn je miteinander kommunizieren - wenn auch freilich nicht mit jenen im unmittelbaren Umfeld - bleibt Gillliam ebenso unzugänglich wie die Tatsache, was für ein Zeitalter der Vereinzelung und Isolation insbesondere die alte Buchgalaxis gewesen ist, nach der sich Gilliam mit seinen etwas vergilbten Vorstellungen menschlicher Imagination offenbar zu sehnen scheint.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
11. Januar 15 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(am kommenden Montag zeigt das Berliner Kino Moviemento den DIY-Dokumentarfilm "Rock, Rage and Self-Defense". Vergangenen Donnerstag brachte die taz meine Besprechung dazu)
Seattle, frühe Neunziger. Eine vitale lokale Musikszene, die sich aus dem ursprünglichen Punk-Underground, dem politischen Hardcore und Alternativ-Rock speist, rückt mit Nirvanas überraschenden Erfolg schlagartig in den Fokus des weltweiten Musikbetriebs. Ein paar desillusionierte bis depressive Jungs erobern erst MTV, dann die Titelseiten der großen Musikblätter und schließlich die ganze Welt.
So zumindest das gängige Narrativ. Dass in Seattle weder eine homogene Szene noch ein homogener Sound herrschte, dass für jedes lanciertes Produkt der Majors ein Dutzend unabhängiger Bands unbeachtet blieb, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Doch blieben die Frauen der Seattler Szene auch in diesen nachgereichten Ausdifferenzierungen bislang auffallend ausgespart. Dabei gab es sie in großer Zahl - und sie haben verdammt viel zu erzählen, wie sich nun anhand der Oral-History-Doku "Rock, Rage and Self Defense" über die Gründung der Initiative "Home Alive" aus dem Punk-Spirit des "Do it yourself" nachvollziehen lässt. Dabei handelte es sich um eine basisdemokratische Initiative, die - Jahre vor dem Siegeszug des World Wide Web, das den Zugriff auf Wissen demokratisierte - nicht nur Informationen über Rape Culture streute und der maßregelnden Rhetorik, die Frauen dafür verantwortlich macht, wenn sie vergewaltigt werden, etwas entgegensetzte, sondern auch und in erster Linie Frauen in kostengünstigen Kursen das nötige praktische Wissen vermittelte, um sich im Falle eines Falles gegen Täter effektiv zur Wehr zu setzen. Den traurigen Anlass zu dieser Vernetzung zur Selbsthilfe bildete die Vergewaltigung und Ermordung von Mia Zapata, Frontfrau der Punkband The Gits, im Jahr 1993.

Für ihre Oral History lassen die Regisseurinnen Leah Michaels und Rozz Therrien nun die zahlreichen Gründerinnen und Protagonistinnen der seitdem von vielen weiteren Frauen betreuten Organisation ausführlich zu Wort kommen. Anders als in üblichen Gute-Laune-Rockumentarys über sich zusammenraufende Underdogs geht es hier nicht bloß um die emblematische Verdichtung einer zweifellos beeindruckenden Erfolgsgeschichte, sondern um konkrete Erfahrungen: Neben den zahlreichen Ermüdungserscheinungen und nagenden Diskussionen, die jede um Konsens-Entscheidungen bemühte Initiative nach sich zieht, stehen deshalb auch die Schockwellen, die der Fall Zapata durch die Szene trieb, im Mittelpunkt: Waren vormalige Szenetreffpunkte womöglich doch keine sicheren Orte? Kannte Zapata ihren Vergewaltiger und Mörder? War er vielleicht sogar selbst Teil dieser Szene?
Anders als die ebenfalls in der Punkszene von Kathleen Hanna losgetretene, ungleich bekanntere "Riot Grrrl"-Bewegung blieb "Home Alive" lange Zeit ein in erster Linie regionales Phänomen: Ein unbesungenes Stück feministische Geschichte, das mit diesem Film dem Vergessen ein wenig entrissen wird. Dass dieser aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel eher roh und ein wenig nach "learning by doing" aussieht, passt auch ästhetisch gut zu diesem Stoff über die Selbstermächtigung der Marginalisierten: Michaels und Therrien haben keinen professionellen Film-Background, auf die Geschichte von "Home Alive" stießen sie bei einem Uni-Seminar über Indie-Rock und Underground-Musikszenen.
So fallen die Geschichte von "Home Alive" und dieses Films darüber gut in eins: Vernetzung, Solidarität und eine gemeinsam getragene Initiative können Dinge zum Besseren in Bewegung bringen. Zur Erfolgsgeschichte von "Rock, Rage and Self Defense" zählt daher eben auch, dass er als ursprüngliches Seminarprojekt nun auf internationale Kinotour geht - unabhängig vom Gutdünken etablierter Filmverleiher und Festivals, aber auf der Basis eines internationalen Netzwerks von Aktivistinnen.
Wertvoll ist dieser Film deshalb nicht nur wegen der historisch festgehaltenen Erfahrungen der "Home Alive"-Gründerinnen, sondern auch wegen seiner Message für heutige, von einzelnen Subkulturen längst losgelöste feministische Bewegungen: Raus aus der Vereinzelung - gemeinsam sind wir stark!
Seattle, frühe Neunziger. Eine vitale lokale Musikszene, die sich aus dem ursprünglichen Punk-Underground, dem politischen Hardcore und Alternativ-Rock speist, rückt mit Nirvanas überraschenden Erfolg schlagartig in den Fokus des weltweiten Musikbetriebs. Ein paar desillusionierte bis depressive Jungs erobern erst MTV, dann die Titelseiten der großen Musikblätter und schließlich die ganze Welt.
So zumindest das gängige Narrativ. Dass in Seattle weder eine homogene Szene noch ein homogener Sound herrschte, dass für jedes lanciertes Produkt der Majors ein Dutzend unabhängiger Bands unbeachtet blieb, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Doch blieben die Frauen der Seattler Szene auch in diesen nachgereichten Ausdifferenzierungen bislang auffallend ausgespart. Dabei gab es sie in großer Zahl - und sie haben verdammt viel zu erzählen, wie sich nun anhand der Oral-History-Doku "Rock, Rage and Self Defense" über die Gründung der Initiative "Home Alive" aus dem Punk-Spirit des "Do it yourself" nachvollziehen lässt. Dabei handelte es sich um eine basisdemokratische Initiative, die - Jahre vor dem Siegeszug des World Wide Web, das den Zugriff auf Wissen demokratisierte - nicht nur Informationen über Rape Culture streute und der maßregelnden Rhetorik, die Frauen dafür verantwortlich macht, wenn sie vergewaltigt werden, etwas entgegensetzte, sondern auch und in erster Linie Frauen in kostengünstigen Kursen das nötige praktische Wissen vermittelte, um sich im Falle eines Falles gegen Täter effektiv zur Wehr zu setzen. Den traurigen Anlass zu dieser Vernetzung zur Selbsthilfe bildete die Vergewaltigung und Ermordung von Mia Zapata, Frontfrau der Punkband The Gits, im Jahr 1993.

Für ihre Oral History lassen die Regisseurinnen Leah Michaels und Rozz Therrien nun die zahlreichen Gründerinnen und Protagonistinnen der seitdem von vielen weiteren Frauen betreuten Organisation ausführlich zu Wort kommen. Anders als in üblichen Gute-Laune-Rockumentarys über sich zusammenraufende Underdogs geht es hier nicht bloß um die emblematische Verdichtung einer zweifellos beeindruckenden Erfolgsgeschichte, sondern um konkrete Erfahrungen: Neben den zahlreichen Ermüdungserscheinungen und nagenden Diskussionen, die jede um Konsens-Entscheidungen bemühte Initiative nach sich zieht, stehen deshalb auch die Schockwellen, die der Fall Zapata durch die Szene trieb, im Mittelpunkt: Waren vormalige Szenetreffpunkte womöglich doch keine sicheren Orte? Kannte Zapata ihren Vergewaltiger und Mörder? War er vielleicht sogar selbst Teil dieser Szene?
Anders als die ebenfalls in der Punkszene von Kathleen Hanna losgetretene, ungleich bekanntere "Riot Grrrl"-Bewegung blieb "Home Alive" lange Zeit ein in erster Linie regionales Phänomen: Ein unbesungenes Stück feministische Geschichte, das mit diesem Film dem Vergessen ein wenig entrissen wird. Dass dieser aufgrund der zur Verfügung stehenden Mittel eher roh und ein wenig nach "learning by doing" aussieht, passt auch ästhetisch gut zu diesem Stoff über die Selbstermächtigung der Marginalisierten: Michaels und Therrien haben keinen professionellen Film-Background, auf die Geschichte von "Home Alive" stießen sie bei einem Uni-Seminar über Indie-Rock und Underground-Musikszenen.
So fallen die Geschichte von "Home Alive" und dieses Films darüber gut in eins: Vernetzung, Solidarität und eine gemeinsam getragene Initiative können Dinge zum Besseren in Bewegung bringen. Zur Erfolgsgeschichte von "Rock, Rage and Self Defense" zählt daher eben auch, dass er als ursprüngliches Seminarprojekt nun auf internationale Kinotour geht - unabhängig vom Gutdünken etablierter Filmverleiher und Festivals, aber auf der Basis eines internationalen Netzwerks von Aktivistinnen.
Wertvoll ist dieser Film deshalb nicht nur wegen der historisch festgehaltenen Erfahrungen der "Home Alive"-Gründerinnen, sondern auch wegen seiner Message für heutige, von einzelnen Subkulturen längst losgelöste feministische Bewegungen: Raus aus der Vereinzelung - gemeinsam sind wir stark!
° ° °
Thema: Filmtagebuch
08. Januar 15 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen in der taz)

Manchmal packt einen das Schicksal bei den Eiern. Pech für den an Hodenkrebs erkrankten Vorstand der französischen Phenix-Bank, Jack Marmande (Daniel Mesguich), der beim Golfspiel mit Hand im Schritt zusammenbricht. Glück für den Emporkömmling Marc Tourneuil (Gad Elmaleh), den die siechen Testikel seines Chefs auf den Thron der Bank katapultieren.
Als vermeintlich schwacher Interimsherrscher wurde er von den Silberrücken des Finanz-Hofstaats freilich ganz bewusst dahin platziert, in der Hoffnung, den jungen Tourneuil souverän aus dem Hintergrund dirigieren zu können. Als erste demütigende Maßnahme wird sein Gehalt dramatisch gekürzt.
Doch die Sache läuft anders: Kühl boxt sich Tourneuil nicht nur gegen interne Widerstände durch, sondern ergreift gesellschaftlich brachiale Maßnahmen zur Modernisierung des Unternehmens, die er nach außen als Charmeur verkauft, während er sich im skrupellosen Finanzpoker mit einem amerikanischen Hedgefonds nicht in die Karten blicken lässt. Regulierungen, ethische Überzeugungen, soziale Verträglichkeit – Ballast!
Denunzierte Martin Scorsese mit seinem „Wolf of Wall Street“ im vergangenen Jahr die moralisch verkommene Welt des Finanzgeschäfts noch grell überspitzt als eine des entfesselten Exzesses, wählt Costa-Gavras in seinem (zuvor entstandenen) Film „Le Capital“ den entgegengesetzten Weg – nicht zuletzt wohl auch, um die (auch innerhalb des Plots so in Position gebrachte) Differenz zwischen amerikanisch-hedonistischem und europäisch-verwaltendem Kapitalismus zu unterstreichen.
Zwar ziehen in beiden Filmen Neurotiker die Strippen, doch entwirft der Altmeister des politischen Thrillers im Gegensatz zu Scorseses zornig-zynischem, alle Grenzen sprengenden Punkrock-Movie ein Shakespeare-artiges, analog zu seiner Hauptfigur oft nur schwer durchschaubares Sittengemälde. Das spielt sich im wesentlichen im Dialog – mit oft schneidenden, aber kontrollierten Kameraschwenks – und im Innern der Machtzentralen des Bankensystems ab.

Scorseses Film ist so amerikanisch und ehrlich wie fettige Fritten und Super-Sized-Cola; genauso offen trägt Leonardo DiCaprio die Verkorkstheiten seiner Figur zur Schau. Erst in der letzten Einstellung seines Films schlägt Costa-Gavras einen Bogen in diese Richtung. Bis dahin ist Elmalehs Tourneuil ein klassischer Anzugträger, in der Exekution seiner Pläne kalt und funktional, die Abgründe seiner Psyche – kurz blitzen sie in Tagträumen auf – hinter der Karrieremaske gut versteckt.
Und anders als der DiCaprio’sche Aufreißer ist er eine ziemliche Pfeife: Selbst noch beim Date mit dem dekorativen Jetset-Model Nassim (Liya Kebede) ist er „angezogen wie ein Banker“, woraufhin er sich, frisch ertappt, Luft am Kragen verschafft und auch ansonsten als lächerliche Figur das Nachsehen hat.
Ein klassisches Königshof-Intrigendrama vor alteuropäischer Kulisse, in die sich zusehends die Gadgets des internationalen Kapitalismus einschleichen: „Le Capital“ zeichnet ein Bild der Transformation, der Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft an Regierung und Öffentlichkeit vorbei (der englische Verleihtitel „Capital“ lässt sich eben nicht nur als Marx-Anspielung, sondern auch als „Hauptstadt“ verstehen).
Moralische Einwände, die ein Onkel an Tourneuil bei einem fast schon anachronistischen Großfamilienessen – Tourneuil und seinesgleichen zerfasern gesellschaftliche Zusammenhänge, wie er einmal feststellt – richtet, werden lächelnd weggeputzt: „Deine Generation wollte den Internationalismus, wir haben ihn umgesetzt.“ Dann klingelt das Telefon, Anruf aus New York: „Geld schläft nie.“
Zwar setzt Costa-Gavras nichts ins Bild, was man seit der großen Finanzkrise 2008 nicht ohnehin schon wissen kann. Zu berücksichtigen ist da, dass Elmaleh in Frankreich vor allem als Stand-up-Comedian bekannt ist.
Hinter der Fassade des kühlen Finanzthrillers verbirgt sich daher vielleicht doch eine gallige Komödie, die sich gerade darüber amüsiert, dass einem hier nichts Neues erzählt wird und diese von jeder sozialen Wirklichkeit abgeschottete Welt, die umso schmerzhafter auf diese Wirklichkeit wirkt, dennoch munter weitermacht. Bis sie eines Tages in die Luft fliegt. Das sind dann auch die letzten Worte. Eine Handlungsanweisung? Harte Schwarzblende.

Manchmal packt einen das Schicksal bei den Eiern. Pech für den an Hodenkrebs erkrankten Vorstand der französischen Phenix-Bank, Jack Marmande (Daniel Mesguich), der beim Golfspiel mit Hand im Schritt zusammenbricht. Glück für den Emporkömmling Marc Tourneuil (Gad Elmaleh), den die siechen Testikel seines Chefs auf den Thron der Bank katapultieren.
Als vermeintlich schwacher Interimsherrscher wurde er von den Silberrücken des Finanz-Hofstaats freilich ganz bewusst dahin platziert, in der Hoffnung, den jungen Tourneuil souverän aus dem Hintergrund dirigieren zu können. Als erste demütigende Maßnahme wird sein Gehalt dramatisch gekürzt.
Doch die Sache läuft anders: Kühl boxt sich Tourneuil nicht nur gegen interne Widerstände durch, sondern ergreift gesellschaftlich brachiale Maßnahmen zur Modernisierung des Unternehmens, die er nach außen als Charmeur verkauft, während er sich im skrupellosen Finanzpoker mit einem amerikanischen Hedgefonds nicht in die Karten blicken lässt. Regulierungen, ethische Überzeugungen, soziale Verträglichkeit – Ballast!
Denunzierte Martin Scorsese mit seinem „Wolf of Wall Street“ im vergangenen Jahr die moralisch verkommene Welt des Finanzgeschäfts noch grell überspitzt als eine des entfesselten Exzesses, wählt Costa-Gavras in seinem (zuvor entstandenen) Film „Le Capital“ den entgegengesetzten Weg – nicht zuletzt wohl auch, um die (auch innerhalb des Plots so in Position gebrachte) Differenz zwischen amerikanisch-hedonistischem und europäisch-verwaltendem Kapitalismus zu unterstreichen.
Zwar ziehen in beiden Filmen Neurotiker die Strippen, doch entwirft der Altmeister des politischen Thrillers im Gegensatz zu Scorseses zornig-zynischem, alle Grenzen sprengenden Punkrock-Movie ein Shakespeare-artiges, analog zu seiner Hauptfigur oft nur schwer durchschaubares Sittengemälde. Das spielt sich im wesentlichen im Dialog – mit oft schneidenden, aber kontrollierten Kameraschwenks – und im Innern der Machtzentralen des Bankensystems ab.

Scorseses Film ist so amerikanisch und ehrlich wie fettige Fritten und Super-Sized-Cola; genauso offen trägt Leonardo DiCaprio die Verkorkstheiten seiner Figur zur Schau. Erst in der letzten Einstellung seines Films schlägt Costa-Gavras einen Bogen in diese Richtung. Bis dahin ist Elmalehs Tourneuil ein klassischer Anzugträger, in der Exekution seiner Pläne kalt und funktional, die Abgründe seiner Psyche – kurz blitzen sie in Tagträumen auf – hinter der Karrieremaske gut versteckt.
Und anders als der DiCaprio’sche Aufreißer ist er eine ziemliche Pfeife: Selbst noch beim Date mit dem dekorativen Jetset-Model Nassim (Liya Kebede) ist er „angezogen wie ein Banker“, woraufhin er sich, frisch ertappt, Luft am Kragen verschafft und auch ansonsten als lächerliche Figur das Nachsehen hat.
Ein klassisches Königshof-Intrigendrama vor alteuropäischer Kulisse, in die sich zusehends die Gadgets des internationalen Kapitalismus einschleichen: „Le Capital“ zeichnet ein Bild der Transformation, der Abschaffung der sozialen Marktwirtschaft an Regierung und Öffentlichkeit vorbei (der englische Verleihtitel „Capital“ lässt sich eben nicht nur als Marx-Anspielung, sondern auch als „Hauptstadt“ verstehen).
Moralische Einwände, die ein Onkel an Tourneuil bei einem fast schon anachronistischen Großfamilienessen – Tourneuil und seinesgleichen zerfasern gesellschaftliche Zusammenhänge, wie er einmal feststellt – richtet, werden lächelnd weggeputzt: „Deine Generation wollte den Internationalismus, wir haben ihn umgesetzt.“ Dann klingelt das Telefon, Anruf aus New York: „Geld schläft nie.“
Zwar setzt Costa-Gavras nichts ins Bild, was man seit der großen Finanzkrise 2008 nicht ohnehin schon wissen kann. Zu berücksichtigen ist da, dass Elmaleh in Frankreich vor allem als Stand-up-Comedian bekannt ist.
Hinter der Fassade des kühlen Finanzthrillers verbirgt sich daher vielleicht doch eine gallige Komödie, die sich gerade darüber amüsiert, dass einem hier nichts Neues erzählt wird und diese von jeder sozialen Wirklichkeit abgeschottete Welt, die umso schmerzhafter auf diese Wirklichkeit wirkt, dennoch munter weitermacht. Bis sie eines Tages in die Luft fliegt. Das sind dann auch die letzten Worte. Eine Handlungsanweisung? Harte Schwarzblende.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
19. Dezember 14 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen im Freitag)
 Ein Titel, wie es ihn in Filmen heute nicht mehr gibt, für einen jener Filme, wie man sie heute nicht mehr macht – Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972. Der Anfang ist anspielungsreich, dunkel schimmernd, verheißungsvoll: Mit einer tastenden, sich ständig umsehenden Kamera, hinein in diesen verwilderten, saftig grün leuchtenden Garten, in dieses Anwesen und seine Geheimnisse, wie das Blut, das ins Waschbecken tropft, die offenbar in den Freitod gegangene Frau, die in der Wanne liegt.
Ein Titel, wie es ihn in Filmen heute nicht mehr gibt, für einen jener Filme, wie man sie heute nicht mehr macht – Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972. Der Anfang ist anspielungsreich, dunkel schimmernd, verheißungsvoll: Mit einer tastenden, sich ständig umsehenden Kamera, hinein in diesen verwilderten, saftig grün leuchtenden Garten, in dieses Anwesen und seine Geheimnisse, wie das Blut, das ins Waschbecken tropft, die offenbar in den Freitod gegangene Frau, die in der Wanne liegt.
Alteuropäischer Gothic, gedreht im hellsten Tageslicht. Dass abseits gelegene Häuser unglücklich verkarstete Familiengeschichten in sich bergen, ist bekannt. Hier ist es ein Ornithologe, der Haus und Garten mittels eines alten Tonbands mit den Aufzeichnungen einer psychotherapeutischen Sitzung seine Geheimnisse entlockt. Ein Geschwisterpaar verstrickte sich an dem Ort einst in seinem Begehren, bald bildeten sich in beide Richtungen teuflisch manipulierte Beziehungsdreiecke – die Sache endete fatal und lappt schließlich in die Gegenwart des stumm am Tonband sitzenden Vogelforschers.
Ohne Weiteres hätte man aus dem Stoff einen Knobelkrimi mit melancholischen Bürgerkindern machen können. Doch Regisseur Sauro Scavolini führt in die (von der mal gefräßigen, mal zaghaften Kamera seines Bruders Romano eingefangene) Welt eines unmoralischen Begehrens ohne viel Aufhebens. Ein Vergnügen, das zwar vom Genrefilm kommt, die Kunst aber sucht und die Zielvorgaben von beidem nicht erfüllt. Stattdessen tut sich ein interessantes Zwischenreich auf: ein Kifferfilm ohne Joint, ein Geisterfilm voller Tonbandgespenster. Liebe und Tod im Garten der Götter hat einen angenehm dämmerhaften Flow, nicht zuletzt, da mit Erika Blanc und ihren glasig in die Welt blickenden Augen samt wächsernen Gesichtspartien die wohl großartigste Schlafwandlerin des italienischen Kinos in der Rolle der Schwester zu sehen ist.

Anders als in den barocken Opern des Horrordirigenten Dario Argento gibt es hier nicht das Hauruckpathos wider Moral und filmische Zurückhaltung, für das man das Italokino der 60er und 70er Jahre schätzen kann. Stattdessen taumeln die Scavolinis mit fragilem Stilwillen durch einen Film, dessen Kamera im Grunde genommen eine eigene, handelnde Instanz darstellt. Immer wieder lugt sie um Ecken, Kanten, Büsche und Bäume, als nähme sie die Subjektive eines verstohlenen Serienkillers ein, der den Film über aber Distanz zum Geschehen wahrt.
Was sich darin einmal mehr zeigt, ist der formale Reichtum, die Lust des italienischen Kinos im Dunstkreis des Genrefilms an der vielleicht nicht durchdachten, aber unbedingt ins Bild gesetzten Vision: dass man Filme nicht nur im Detail, sondern mit Erfindungsreichtum und viel formaler Freiheit auch auf Ebene der Textur ganz unterschiedlich erzählen kann. Kein Wunder, dass zumindest Kameramann Romano Scavolini aus dem Experimentalfilm kommt.

Im Kino war dem Film kein langes Leben beschert. Kurz nach dem Start verschwand er aus den Sälen, nach Deutschland wurde er niemals exportiert. Womöglich weil er in keine Schublade so recht passen will. Für die Freunde des Giallos, des italienischen Kriminalfilms, zu wenig stilkonform, für den Autorenfilm vielleicht zu prätentiös. In den Netzwerken der Italofans genoss Liebe und Tod im Garten der Götter lange Zeit den Status einer unzugänglichen Legende.
Umso lobenswerter ist das Verdienst engagierter Kleinlabels wie Filmart, solche kühnen und eben auf interessante Weise neben der Spur liegenden Filme aus einer anderen, offeneren Zeit des Kinos in liebevoll aufbereiteten Editionen zugänglich zu machen.
____
Bonusmaterial: Beim Filmforum Bremen bespricht Marco Koch den Film (von dort habe ich auch die Screenshots gemopst). Und hier die schöne Traumsequenz aus dem Film:
 Ein Titel, wie es ihn in Filmen heute nicht mehr gibt, für einen jener Filme, wie man sie heute nicht mehr macht – Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972. Der Anfang ist anspielungsreich, dunkel schimmernd, verheißungsvoll: Mit einer tastenden, sich ständig umsehenden Kamera, hinein in diesen verwilderten, saftig grün leuchtenden Garten, in dieses Anwesen und seine Geheimnisse, wie das Blut, das ins Waschbecken tropft, die offenbar in den Freitod gegangene Frau, die in der Wanne liegt.
Ein Titel, wie es ihn in Filmen heute nicht mehr gibt, für einen jener Filme, wie man sie heute nicht mehr macht – Liebe und Tod im Garten der Götter von 1972. Der Anfang ist anspielungsreich, dunkel schimmernd, verheißungsvoll: Mit einer tastenden, sich ständig umsehenden Kamera, hinein in diesen verwilderten, saftig grün leuchtenden Garten, in dieses Anwesen und seine Geheimnisse, wie das Blut, das ins Waschbecken tropft, die offenbar in den Freitod gegangene Frau, die in der Wanne liegt.Alteuropäischer Gothic, gedreht im hellsten Tageslicht. Dass abseits gelegene Häuser unglücklich verkarstete Familiengeschichten in sich bergen, ist bekannt. Hier ist es ein Ornithologe, der Haus und Garten mittels eines alten Tonbands mit den Aufzeichnungen einer psychotherapeutischen Sitzung seine Geheimnisse entlockt. Ein Geschwisterpaar verstrickte sich an dem Ort einst in seinem Begehren, bald bildeten sich in beide Richtungen teuflisch manipulierte Beziehungsdreiecke – die Sache endete fatal und lappt schließlich in die Gegenwart des stumm am Tonband sitzenden Vogelforschers.
Ohne Weiteres hätte man aus dem Stoff einen Knobelkrimi mit melancholischen Bürgerkindern machen können. Doch Regisseur Sauro Scavolini führt in die (von der mal gefräßigen, mal zaghaften Kamera seines Bruders Romano eingefangene) Welt eines unmoralischen Begehrens ohne viel Aufhebens. Ein Vergnügen, das zwar vom Genrefilm kommt, die Kunst aber sucht und die Zielvorgaben von beidem nicht erfüllt. Stattdessen tut sich ein interessantes Zwischenreich auf: ein Kifferfilm ohne Joint, ein Geisterfilm voller Tonbandgespenster. Liebe und Tod im Garten der Götter hat einen angenehm dämmerhaften Flow, nicht zuletzt, da mit Erika Blanc und ihren glasig in die Welt blickenden Augen samt wächsernen Gesichtspartien die wohl großartigste Schlafwandlerin des italienischen Kinos in der Rolle der Schwester zu sehen ist.

Anders als in den barocken Opern des Horrordirigenten Dario Argento gibt es hier nicht das Hauruckpathos wider Moral und filmische Zurückhaltung, für das man das Italokino der 60er und 70er Jahre schätzen kann. Stattdessen taumeln die Scavolinis mit fragilem Stilwillen durch einen Film, dessen Kamera im Grunde genommen eine eigene, handelnde Instanz darstellt. Immer wieder lugt sie um Ecken, Kanten, Büsche und Bäume, als nähme sie die Subjektive eines verstohlenen Serienkillers ein, der den Film über aber Distanz zum Geschehen wahrt.
Was sich darin einmal mehr zeigt, ist der formale Reichtum, die Lust des italienischen Kinos im Dunstkreis des Genrefilms an der vielleicht nicht durchdachten, aber unbedingt ins Bild gesetzten Vision: dass man Filme nicht nur im Detail, sondern mit Erfindungsreichtum und viel formaler Freiheit auch auf Ebene der Textur ganz unterschiedlich erzählen kann. Kein Wunder, dass zumindest Kameramann Romano Scavolini aus dem Experimentalfilm kommt.

Im Kino war dem Film kein langes Leben beschert. Kurz nach dem Start verschwand er aus den Sälen, nach Deutschland wurde er niemals exportiert. Womöglich weil er in keine Schublade so recht passen will. Für die Freunde des Giallos, des italienischen Kriminalfilms, zu wenig stilkonform, für den Autorenfilm vielleicht zu prätentiös. In den Netzwerken der Italofans genoss Liebe und Tod im Garten der Götter lange Zeit den Status einer unzugänglichen Legende.
Umso lobenswerter ist das Verdienst engagierter Kleinlabels wie Filmart, solche kühnen und eben auf interessante Weise neben der Spur liegenden Filme aus einer anderen, offeneren Zeit des Kinos in liebevoll aufbereiteten Editionen zugänglich zu machen.
____
Bonusmaterial: Beim Filmforum Bremen bespricht Marco Koch den Film (von dort habe ich auch die Screenshots gemopst). Und hier die schöne Traumsequenz aus dem Film:
° ° °
Thema: Filmtagebuch
06. November 14 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen beim Perlentaucher)
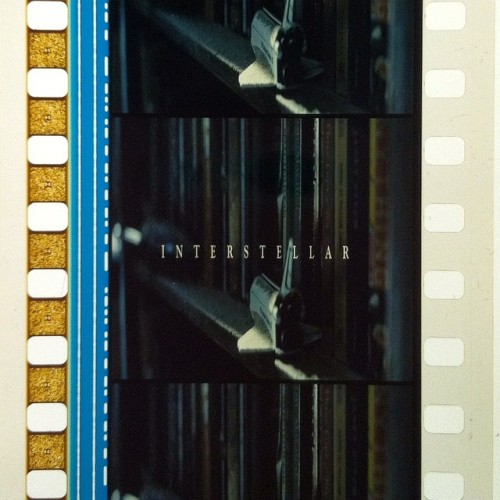
(via)
Die Zukunft ist eine Sache der Vergangenheit. Zumindest der Fluchtpunkt, der mal als Zukunft verstanden und verhandelt wurde. Folgt man dem Popjournalisten Simon Reynols (in "Retromania") oder dem Kulturtheoretiker Mark Fisher (in "Ghosts of my Life", ein Auszug) lautet so der zeitdiagnostische Befund unserer Tage. Demnach hat Pop als einstmals zentrale Schubkraft nicht nur seine "Nowness" verloren, sondern auch seine aufsprengende Kraft, aus der Gegenwart heraus einen verheißungsvollen Möglichkeitsraum für Künftiges zu skizzieren. Stattdessen: Nostalgie und Depression, Archivierung und Musealisierung. Das große utopische Narrativ unserer Zeit: Zurück zum Wohlfahrtsstaat, zurück in die gute alte Zeit, als immerhin noch Aussicht auf Aufbruch bestand.

Mit seinem neuen Epos "Interstellar" knüpft Christopher Nolan daran nun in mehrfacher Hinsicht an. Zum einen, da Nolan - ganz Klassizist und neben Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson der hartnäckigste prominente Fürsprecher klassischen Filmträgermaterials - seinen Griff nach den Sternen bewusst auf 35- und 65mm-Material gedreht hat, also mittels einer bereits als obsolet eingeschätzten Technik, und überdies zumindest in den USA für die Kinoauswertung eine erkleckliche Anzahl 70mm-Prints durchsetzen konnte (in Europa kursieren immerhin vier solcher Kopien, eine davon zeigt der Berliner Zoo-Palast).
Zum anderen, da Nolan auch ästhetisch das Raum-Zeit-Kontinuum wenigstens der Filmgeschichte im Sinn von "zurück zum Aufbruch" auf Vergangenheit umbiegt: Hauptsächlich in klassischen, schön auf abgenutzt gestalteten Sets und mit Miniatur- und Kameratricks unter Verzicht auf CGI gedreht (freilich, für schwarze Löcher und andere Aufsehen erregende Space-Madness nutzt er die Digitaltechnik unter größtmöglichem, aber produktivem Aufwand), orientiert sich "Interstellar" in vielerlei Hinsicht an Stanley Kubricks "2001: A Space Odyssey", dem großen Monolithen der filmischen Science Fiction, und dessen noch vor dem Erfolg der Apollo-Missionen geleisteten Versprechen, ein Weltall-Setting zunächst in aufregender ästhetischer Glaubwürdigkeit zu vermitteln, um sich schließlich kopfüber in den Psychedelic-Rausch des Hyperraums zu stürzen. Kurz vor der Mondlandung war dieser Ausblick in die Schwärze des Alls tatsächlich raumgreifend. Vielleicht braucht es heute, da Raumstationen und Space-Shuttle-Missionen gerade mal am Rand unserer Atmosphäre kratzen, wieder so einen Film.
Doch Nolan erzählt in seinem Film auch von einer umfassend ermatteten Welt, der jegliche Perspektive auf die Zukunft abhanden gekommen ist: Die USA - ein einziger, buchstäblicher Dust Bowl - ist nach klimatischen Verheerungen auf das Niveau einer Farmer-Nation zurückgefallen, Sandstürme bestimmen den Alltag, weite Teile des Ernteertrags werden von Schädlingen und Pilzbefall zunichte gemacht: Drohende Hungersnöte gehören zum Alltag. Eine Welt wie aus den Depressionsjahren der 30er - ausgebildet werden Bauern, an Ingenieuren gibt es keinen Bedarf. Um erst gar keine Aspirationen unter den Kindern aufkommen zu lassen, lehren die Schulbücher, dass es die Mondlandung nie gegeben habe, sondern ein strategisches Fake-Manöver war, um die Sowjetunion in einen selbstzerstörerischen Innovationszugzwang zu verstricken. Nicht zuletzt droht der Menschheit der Erstickungstod. Was die Zukunft einst hätte sein können, schlummert als verstaubte Erinnerungsspur in alten, nicht mehr aufgeschlagenen Büchern.

Für Cooper (Matthew McConaughey), ein einstiges, heute zum Farmer-Dasein gezwungenes Piloten-Ass, die trübsinnigste aller denkbaren Welten: "Früher haben wir am Himmel unseren Platz im Universum gesucht, heute blicken wir auf den Boden und suchen unseren Platz im Schmutz", sinniert er an einer Stelle. Immerhin im Kleinen stellt er sich gegen die zwangsverordnete Depression: Das wenige, was er seinen Kindern an Neugier auf die Welt und Lust an der Wissenschaft vermitteln kann, vermittelt er ihnen mit sichtlichem Enthusiasmus. Und stößt dabei, nach sonderbaren Botschaften eines "Geists", zu dem seine Tochter Murph (Mackenzie Foy) Kontakt haben will, auf eine vor den Augen der Öffentlichkeit versteckte Dependance der NASA, die unter der Anleitung von Professor Brand (Michael Caine) im Verborgenen einen Masterplan zur Umsiedelung auf einen fernen Planeten vermittels eines - von außerirdischen Intelligenzen? - beim Saturn platzierten Wurmlochs ausheckt und in Cooper den für diese Mission idealen Piloten sieht. Der steht nun vor einem Dilemma: Gemäß der Relativitätstheorie würden für ihn bei dieser Reise nur wenige Jahre vergehen - während die Zeit auf der Erde dramatisch schneller verlaufen würde. Nicht nur gilt es, dem Untergang der Menschheit zuvor zu kommen - auch die Möglichkeit eines Wiedersehens mit der geliebten Tochter steht auf dem Spiel.
Raum und Zeit - nur konsequent, dass sich Christopher Nolan in seinem technisch bisher avanciertesten Film der grundlegenden Koordinaten des menschlichen Daseins nun auch in kosmologischer Hinsicht annimmt. Ob in "Memento" oder "Inception", die Frage nach deren zwangsläufiger Linearität stellte schon frühzeitig eine Konstante in seinem Schaffen dar - und stets verstand dieser virtuose Technokrat des Kinos die Montierbarkeit von Film als eine Möglichkeit zur Aufsprengung, die Raum und Zeit als wachsweiche Verfügungs- und Gestaltungsmasse erschließt. Ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so verrätselt wie in "Memento" oder "Inception" (dass "Interstellar" einst für Spielberg konzipiert wurde, ist dem Film in Spuren noch immer anzusehen), funktioniert auch "Interstellar": Raum und Zeit werden hyper-dimensional aufgegliedert und auf dem Gerüst der Liebe zwischen einem Vater und einer Tochter zum interstellaren Erzählgefüge aufgespannt. Insbesondere in der erzählerischen Schlusspointe kulminiert dies in die reizvolle Visualisierung eines Raums jenseits des Raums, einer Zeit jenseits der Zeit.

Toll ist auch - neben der emotional ergreifenden Geschichte zwischen Vater und Tochter, die man dem ansonsten eher als kühl verschrieenen Erzähler kaum zugetraut hätte -, wie es Nolan gelingt, nicht nur die Ästhetik historischen NASA-Filmmaterials, sondern auch die in der Science-Fiction eher abgelegten Tropen von Pioniergeist und Weltentdeckertum mit den Mitteln der Kino-Großentwürfe des Genres für eine zukunftsenthusiastische Form wieder urbar zu machen - sogar die Roboter wirken wieder so herzig wie in der naiven SF der 50er Jahre und strahlen dennoch nichts als "Nowness" aus. Nolan hängt zwar einem alten, längst melancholisch beiseite gelegten Traum von der Rettung der Welt durch hartnäckige Ingenieurswissenschaft nach - doch dessen Utopie rückt er mit seinen brillanten 70mm-Bildern (und nicht zuletzt dem schönen emotionalen, verwundbaren Schmalz) zum Greifen nahe vors Auge.
Nicht zuletzt legt Nolan im Feld des Blockbusters einen schönen Raum-Zeit-Spagat hin. Neigt insbesondere der Superhelden-Blockbuster der heutigen Zeit zum vollgestellten Wuselbild aus dem Computer, schwelgt Nolan in majestätisch leeren, dafür aber umso luxuriöser produzierten Bildern: Wenn die Raumstation - wie es sich gehört: lautlos - am Saturn vorbei zieht, entwickelt die Schlichtheit des Bildes Erhabenheit. Wenn auf einem fernen Planeten ein Tsunami von kosmischen Ausmaßen dem gestrandeten Raumschiff entgegenbrandet, ist das zwar nichts im Vergleich zu den urbanen Kataklysmen aus den Marvel-Filmen, doch in seiner existenzialistischen Komponente allemal dringlicher und effektiver. Und die fernen Planeten, die zu erkunden sind? Der eine ist eine Wasserwelt - eine kleine Hommage an Lems "Solaris" -, der andere eine in Island fotografierte Gletscherwelt. Unter den Bedingungen von 70mm sind beide aufregender anzusehen als jeder heranklotzende Strampelhosen-Superheldenfilm.
Zwar konnte Kubrick noch minutenlang in aller Stille durchs All driften, während bei Nolan die Einstellungsdauer wesentlich kürzer ist, doch zeigt sich auch hier die melancholische Trauer um abhanden gekommene Formen, die Nolan dafür mit umso hartnäckigerer Insistenz zurück ins Hier und Jetzt holt. Von hier aus mag es schließlich - das ist am Ende das Schönste an diesem trotz aller Wucht erstaunlich zärtlichen Film - weitergehen.
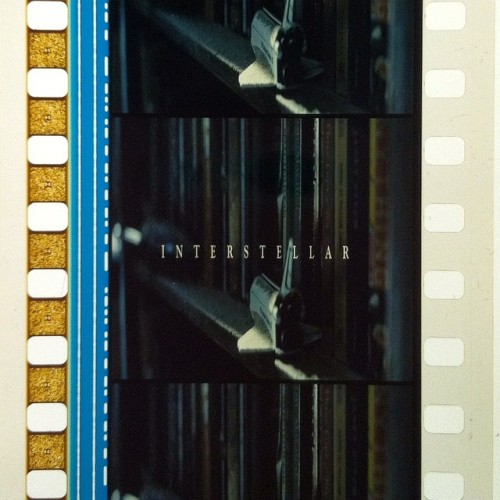
(via)
Die Zukunft ist eine Sache der Vergangenheit. Zumindest der Fluchtpunkt, der mal als Zukunft verstanden und verhandelt wurde. Folgt man dem Popjournalisten Simon Reynols (in "Retromania") oder dem Kulturtheoretiker Mark Fisher (in "Ghosts of my Life", ein Auszug) lautet so der zeitdiagnostische Befund unserer Tage. Demnach hat Pop als einstmals zentrale Schubkraft nicht nur seine "Nowness" verloren, sondern auch seine aufsprengende Kraft, aus der Gegenwart heraus einen verheißungsvollen Möglichkeitsraum für Künftiges zu skizzieren. Stattdessen: Nostalgie und Depression, Archivierung und Musealisierung. Das große utopische Narrativ unserer Zeit: Zurück zum Wohlfahrtsstaat, zurück in die gute alte Zeit, als immerhin noch Aussicht auf Aufbruch bestand.

Mit seinem neuen Epos "Interstellar" knüpft Christopher Nolan daran nun in mehrfacher Hinsicht an. Zum einen, da Nolan - ganz Klassizist und neben Quentin Tarantino und Paul Thomas Anderson der hartnäckigste prominente Fürsprecher klassischen Filmträgermaterials - seinen Griff nach den Sternen bewusst auf 35- und 65mm-Material gedreht hat, also mittels einer bereits als obsolet eingeschätzten Technik, und überdies zumindest in den USA für die Kinoauswertung eine erkleckliche Anzahl 70mm-Prints durchsetzen konnte (in Europa kursieren immerhin vier solcher Kopien, eine davon zeigt der Berliner Zoo-Palast).
Zum anderen, da Nolan auch ästhetisch das Raum-Zeit-Kontinuum wenigstens der Filmgeschichte im Sinn von "zurück zum Aufbruch" auf Vergangenheit umbiegt: Hauptsächlich in klassischen, schön auf abgenutzt gestalteten Sets und mit Miniatur- und Kameratricks unter Verzicht auf CGI gedreht (freilich, für schwarze Löcher und andere Aufsehen erregende Space-Madness nutzt er die Digitaltechnik unter größtmöglichem, aber produktivem Aufwand), orientiert sich "Interstellar" in vielerlei Hinsicht an Stanley Kubricks "2001: A Space Odyssey", dem großen Monolithen der filmischen Science Fiction, und dessen noch vor dem Erfolg der Apollo-Missionen geleisteten Versprechen, ein Weltall-Setting zunächst in aufregender ästhetischer Glaubwürdigkeit zu vermitteln, um sich schließlich kopfüber in den Psychedelic-Rausch des Hyperraums zu stürzen. Kurz vor der Mondlandung war dieser Ausblick in die Schwärze des Alls tatsächlich raumgreifend. Vielleicht braucht es heute, da Raumstationen und Space-Shuttle-Missionen gerade mal am Rand unserer Atmosphäre kratzen, wieder so einen Film.
Doch Nolan erzählt in seinem Film auch von einer umfassend ermatteten Welt, der jegliche Perspektive auf die Zukunft abhanden gekommen ist: Die USA - ein einziger, buchstäblicher Dust Bowl - ist nach klimatischen Verheerungen auf das Niveau einer Farmer-Nation zurückgefallen, Sandstürme bestimmen den Alltag, weite Teile des Ernteertrags werden von Schädlingen und Pilzbefall zunichte gemacht: Drohende Hungersnöte gehören zum Alltag. Eine Welt wie aus den Depressionsjahren der 30er - ausgebildet werden Bauern, an Ingenieuren gibt es keinen Bedarf. Um erst gar keine Aspirationen unter den Kindern aufkommen zu lassen, lehren die Schulbücher, dass es die Mondlandung nie gegeben habe, sondern ein strategisches Fake-Manöver war, um die Sowjetunion in einen selbstzerstörerischen Innovationszugzwang zu verstricken. Nicht zuletzt droht der Menschheit der Erstickungstod. Was die Zukunft einst hätte sein können, schlummert als verstaubte Erinnerungsspur in alten, nicht mehr aufgeschlagenen Büchern.

Für Cooper (Matthew McConaughey), ein einstiges, heute zum Farmer-Dasein gezwungenes Piloten-Ass, die trübsinnigste aller denkbaren Welten: "Früher haben wir am Himmel unseren Platz im Universum gesucht, heute blicken wir auf den Boden und suchen unseren Platz im Schmutz", sinniert er an einer Stelle. Immerhin im Kleinen stellt er sich gegen die zwangsverordnete Depression: Das wenige, was er seinen Kindern an Neugier auf die Welt und Lust an der Wissenschaft vermitteln kann, vermittelt er ihnen mit sichtlichem Enthusiasmus. Und stößt dabei, nach sonderbaren Botschaften eines "Geists", zu dem seine Tochter Murph (Mackenzie Foy) Kontakt haben will, auf eine vor den Augen der Öffentlichkeit versteckte Dependance der NASA, die unter der Anleitung von Professor Brand (Michael Caine) im Verborgenen einen Masterplan zur Umsiedelung auf einen fernen Planeten vermittels eines - von außerirdischen Intelligenzen? - beim Saturn platzierten Wurmlochs ausheckt und in Cooper den für diese Mission idealen Piloten sieht. Der steht nun vor einem Dilemma: Gemäß der Relativitätstheorie würden für ihn bei dieser Reise nur wenige Jahre vergehen - während die Zeit auf der Erde dramatisch schneller verlaufen würde. Nicht nur gilt es, dem Untergang der Menschheit zuvor zu kommen - auch die Möglichkeit eines Wiedersehens mit der geliebten Tochter steht auf dem Spiel.
Raum und Zeit - nur konsequent, dass sich Christopher Nolan in seinem technisch bisher avanciertesten Film der grundlegenden Koordinaten des menschlichen Daseins nun auch in kosmologischer Hinsicht annimmt. Ob in "Memento" oder "Inception", die Frage nach deren zwangsläufiger Linearität stellte schon frühzeitig eine Konstante in seinem Schaffen dar - und stets verstand dieser virtuose Technokrat des Kinos die Montierbarkeit von Film als eine Möglichkeit zur Aufsprengung, die Raum und Zeit als wachsweiche Verfügungs- und Gestaltungsmasse erschließt. Ähnlich, wenn auch bei weitem nicht so verrätselt wie in "Memento" oder "Inception" (dass "Interstellar" einst für Spielberg konzipiert wurde, ist dem Film in Spuren noch immer anzusehen), funktioniert auch "Interstellar": Raum und Zeit werden hyper-dimensional aufgegliedert und auf dem Gerüst der Liebe zwischen einem Vater und einer Tochter zum interstellaren Erzählgefüge aufgespannt. Insbesondere in der erzählerischen Schlusspointe kulminiert dies in die reizvolle Visualisierung eines Raums jenseits des Raums, einer Zeit jenseits der Zeit.

Toll ist auch - neben der emotional ergreifenden Geschichte zwischen Vater und Tochter, die man dem ansonsten eher als kühl verschrieenen Erzähler kaum zugetraut hätte -, wie es Nolan gelingt, nicht nur die Ästhetik historischen NASA-Filmmaterials, sondern auch die in der Science-Fiction eher abgelegten Tropen von Pioniergeist und Weltentdeckertum mit den Mitteln der Kino-Großentwürfe des Genres für eine zukunftsenthusiastische Form wieder urbar zu machen - sogar die Roboter wirken wieder so herzig wie in der naiven SF der 50er Jahre und strahlen dennoch nichts als "Nowness" aus. Nolan hängt zwar einem alten, längst melancholisch beiseite gelegten Traum von der Rettung der Welt durch hartnäckige Ingenieurswissenschaft nach - doch dessen Utopie rückt er mit seinen brillanten 70mm-Bildern (und nicht zuletzt dem schönen emotionalen, verwundbaren Schmalz) zum Greifen nahe vors Auge.
Nicht zuletzt legt Nolan im Feld des Blockbusters einen schönen Raum-Zeit-Spagat hin. Neigt insbesondere der Superhelden-Blockbuster der heutigen Zeit zum vollgestellten Wuselbild aus dem Computer, schwelgt Nolan in majestätisch leeren, dafür aber umso luxuriöser produzierten Bildern: Wenn die Raumstation - wie es sich gehört: lautlos - am Saturn vorbei zieht, entwickelt die Schlichtheit des Bildes Erhabenheit. Wenn auf einem fernen Planeten ein Tsunami von kosmischen Ausmaßen dem gestrandeten Raumschiff entgegenbrandet, ist das zwar nichts im Vergleich zu den urbanen Kataklysmen aus den Marvel-Filmen, doch in seiner existenzialistischen Komponente allemal dringlicher und effektiver. Und die fernen Planeten, die zu erkunden sind? Der eine ist eine Wasserwelt - eine kleine Hommage an Lems "Solaris" -, der andere eine in Island fotografierte Gletscherwelt. Unter den Bedingungen von 70mm sind beide aufregender anzusehen als jeder heranklotzende Strampelhosen-Superheldenfilm.
Zwar konnte Kubrick noch minutenlang in aller Stille durchs All driften, während bei Nolan die Einstellungsdauer wesentlich kürzer ist, doch zeigt sich auch hier die melancholische Trauer um abhanden gekommene Formen, die Nolan dafür mit umso hartnäckigerer Insistenz zurück ins Hier und Jetzt holt. Von hier aus mag es schließlich - das ist am Ende das Schönste an diesem trotz aller Wucht erstaunlich zärtlichen Film - weitergehen.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
05. November 14 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen in der taz)
Lichtpunkte ziehen durch die Schwärze der Nacht, durch die Schwärze des Filmbilds. Was sich als Beleuchtung eines Verkehrstunnels entpuppt, lässt sich einen Moment lang auch als Visualisierung einer codierten Nachricht deuten, die, für Menschen zunächst nicht entzifferbar, für Maschinen umso lesbarer, durchs Netz zieht.
Was sie verrät und vorenthält bleibt ohne Schlüssel unklar. Verschlüsselt waren auch die brisanten Nachrichten zwischen einem gewissen "Citizenfour", Deckname des Whistleblowers Edward Snowden, und der Dokumentarfilmemacherin Laura Poitras. Die zunächst zaghafte Korrespondenz führte zur Aufdeckung der NSA-Aktivitäten.
Auszüge daraus sind nun im Klartext und ebenfalls weiß auf schwarz in Poitras' Dokumentarfilm "Citizenfour" zu sehen. Immer wieder verdeutlicht sich dabei, dass in einer Welt, in der Kommunikation weitgehend über Kanäle läuft, die nicht ohne Weiteres als unkorrumpiert gelten können, die Art und Weise von Kommunikation entscheidend ist: Die brisantesten Informationen werden am Ende des Films an Maschinen, also auch an Poitras' Kamera und Mikrofone vorbei von Angesicht zu Angesicht per Kugelschreiber und Papier ausgetauscht und im Nu aus der Welt geschafft: Schlusspunkt einer begründeten Paranoisierung im Zeitalter von NSA und GCHQ.

"Citizenfour" rekonstruiert die Ereignisse im Juni 2013. Eine historische Zäsur, die vielleicht die Welt nicht änderte, doch ein für allemal unsere Perspektive darauf: Mit täglich neuen Details deckt der US-Journalist Glenn Greenwald in der britischen Tageszeitung Guardian erstmals das Ausmaß der NSA-Schnüffeleien auf.
Die Weltöffentlichkeit steht Kopf, die US-Regierung übt sich in Schadensbegrenzung. Hysterie und Beschwichtigung, Angriff und Gegenangriff: Die Stunde null der Offenlegung unserer de facto protokollierten Welt. Mit jedem neuen Detail über das Ausmaß der faktischen Totalüberwachung unserer Kommunikation wird eine bis dahin lediglich schwelende Ahnung mehr und mehr zur Gewissheit: Im Stillen und aus einer Ideologie reiner Machbarkeit heraus hat sich mit den Big-Data-Silos der NSA die ultimative Waffe gegen jede Form von insbesondere für eine Demokratie notwendigem Widerstand gebildet.
Ein Staat im Staat, verschanzt hinter einem aggressiven Abwehrmechanismus, der sich nicht nur gegen die eigenen Bürger richtet und auf Langzeiteffizienz zielt: Was heute als unerhebliche Information gilt, führt spätestens unter Bedingungen eines drakonisch-autoritären Systems zu Begehrlichkeiten mit weitreichenden Folgen.
Mit dem NSA-Zuarbeiter Edward Snowden erhält die Affäre wenig später ihr ikonisches Gesicht: Ruhig und souverän stellt er sich und sein Anliegen der Weltöffentlichkeit in einem Videointerview aus der Anonymität eines Hotelzimmers heraus vor. Die Aufnahmen stammen von Poitras, neben Greenwald Snowdens engster Vertrauten.

Mit großen Mengen weiteren Videomaterials aus jenen Tagen dokumentiert "Citizenfour" die ersten Begegnungen zwischen Snowden, Poitras und Greenwald in der Beengtheit eines Hongkonger Hotelzimmers kurz vor dem großen Coup. Die weltverlorene Abgeschiedenheit dieses anonymen Raums bildet einen beeindruckenden Kontrast zum globalen Medienwirbel, der diesen Sitzungen im kleinen Kreis folgt: Die Basisarbeit des größten journalistischen Coups aller Zeiten wird mit rudimentärem Equipment zwischen Hotelbett und Stuhl geleistet.
Trotz allen aktivistischen Ambitionen: Süffiger Polit-Boulevard à la Michael Moore ist das nicht. Poitras arbeitet kühler, mit fast meditativer Präzision. Wer die Snowden-Reportagen aus dem Rolling Stone oder Wired kennt, erfährt zwar kaum Neues. Doch besticht "Citizenfour" als historisches Dokument und Konkretisierung des unmittelbaren, noch unsortierten Ausgangspunkts des heutigen Stands der Dinge.
Was sich in den Reportagen spannend wie ein Agententhriller liest, erfährt in Poitras' Videomaterial eine situative Rückbindung: Snowden ist nervös, die paranoide Atmosphäre steht sirupdick im Raum. Überraschende Feueralarm-Proben im Hotel machen jede Fassung zunichte, beim Hantieren mit seinem Rechner wirft Snowden sich eine Decke über den Kopf, nicht zuletzt tadelt er Greenwald für seine laxe Passwort-Politik.
Auch von heute aus betrachtet entwickelt dieser Rückblick auf den finalen Augenblick der Pre-Leak-Ära einen beträchtlichen Sog. Am Ende bestätigt sich - wenn dem Film zu glauben ist - ein die NSA-Debatte seit längerem begleitendes Gerücht: So gibt es wohl noch einen Whistleblower, über dessen Position und Tragweite seines Handelns selbst Snowden stutzt. Mit weiteren Details hält sich Laura Poitras Film bedeckt. "Citizenfour" bleibt damit Passage und Episode: Der größte Paranoia-Thriller unserer Tage ist noch nicht zu Ende erzählt.
Lichtpunkte ziehen durch die Schwärze der Nacht, durch die Schwärze des Filmbilds. Was sich als Beleuchtung eines Verkehrstunnels entpuppt, lässt sich einen Moment lang auch als Visualisierung einer codierten Nachricht deuten, die, für Menschen zunächst nicht entzifferbar, für Maschinen umso lesbarer, durchs Netz zieht.
Was sie verrät und vorenthält bleibt ohne Schlüssel unklar. Verschlüsselt waren auch die brisanten Nachrichten zwischen einem gewissen "Citizenfour", Deckname des Whistleblowers Edward Snowden, und der Dokumentarfilmemacherin Laura Poitras. Die zunächst zaghafte Korrespondenz führte zur Aufdeckung der NSA-Aktivitäten.
Auszüge daraus sind nun im Klartext und ebenfalls weiß auf schwarz in Poitras' Dokumentarfilm "Citizenfour" zu sehen. Immer wieder verdeutlicht sich dabei, dass in einer Welt, in der Kommunikation weitgehend über Kanäle läuft, die nicht ohne Weiteres als unkorrumpiert gelten können, die Art und Weise von Kommunikation entscheidend ist: Die brisantesten Informationen werden am Ende des Films an Maschinen, also auch an Poitras' Kamera und Mikrofone vorbei von Angesicht zu Angesicht per Kugelschreiber und Papier ausgetauscht und im Nu aus der Welt geschafft: Schlusspunkt einer begründeten Paranoisierung im Zeitalter von NSA und GCHQ.

"Citizenfour" rekonstruiert die Ereignisse im Juni 2013. Eine historische Zäsur, die vielleicht die Welt nicht änderte, doch ein für allemal unsere Perspektive darauf: Mit täglich neuen Details deckt der US-Journalist Glenn Greenwald in der britischen Tageszeitung Guardian erstmals das Ausmaß der NSA-Schnüffeleien auf.
Die Weltöffentlichkeit steht Kopf, die US-Regierung übt sich in Schadensbegrenzung. Hysterie und Beschwichtigung, Angriff und Gegenangriff: Die Stunde null der Offenlegung unserer de facto protokollierten Welt. Mit jedem neuen Detail über das Ausmaß der faktischen Totalüberwachung unserer Kommunikation wird eine bis dahin lediglich schwelende Ahnung mehr und mehr zur Gewissheit: Im Stillen und aus einer Ideologie reiner Machbarkeit heraus hat sich mit den Big-Data-Silos der NSA die ultimative Waffe gegen jede Form von insbesondere für eine Demokratie notwendigem Widerstand gebildet.
Ein Staat im Staat, verschanzt hinter einem aggressiven Abwehrmechanismus, der sich nicht nur gegen die eigenen Bürger richtet und auf Langzeiteffizienz zielt: Was heute als unerhebliche Information gilt, führt spätestens unter Bedingungen eines drakonisch-autoritären Systems zu Begehrlichkeiten mit weitreichenden Folgen.
Mit dem NSA-Zuarbeiter Edward Snowden erhält die Affäre wenig später ihr ikonisches Gesicht: Ruhig und souverän stellt er sich und sein Anliegen der Weltöffentlichkeit in einem Videointerview aus der Anonymität eines Hotelzimmers heraus vor. Die Aufnahmen stammen von Poitras, neben Greenwald Snowdens engster Vertrauten.

Mit großen Mengen weiteren Videomaterials aus jenen Tagen dokumentiert "Citizenfour" die ersten Begegnungen zwischen Snowden, Poitras und Greenwald in der Beengtheit eines Hongkonger Hotelzimmers kurz vor dem großen Coup. Die weltverlorene Abgeschiedenheit dieses anonymen Raums bildet einen beeindruckenden Kontrast zum globalen Medienwirbel, der diesen Sitzungen im kleinen Kreis folgt: Die Basisarbeit des größten journalistischen Coups aller Zeiten wird mit rudimentärem Equipment zwischen Hotelbett und Stuhl geleistet.
Trotz allen aktivistischen Ambitionen: Süffiger Polit-Boulevard à la Michael Moore ist das nicht. Poitras arbeitet kühler, mit fast meditativer Präzision. Wer die Snowden-Reportagen aus dem Rolling Stone oder Wired kennt, erfährt zwar kaum Neues. Doch besticht "Citizenfour" als historisches Dokument und Konkretisierung des unmittelbaren, noch unsortierten Ausgangspunkts des heutigen Stands der Dinge.
Was sich in den Reportagen spannend wie ein Agententhriller liest, erfährt in Poitras' Videomaterial eine situative Rückbindung: Snowden ist nervös, die paranoide Atmosphäre steht sirupdick im Raum. Überraschende Feueralarm-Proben im Hotel machen jede Fassung zunichte, beim Hantieren mit seinem Rechner wirft Snowden sich eine Decke über den Kopf, nicht zuletzt tadelt er Greenwald für seine laxe Passwort-Politik.
Auch von heute aus betrachtet entwickelt dieser Rückblick auf den finalen Augenblick der Pre-Leak-Ära einen beträchtlichen Sog. Am Ende bestätigt sich - wenn dem Film zu glauben ist - ein die NSA-Debatte seit längerem begleitendes Gerücht: So gibt es wohl noch einen Whistleblower, über dessen Position und Tragweite seines Handelns selbst Snowden stutzt. Mit weiteren Details hält sich Laura Poitras Film bedeckt. "Citizenfour" bleibt damit Passage und Episode: Der größte Paranoia-Thriller unserer Tage ist noch nicht zu Ende erzählt.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
29. Oktober 14 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
(zuerst erschienen im Freitag)
 Ein namenloser Fremder kommt in die Stadt, gerät zwischen die Fronten und klärt die Sache nach einigem Taktieren schließlich buchstäblich mit aller Gewalt – eine Standardgeschichte beileibe nicht nur des italienischen Westerns. In diesem Exemplar, Töte, Django aus dem Jahr 1966, von Giulio Questi aber aufs Interessanteste umgestülpt, verdreht und subvertiert. Während Sergio Leone im Begründungsfilm des Subgenres Für eine Handvoll Dollar (1964) noch bei der Samurai-Darstellung von Akira Kurosawa und deren Pathos plünderte, beschreitet Questi archaischere und ekstatischere Pfade. Seine Parabel auf die Habgier des Menschen als dessen Untergang ist angereichert mit Motiven aus Mythos, Religion und Kunstgeschichte und landet in den Gefilden des surreal angehauchten Gothic-Westerns, der weniger die weite Landschaft als vielmehr das Close-up aufs Gesicht in Cinemascope sucht.
Ein namenloser Fremder kommt in die Stadt, gerät zwischen die Fronten und klärt die Sache nach einigem Taktieren schließlich buchstäblich mit aller Gewalt – eine Standardgeschichte beileibe nicht nur des italienischen Westerns. In diesem Exemplar, Töte, Django aus dem Jahr 1966, von Giulio Questi aber aufs Interessanteste umgestülpt, verdreht und subvertiert. Während Sergio Leone im Begründungsfilm des Subgenres Für eine Handvoll Dollar (1964) noch bei der Samurai-Darstellung von Akira Kurosawa und deren Pathos plünderte, beschreitet Questi archaischere und ekstatischere Pfade. Seine Parabel auf die Habgier des Menschen als dessen Untergang ist angereichert mit Motiven aus Mythos, Religion und Kunstgeschichte und landet in den Gefilden des surreal angehauchten Gothic-Westerns, der weniger die weite Landschaft als vielmehr das Close-up aufs Gesicht in Cinemascope sucht.
So ist der namenlose Fremde – ein mexikanischer Kleingangster, eine von Tomás Milián häufig verkörperte, klassische Figur im Italowestern – denn auch kein Samurai mit Colt, sondern ein von den Toten wiederauferstandener Racheengel, von dem unklar bleibt, ob er nie gestorben, ein Wiedergänger oder ein Gefangener des Fegefeuers ist. Zwei indigene Einwohner stehen ihm zur Seite, befragen ihn unentwegt nach dem Jenseits und gießen ihm Kugeln aus jenem Gold, für das er ursprünglich umgelegt worden war. In einer nahen Stadt findet er sich in einem Morast aus menschlicher Verkommenheit wieder, mit dem interessanten Detail, dass es gerade nicht die Outlaws sind, die dem Übel Vorschub leisten. Liegt ein von goldenen Kugeln durchsiebter Körper auf dem Tisch des Doktors, hat es sich alsbald mit hippokratischen Tugenden, wenn der Wert der Projektile erst einmal offen zutage liegt: Schon bohren sich gierige Finger auf der Suche nach Gold in die Wunden des aufschreienden Versehrten.
Eine Ode an die Gewalt und die Niedertracht oder auch: Film als Exorzismus. Zwei Jahre lang kämpfte Questi im Zweiten Weltkrieg mit den Partisanen gegen die Faschisten. Die seelischen Wunden aus diesen Erfahrungen treibt er sich mit diesem fahrig-wuchtigen Film, seinem Debüt, gewissermaßen selbst aus, gerade so, als jagte er die eigenen Bilder im Kopf wie ein Maschinengewehr auf die Leinwand.
Die zynisch-brutale Ästhetik des Italowesterns und dessen latente Gesellschaftskritik potenziert Questi in Töte, Django zu einem wütenden, formell immer wieder aufs Schönste entgleisenden Manifest, das mit den opernhaften Schwelgereien eines Sergio Leone nichts mehr zu tun hat. Im Gegenteil, Questi ist weder ein Genreliebhaber noch einer von Italiens berüchtigten Nonkonformisten. Vielmehr ist er mit gerade mal drei Langspielfilmen zeitlebens ein Grantler in den Nischen der Filmgeschichte geblieben, der vom Genre nur insoweit etwas hält, wie er es als Behältnis für seine stramm linke Wut nutzen und es dabei vielleicht noch demolieren kann. Der folgende Film Arcana ist denn auch eine bizarr funkelnde Horrorfantasie an der Grenze zur Avantgarde, die muffigem Grusel das Fürchten lehrt.
Töte, Django reiht sich glänzend ein in die Riege der Italowestern abseits des vielbesungenen Kanons von Sergio Leone und Sergio Corbucci, wo man die wirklich interessanten Werke findet, dunkel-glänzende, manisch-ekstatische Produktionen wie Cesare Canevaris irrsinniger Prog-Rock-Western ¡Mátalo! (1970) etwa oder Enzo G. Castellaris Keoma (1976).
Nicht zuletzt ist Töte, Django ein grandioses Beispiel für den beeindruckenden Spagat, den das italienische Genrekino der 60er und 70er Jahre immer wieder zu leisten vermochte. Nach vorn populär und industriell, hinten heraus aber stets schon mitten in der politischen Intervention – wenn auch mit dem Holzhammer nicht subtil in der Analyse. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Umbrüche der damaligen Zeit schießt in Filmen wie diesem trotz Historienkulisse viel Zeitgeist ins Bild. Gerade dem heute oft abgesicherten Kino wäre eine Rückkehr dieser wütenden Drastik zu wünschen.

 Ein namenloser Fremder kommt in die Stadt, gerät zwischen die Fronten und klärt die Sache nach einigem Taktieren schließlich buchstäblich mit aller Gewalt – eine Standardgeschichte beileibe nicht nur des italienischen Westerns. In diesem Exemplar, Töte, Django aus dem Jahr 1966, von Giulio Questi aber aufs Interessanteste umgestülpt, verdreht und subvertiert. Während Sergio Leone im Begründungsfilm des Subgenres Für eine Handvoll Dollar (1964) noch bei der Samurai-Darstellung von Akira Kurosawa und deren Pathos plünderte, beschreitet Questi archaischere und ekstatischere Pfade. Seine Parabel auf die Habgier des Menschen als dessen Untergang ist angereichert mit Motiven aus Mythos, Religion und Kunstgeschichte und landet in den Gefilden des surreal angehauchten Gothic-Westerns, der weniger die weite Landschaft als vielmehr das Close-up aufs Gesicht in Cinemascope sucht.
Ein namenloser Fremder kommt in die Stadt, gerät zwischen die Fronten und klärt die Sache nach einigem Taktieren schließlich buchstäblich mit aller Gewalt – eine Standardgeschichte beileibe nicht nur des italienischen Westerns. In diesem Exemplar, Töte, Django aus dem Jahr 1966, von Giulio Questi aber aufs Interessanteste umgestülpt, verdreht und subvertiert. Während Sergio Leone im Begründungsfilm des Subgenres Für eine Handvoll Dollar (1964) noch bei der Samurai-Darstellung von Akira Kurosawa und deren Pathos plünderte, beschreitet Questi archaischere und ekstatischere Pfade. Seine Parabel auf die Habgier des Menschen als dessen Untergang ist angereichert mit Motiven aus Mythos, Religion und Kunstgeschichte und landet in den Gefilden des surreal angehauchten Gothic-Westerns, der weniger die weite Landschaft als vielmehr das Close-up aufs Gesicht in Cinemascope sucht.So ist der namenlose Fremde – ein mexikanischer Kleingangster, eine von Tomás Milián häufig verkörperte, klassische Figur im Italowestern – denn auch kein Samurai mit Colt, sondern ein von den Toten wiederauferstandener Racheengel, von dem unklar bleibt, ob er nie gestorben, ein Wiedergänger oder ein Gefangener des Fegefeuers ist. Zwei indigene Einwohner stehen ihm zur Seite, befragen ihn unentwegt nach dem Jenseits und gießen ihm Kugeln aus jenem Gold, für das er ursprünglich umgelegt worden war. In einer nahen Stadt findet er sich in einem Morast aus menschlicher Verkommenheit wieder, mit dem interessanten Detail, dass es gerade nicht die Outlaws sind, die dem Übel Vorschub leisten. Liegt ein von goldenen Kugeln durchsiebter Körper auf dem Tisch des Doktors, hat es sich alsbald mit hippokratischen Tugenden, wenn der Wert der Projektile erst einmal offen zutage liegt: Schon bohren sich gierige Finger auf der Suche nach Gold in die Wunden des aufschreienden Versehrten.
Eine Ode an die Gewalt und die Niedertracht oder auch: Film als Exorzismus. Zwei Jahre lang kämpfte Questi im Zweiten Weltkrieg mit den Partisanen gegen die Faschisten. Die seelischen Wunden aus diesen Erfahrungen treibt er sich mit diesem fahrig-wuchtigen Film, seinem Debüt, gewissermaßen selbst aus, gerade so, als jagte er die eigenen Bilder im Kopf wie ein Maschinengewehr auf die Leinwand.
Die zynisch-brutale Ästhetik des Italowesterns und dessen latente Gesellschaftskritik potenziert Questi in Töte, Django zu einem wütenden, formell immer wieder aufs Schönste entgleisenden Manifest, das mit den opernhaften Schwelgereien eines Sergio Leone nichts mehr zu tun hat. Im Gegenteil, Questi ist weder ein Genreliebhaber noch einer von Italiens berüchtigten Nonkonformisten. Vielmehr ist er mit gerade mal drei Langspielfilmen zeitlebens ein Grantler in den Nischen der Filmgeschichte geblieben, der vom Genre nur insoweit etwas hält, wie er es als Behältnis für seine stramm linke Wut nutzen und es dabei vielleicht noch demolieren kann. Der folgende Film Arcana ist denn auch eine bizarr funkelnde Horrorfantasie an der Grenze zur Avantgarde, die muffigem Grusel das Fürchten lehrt.
Töte, Django reiht sich glänzend ein in die Riege der Italowestern abseits des vielbesungenen Kanons von Sergio Leone und Sergio Corbucci, wo man die wirklich interessanten Werke findet, dunkel-glänzende, manisch-ekstatische Produktionen wie Cesare Canevaris irrsinniger Prog-Rock-Western ¡Mátalo! (1970) etwa oder Enzo G. Castellaris Keoma (1976).
Nicht zuletzt ist Töte, Django ein grandioses Beispiel für den beeindruckenden Spagat, den das italienische Genrekino der 60er und 70er Jahre immer wieder zu leisten vermochte. Nach vorn populär und industriell, hinten heraus aber stets schon mitten in der politischen Intervention – wenn auch mit dem Holzhammer nicht subtil in der Analyse. Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Umbrüche der damaligen Zeit schießt in Filmen wie diesem trotz Historienkulisse viel Zeitgeist ins Bild. Gerade dem heute oft abgesicherten Kino wäre eine Rückkehr dieser wütenden Drastik zu wünschen.

° ° °
Thema: Filmtagebuch
(zuerst erschienen in der taz)
Ein Pfarrer sucht seinen Mörder: Eine Woche Zeit hat der Gottesmann James Lavelle (Brendan Gleeson), um entweder das Weite zu suchen oder unter der überschaubaren Zahl der Gemeindemitglieder dieser kleinen irischen Küstenstadt denjenigen ausfindig zu machen, der ihm im Beichtstuhl angekündigt hat, ihn am kommenden Sonntag am Strand zu richten. Für ein Verbrechen, wohlgemerkt, das er selbst nicht begangen hat: Der Mörder in spe trachtet nach Rache an der katholischen Kirche dafür, dass er als Junge von einem inzwischen verstorbenen Seelsorger jahrelang misshandelt und vergewaltigt wurde. Und wie sich besser an der Kirche rächen, als ausgerechnet einen der guten und barmherzigen Priester aus ihren Reihen zu streichen?
Kein Whodunit, sondern ein Wholldoit also: In bewährter Krimimanier streift der brummige, raumgreifende Pfarrer durch seine Gemeinde, spricht mit Leuten, sucht Rat bei den Kirchenoberen, präsentiert und verwirft Verdächtige.
Der gemütliche Agatha-Christie-Effekt wird durch sanft schwarzen Humor abgefedert. Und durch die Tatsache, dass diese Gemeinde bei aller Beschaulichkeit eine Anhäufung mehr oder weniger verkommener Subjekte oder im Leben Gestrandeter darstellt: Da ist der Sexprotz genauso wie der an der Sinnlosigkeit des Lebens scheiternde Millionär-Snob, der auf teure Gemälde pinkelt, ganz einfach, weil er es sich leisten kann. Und Lavelles Tochter, gezeugt, bevor er zum Priester geweiht wurde, kommt nach einem Selbstmordversuch auch zu Besuch.

Anders als in "The Guard", John Michael McDonaghs beliebter Komödie von vor wenigen Jahren, herrscht in "Am Sonntag bist du tot" trotz des Flirts mit dem schwarzen Humor ein elegisch-reduzierter, weihevoll-lakonischer Ton vor, der in Verbindung mit den - offenbar im Hinblick auf die Interessen der irischen Tourismusbranche erstellten - prächtigen Landschaftsaufnahmen eine etwas arg kunstwollende Küstensprödheit ergibt.
Auch die oft lakonische, mit vielsagenden Weglassungen hantierende Montage kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass dieser vor allem mit Dialog arbeitende Film mit seiner im Wesentlichen funktionalen Ästhetik über weite Strecken lediglich ein Hörbuch darstellt.
Auch für die zentralen christlichen Aspekte des Films - das Für und Wider der Vergebung, die Frage nach der Selbstverteidigung - findet McDonagh in ihrer Symbolik vor allem bloß naheliegende Bilder. Bevor es am Ende zum Strand geht, schlüpft Lavelle, zwischenzeitig nur in Alltagskleidung zu sehen, andeutungsreich in seine Robe zurück und geht vor dem Kreuz zu weihevoller Musik in die Knie.
McDonagh reiht sich auf wenig originelle, wenig interessante Weise in die vorherrschende Tradition des christlichen Bilderdiskurses in der Filmgeschichte ein. Ebenso wenig hat er etwas Substanzielles über die zahlreichen Missbrauchsaffären der katholischen Kirche in den letzten Jahren zu sagen.
Ein Pfarrer sucht seinen Mörder: Eine Woche Zeit hat der Gottesmann James Lavelle (Brendan Gleeson), um entweder das Weite zu suchen oder unter der überschaubaren Zahl der Gemeindemitglieder dieser kleinen irischen Küstenstadt denjenigen ausfindig zu machen, der ihm im Beichtstuhl angekündigt hat, ihn am kommenden Sonntag am Strand zu richten. Für ein Verbrechen, wohlgemerkt, das er selbst nicht begangen hat: Der Mörder in spe trachtet nach Rache an der katholischen Kirche dafür, dass er als Junge von einem inzwischen verstorbenen Seelsorger jahrelang misshandelt und vergewaltigt wurde. Und wie sich besser an der Kirche rächen, als ausgerechnet einen der guten und barmherzigen Priester aus ihren Reihen zu streichen?
Kein Whodunit, sondern ein Wholldoit also: In bewährter Krimimanier streift der brummige, raumgreifende Pfarrer durch seine Gemeinde, spricht mit Leuten, sucht Rat bei den Kirchenoberen, präsentiert und verwirft Verdächtige.
Der gemütliche Agatha-Christie-Effekt wird durch sanft schwarzen Humor abgefedert. Und durch die Tatsache, dass diese Gemeinde bei aller Beschaulichkeit eine Anhäufung mehr oder weniger verkommener Subjekte oder im Leben Gestrandeter darstellt: Da ist der Sexprotz genauso wie der an der Sinnlosigkeit des Lebens scheiternde Millionär-Snob, der auf teure Gemälde pinkelt, ganz einfach, weil er es sich leisten kann. Und Lavelles Tochter, gezeugt, bevor er zum Priester geweiht wurde, kommt nach einem Selbstmordversuch auch zu Besuch.

Anders als in "The Guard", John Michael McDonaghs beliebter Komödie von vor wenigen Jahren, herrscht in "Am Sonntag bist du tot" trotz des Flirts mit dem schwarzen Humor ein elegisch-reduzierter, weihevoll-lakonischer Ton vor, der in Verbindung mit den - offenbar im Hinblick auf die Interessen der irischen Tourismusbranche erstellten - prächtigen Landschaftsaufnahmen eine etwas arg kunstwollende Küstensprödheit ergibt.
Auch die oft lakonische, mit vielsagenden Weglassungen hantierende Montage kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass dieser vor allem mit Dialog arbeitende Film mit seiner im Wesentlichen funktionalen Ästhetik über weite Strecken lediglich ein Hörbuch darstellt.
Auch für die zentralen christlichen Aspekte des Films - das Für und Wider der Vergebung, die Frage nach der Selbstverteidigung - findet McDonagh in ihrer Symbolik vor allem bloß naheliegende Bilder. Bevor es am Ende zum Strand geht, schlüpft Lavelle, zwischenzeitig nur in Alltagskleidung zu sehen, andeutungsreich in seine Robe zurück und geht vor dem Kreuz zu weihevoller Musik in die Knie.
McDonagh reiht sich auf wenig originelle, wenig interessante Weise in die vorherrschende Tradition des christlichen Bilderdiskurses in der Filmgeschichte ein. Ebenso wenig hat er etwas Substanzielles über die zahlreichen Missbrauchsaffären der katholischen Kirche in den letzten Jahren zu sagen.
° ° °
lol