 Retrospektive: American Graffitti (USA 1972/73, George Lucas)
Retrospektive: American Graffitti (USA 1972/73, George Lucas)Zum ersten Mal als Teenager auf Video oder im Fernsehen gesehen und geliebt. Grund genug für eine erneute Sichtung, diesmal im Kino, zumal sonst parallel nichts lief, das mich weiter interessiert hätte. Manchmal ist es jedoch besser die schönen Erinnerungen auf sich beruhen zu lassen. Von allen Filmen der Retrospektive die ich bislang sah, ist American Graffitti der konvensionellste und, um ehrlich zu sein, der langweiligste. Am interessantesten vielleicht noch die Geschichte um den Radio-DJ Wolfman Jack, dessen Stimme als verbindendes Element des ständig präsenten Soundtracks fungiert. Überhaupt trägt die Musik den Film und dessen Figuren wie Halluzinationen durch einen Traum, einen Zuckersüßen im übrigen, der für keinen seiner Protagonisten ein böses Erwachen bereithält.
Retrospektive: The King of Marvin Gardens (USA 1972, Bob Rafelson)
Bob Rafelson autobiographisch gefärbter Film über zwei ungleiche Brüder und den großem Traum von Reichtum und einem Leben außerhalb der öden Alltagsrealitäten. Der Film ist ungeheuer dicht inszeniert, nimmt sich aber zusehends die Luft zum Atmen. Am Ende will man schnell raus, um kurze Zeit später dann doch feststellen zu müssen, dass die Gedanken noch immer den Figuren nachhängen. Grund dafür sind die durchweg tollen schauspielerischen Leistungen, allen voran Bruce Dern als Energiebündel und der gegen den Strich besetzte Jack Nicholson als sein introvertierter Bruder. Wirklich Spaß, wie im Beiblatt behauptet, macht „Marvin Gardens“ jedoch nicht.
Panorama: Quattro Noza (USA 2003, Joey Curtis)
Ein Film über Minorities in L.A., die sich mit aufgemotzten Kleinwägen Rennen liefern. Natürlich eingebettet eine Dreiecksgeschichte: der harte Chato, Sohn von Immigranten aus Guatemala, seine Sandkastenliebe Noza und der weiße Quattro, aus der Wüste, versteht sich. Nicht, das die Geschichte nicht dämlich wäre, die Dialoge grauenhaft gestelzt geschrieben und entsprechend unbedarft nachgeplappert würden, das größte Verbrechen des Films ist sein nicht vorhandenes ästhetisches Konzept. Die fraglos preiswerte Produktion hat es sich offensichtlich zur Aufgabe gemacht, die DV-Bilder zu verfremden um die Production Value nach oben zu treiben. Nur so ist der ständige Einsatz von Shutter-Effekten, das permanent in die Breite verzerrte Bild, die hohe Schnittfolge und die entfesselte Handkamera zu erklären. Ein unerträglicher Film.
Zwar komplett gesehen, aber mir auch eher egal war Baytong (Forum; Nonzee Nimibutr, Thailand 2003). Ein in irdischen Belangen gänzlicher unbeleckter, buddhistischer Mönch kehrt nach einem muslimischen Terroranschlag, in dem Verwandte ums Leben kamen, zu den Überlebenden seiner Familie in die Stadt zurück und lernt viel über das moderne Leben und die (unschuldige, kindliche) Liebe zu einem anderen Menschen, wie auch umgekehrt die modernen Menschen von ihm lernen können. Das schlägt in Thailand, das wohl scharf in buddhistisch und islamische Regionen unterteilt ist, natürlich besondere Saiten im nationalen Konzert an, rief bei mir aber nicht viel mehr als ein wohlwollendes "nett" hervor. Der Mönch war immerhin sehr gut gespielt.
Zwei Filme von Monte Hellman sind in der Retrospektive zu sehen gewesen: Two-Lane Blacktop (USA 1971) ist ein lakonisches Roadmovie, in dem Bewegung zum Selbstzweck gerät, der Ausgang eines eigentlich die Narration im späteren Verlauf bestimmenden Wettrennens durch die USA schließlich so egal wird, dass man den Film einfach, wortwörtlich, noch vor einem ordentlichen Beschluß sich auflösen lässt. Mit Rock'n'Roll und ähnlichen Popmythen hat das alles nur noch sehr wenig zu tun, bestenfalls ein leises Echo klingt da noch nach. Interessant dann auch die Figur des trampenden Mädchens, denn das Mädchen bekommt ja immer der Gute in alten Filmen. Dass sich das in diesem Film schließlich, nachdem sie mehrmals den Beifahrersitz gewechselt hat, mit irgendwem durchbrennt, der von der Erzählung weder etabliert wurde, noch sonst irgendwie von Interesse ist, ist schon sehr genial. Alles in allem: Groß! imdb
Der zweite Film dann war The Shooting (USA 1967), ein seltsamer Anti-Western, dessen Dialog ich leider über weite Strecken nicht so recht folgen konnte, was den Film im Gesamten nur noch befremdlicher machte als er ohnehin schon ist. Bisweilen schlägt er - etwa wenn in der weiten Wüste einem auf den Boden liegenden Mann begegnet wird - ins Mythologische um, dann wieder ist er knallhart realistisch. Kurz bevor der Film langweilig wird, schließt er schließlich dermaßen atemberaubend und verstörend, dass man ihn eigentlich gleich nochmal sehen möchte (dann aber nur mit Untertitel). imdb
The Hired Hand (Retrospektive; USA 1971) von Peter Fonda ist ein sich zum Genre ebenfalls sehr renitent verhaltender Western, den man wohl unter Drogeneinfluss sichten sollte. Interessant ist seine Struktur: Die an sich eh schon sehr minimalistische Erzählung wird in Etappen zergliedert, in denen es immer ein kleines Stückchen vorwärts geht, die Übergänge schließlich sind psychedelisch flirrende Montage- und Überblendungscollagen mit melancholischer Gitarrenmusik - deswegen auch Drogeneinfluss. Das ist so kitschig wie effizient und macht erst den eigentlichen Reiz aus: Die Handlungsetappen selbst fallen dann bisweilen etwas trocken und auch schlicht reizarm aus, erst die schummrig entrückten Kapitelüberschriften lassen eine entspannte Atmosphäre entstehen, die auch der Narration so etwas wie mythischen Charakter verleiht. Alles in allem: Irgendwie schon recht interessant. imdb
Gesteigerte Relevanz kommt deshalb dem Originalfootage zu, das, gottlob, seit diesem Jahr auch übers Internet streambar ist.
Pressekonferenzen 11.02.
 Der Horrorfilm bedient ein Kino des Verlässlichkeitsverlusts. Raum und Zeit kündigen sich gegenseitig ihre Synchronität auf, Geister aus der Vergangenheit lugen hinter Türen in das gegenwärtige Gefüge hervor. So gesehen ist Brian de Palmas im Jahr 1973 entstandener Sisters durch und durch konsequent, wie er Realitäten entwickelt, Übersichten - beispielsweise durch die typischen Splitscreens - gewährt, dann aber doch jede Gewissheit über Bord wirft und ein Szenario entwickelt, in dem souveräne Positionen nicht mehr möglich scheinen. Für den Betroffenen im Film, wie auch im Hier und Jetzt, das bei de Palma immer nur eine wackelige Kategorie darstellt, für den Zuschauer im Kinosaal.
Der Horrorfilm bedient ein Kino des Verlässlichkeitsverlusts. Raum und Zeit kündigen sich gegenseitig ihre Synchronität auf, Geister aus der Vergangenheit lugen hinter Türen in das gegenwärtige Gefüge hervor. So gesehen ist Brian de Palmas im Jahr 1973 entstandener Sisters durch und durch konsequent, wie er Realitäten entwickelt, Übersichten - beispielsweise durch die typischen Splitscreens - gewährt, dann aber doch jede Gewissheit über Bord wirft und ein Szenario entwickelt, in dem souveräne Positionen nicht mehr möglich scheinen. Für den Betroffenen im Film, wie auch im Hier und Jetzt, das bei de Palma immer nur eine wackelige Kategorie darstellt, für den Zuschauer im Kinosaal. Eigentlich aber ist das Trashkino, noch nicht mal Exploitation im engeren Sinne. Und man darf gut und gerne über einiges lachen, ohne dem Film Gewalt anzutun. Wie dann aber de Palma die investigativen Versuche einer New Yorker Kolumnenjournalistin mit politischem Bewusstsein, entgegen der Apathie der Behörden und ihrer Vertreter einen Mord aufzuklären - also Realitäten ans Tageslicht zu befördern, zu schaffen -, torpediert und ins Gegenteil verkehrt - ein Trip ins Innere wie ins Unbekannte -, das ist dann schon großartig, lässt man sich von hölzern agierenden Mimen und einer bisweilen ungelenken Dramaturgie-Gymnastik nicht abschrecken. Das beginnt schon bei der Perspektive auf den Film und seiner Personen: Fixpunkte gibt es nicht, die Narration scheint von vielen Hauptpersonen auszugehen, an die sich gekettet wird, nur um sie, wenn sie ihren Part erfüllt haben, zugunsten der nächsten abzustoßen. Das ist, gewissermaßen, von Hitchcocks Psycho übernommen. Dann natürlich der Einsatz optischer Mittel: Wenn die Journalistin ein Irrenhaus betritt, in dem sie das konspirierende Mörderpärchen wähnt, verzerrt die Bildebene das Geschehen bald schon bis ins Undechiffrierbare: Erinnerungsfragmente, hypnotische Visionen, die rein ästhetisch an die ersten Tage des Kinos erinnern und bestimmt auch nicht zufällig Bunuels Un Chien Andalou zu zitieren scheinen, und nicht zu letzt grotesk verzerrte Gegenwartskeitpartikel erschaffen ein morbides Patchwork des Weltverlusts, unterlegt mit grell übersteuerter Musik.
Eigentlich aber ist das Trashkino, noch nicht mal Exploitation im engeren Sinne. Und man darf gut und gerne über einiges lachen, ohne dem Film Gewalt anzutun. Wie dann aber de Palma die investigativen Versuche einer New Yorker Kolumnenjournalistin mit politischem Bewusstsein, entgegen der Apathie der Behörden und ihrer Vertreter einen Mord aufzuklären - also Realitäten ans Tageslicht zu befördern, zu schaffen -, torpediert und ins Gegenteil verkehrt - ein Trip ins Innere wie ins Unbekannte -, das ist dann schon großartig, lässt man sich von hölzern agierenden Mimen und einer bisweilen ungelenken Dramaturgie-Gymnastik nicht abschrecken. Das beginnt schon bei der Perspektive auf den Film und seiner Personen: Fixpunkte gibt es nicht, die Narration scheint von vielen Hauptpersonen auszugehen, an die sich gekettet wird, nur um sie, wenn sie ihren Part erfüllt haben, zugunsten der nächsten abzustoßen. Das ist, gewissermaßen, von Hitchcocks Psycho übernommen. Dann natürlich der Einsatz optischer Mittel: Wenn die Journalistin ein Irrenhaus betritt, in dem sie das konspirierende Mörderpärchen wähnt, verzerrt die Bildebene das Geschehen bald schon bis ins Undechiffrierbare: Erinnerungsfragmente, hypnotische Visionen, die rein ästhetisch an die ersten Tage des Kinos erinnern und bestimmt auch nicht zufällig Bunuels Un Chien Andalou zu zitieren scheinen, und nicht zu letzt grotesk verzerrte Gegenwartskeitpartikel erschaffen ein morbides Patchwork des Weltverlusts, unterlegt mit grell übersteuerter Musik. Das Erfassen der Realität ist natürlich ein bestimmendes Thema in De Palmas Filmografie. Optische und audiovisuelle Hilfsmittel spielen bei ihm deshalb immer auch eine große Rolle in der Narration. In Sisters hat sich De Palma noch nicht ganz zu dieser technischen Ebene vorgearbeitet, auch wenn sie sich gelegentlich schon anzudeuten scheint. Die Modulationen der grundlegenden Wahrnehmung selbst sind es, die ihn hier noch primär zu interessieren scheinen: Augen, Ohren, organisches Material. Vielleicht fühlt sich der Film ja auch deshalb ähnlich an wie die frühen, zeitgleich entstandenen Arbeiten von David Cronenberg? Schon der Vorspann jedenfalls zeigt verstörende Detailaufnahmen eines Fötus im Uterus, dessen Gesichtspartie uns schnell frontal und leinwandfüllend gegenüber steht, die Augen ganz zentral. In diesem Zurschaustellen organischer Oberfläche liegt eine ganz beunruhigende Kraft: Was mag im Innern des Zellmaterials vorgehen? Was werden diese Augen eines Tages sehen können? Einen Moment später führt der Film uns selbst vor: Zwei Föten sind da auf einmal zu sehen, nicht bloß einer. Auch wir können unseren Augen nicht immer trauen.
Das Erfassen der Realität ist natürlich ein bestimmendes Thema in De Palmas Filmografie. Optische und audiovisuelle Hilfsmittel spielen bei ihm deshalb immer auch eine große Rolle in der Narration. In Sisters hat sich De Palma noch nicht ganz zu dieser technischen Ebene vorgearbeitet, auch wenn sie sich gelegentlich schon anzudeuten scheint. Die Modulationen der grundlegenden Wahrnehmung selbst sind es, die ihn hier noch primär zu interessieren scheinen: Augen, Ohren, organisches Material. Vielleicht fühlt sich der Film ja auch deshalb ähnlich an wie die frühen, zeitgleich entstandenen Arbeiten von David Cronenberg? Schon der Vorspann jedenfalls zeigt verstörende Detailaufnahmen eines Fötus im Uterus, dessen Gesichtspartie uns schnell frontal und leinwandfüllend gegenüber steht, die Augen ganz zentral. In diesem Zurschaustellen organischer Oberfläche liegt eine ganz beunruhigende Kraft: Was mag im Innern des Zellmaterials vorgehen? Was werden diese Augen eines Tages sehen können? Einen Moment später führt der Film uns selbst vor: Zwei Föten sind da auf einmal zu sehen, nicht bloß einer. Auch wir können unseren Augen nicht immer trauen. De Palmas Filme enden selten mit Happy End. Meist finden seine Filme einen Beschluß, in dem der Regisseur seine Technik nochmals ausformuliert. Und hier findet sich dann doch schon ein optisches Gimmick und ein entsprechender Gag: Eine Couch, in der sich eine Leiche befindet (Rope? The Trouble with Harry?), mitten in der Wüste an einem gottverlassenen Bahnsteig, daneben eine Kuh, beides gefilmt aus der Gottesperspektive. Die Kamera geht zurück, gibt einen Telegrafiemast zu erkennen, an dem ein reichlich tumber Privatdetektiv incognito hängt, in der Hand ein Fernglas: Er observiert die Couch, den MacGuffin des Films. Eine groteske Situation und man meint De Palma sich köstlich über jenen Typ Menschen amüsieren zu hören, der sich, selbst noch in der bemühten Kompensation seiner Wahrnehmungsinsuffizienzien, nur in die Groteske manövrieren kann. Wir lachen mit, über diese Pointe, befreit auch nach diesem psychedelischen Horror-Thriller-irgendwas. Etwas Unsicherheit bleibt dennoch. Haben wir über uns gelacht?
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.
>> Die Schwestern des Bösen (Sisters, USA 1973)
>> Regie: Brian de Palma
>> Drehbuch: Brian de Palma, Louisa Rose
>> Darsteller: Margot Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, u.a.
imdb | mrqe | De Palma on Sisters
alle Berlinale-Kritiken
 Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.
Die formale Konsequenz, mit der Romuald Karmakar in Die Nacht singt ihre Lieder das gleichnamige Stück des norwegischen Theaterautors Jon Fosse adaptiert hat, ist, bei aller Reduktion, die manche Kritiker schon von abgefilmten Theater sprechen lässt (was, natürlich, Blödsinn ist), über weite Strecken atemberaubend, vor allem aber stets effizient.Gelassen, oft beinahe schon kühl - manche Einstellungen scheinen gar die Perspektive von in Deckenecken angebrachten Überwachsungskameras zu simulieren - , protokolliert der Film das Ende einer Beziehung. Das ist wörtlich zu nehmen: Gescheitert war man schon weit, vermutlich Jahre früher, hier nun aber geht es, mit wenigen Ausnahmen: kammerspielartig, in einer Berliner Ikea-Wohnung mit twen-haftem Bildungsbürgerkolorit, nur noch um die letzten Stunden. Um jene Momente, in denen über Jahre entstandene Geschwulste und Versteifungen sich nochmals miteinander verkanten und das sukzessive über die Jahre hinweg vollzogene Scheitern - an dem Anderen, am eigenen Leben, an Vorstellungen, Erwartungshaltungen und Ängsten - sich einmal noch geballt schmerzlich spürbar werden lässt. Auch und gerade für den Zuschauer, der, insofern sich auf die besondere Form des Films eingelassen werden kann, oft selbst nicht anders kann, als sich voller Unbehagen im Sessel zu winden.
 Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.
Wie Karmakar inszeniert, erinnert bisweilen an Fassbinder, vor allem Die bitteren Tränen... kommen in den Sinn: Kurzgeschliffene Satzstümmel, Gesprächspausen, Worte, die mehr nur sind, als sie selbst, gerne, oft auch, ihr Gegenteil, vor allem aber das, was sie nicht sind: Nur eine ungefähre Ahnung entwickelt man, was sich hier hinter einem kurzen "Ja" abspielt, welche Vergangenheit und Zerwürfnisse sich darin widerspiegeln. Präzise werden diese Dialogfragmente ausgesprochen, jede Nuance sitzt: Ein kurzer, knapper Satz, und sei er noch so banal in seinem begrifflichen Inhalt, wird dergestalt nicht selten zum gewetzten Messer, das zusticht, verletzt.Ein Film vor allem auch über Räume und deren Beziehungen zueinander. Wie man als Einzelner nicht in zwei abgeschlossenen Räumen gleichzeitig sein kann. Zu Beginn ist sie (Anne Ratte-Polle) auf dem Balkon, draußen, von drinnen gefilmt, tritt dann ein zu ihm (Frank Giering), der auf der Couch liegt und liest, wie immer eigentlich. Nebenan ist das kleine Kind im Wagen und schläft. Bald schon treten die Eltern ein, sie kommen zu Besuch, verschwinden sogleich auch wieder: Auch hier Verknöcherung. Später dann geht sie zur Disco, ist weg, er bleibt zurück, verzweifelt wartend. Zur Disco hin fährt sie in einem Auto, ein Kokon, durch dessen Sichtfenster die Lichter der Großstadt nur Flecken bleiben, die Tropfen außen auf der Scheibe scheinen Tränen zu ähneln, die der Scheibenwischer hastig verdrängt. Dann später wieder tritt sie ein, es kommt erneut zum Streit, er verweist sie im Affekt der Wohnung, sie kehrt mit ihrem Lover zurück: Ein einzigartiger Moment ist das, wenn er, der Gatte, dessen Perspektive über weite Strecken geteilt wird, sich des Raumes sicher scheint, er offensichtlich auch sicher ist, bis dann aber die Kamera, mit einem einzigen Schwenk der Kamera, den Hinterkopf des Lovers anschneidet, der in dieses Kabinett des Beziehungsschreckens eingedrungen ist und einen Raum weiter steht. Bald steht er im Hausflur, das Kind nebenan im Raum beginnt zu schreien, erhält dann, endlich, ein Gesicht: Es steht im Raum nun, ist bei der Mutter, die sich nun die Frage stellt, ob den Raum zu verlassen wirklich die rechte Lösung ist, zumal, wie sich andeutet, auch der nächste Raum, der des Lovers, allenfalls ein gleiches Gefängnis scheint. Alle drei scheinen zu zerfallen, sind selber Räume, hermetisch abgeschlossene, zur Kommunikation nicht fähig: Solipsismus.
Von Beginn an ein großartiger Film, der das Publikum wohl spalten wird. Die Presse ist bereits gespalten: Bei der morgendlichen Vorführung im Berlinale-Palast für die Journalisten herrschte zum Teil ausgelassene Heiterkeit über den bewusst (und effektiv) hölzernen Stil des Films, despektierliche Auslassungen hagelte es bisweilen im Minutentakt. Kein leichter Film, gewiss. Aber die Überheblichkeit, mit der sich darüber ausgelassen wird, korrespondiert, zumindest in diesem Falle, offensichtlich auch mit der bornierten Dummheit oder aber dem ausgeprägten Zynismus des, mit Verlaub, Geschmeißes.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbwerb. Zudem ab 19. Februar im Kino.
>> Die Nacht singt ihre Lieder (Deutschland 2004)
>> Regie: Romuald Karmakar
>> Drehbuch: Martin Rosefeld (Theaterstück: Jon Fosse)
>> Darsteller: Anne Ratte-Polle, Frank Giering, Manfred Zapatka, u.a.
imdb | offizielle Site | filmz.de | angelaufen.de
 Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht.
Manchmal gehen im Kino Wünsche in Erfüllung und das ist dann besonders großartig. Man sitzt zum Beispiel in diesem Film, betrachtet verzaubert die Leinwand, das Bild darauf, und denkt sich so, wenn der Film sich jetzt beschließen würde - genau jetzt, in diesem Moment, wo alles gesagt wurde, die Karten auf dem Tisch liegen und dennoch alles in der Schwebe hängt -, das wäre wirklich das Größte. Als könnte der Film Gedanken lesen, macht er einem eine Sekunde später auch prompt den Gefallen und blendet ab, zieht sich gleichsam zurück. Da ist man baff, perplex für einen Moment und freut sich: Alles, wirklich rundum alles wurde richtig gemacht. Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren.
Was gibt es viel von dem Film zu berichten? Wenig, bis gar nichts. 9 Jahre nach den Ereignissen aus Before Sunrise, der vor 9 Jahren von dem gleichen Team produziert wurde, hat Jesse Wallace seine Begegnung mit Celine in ein Buch verarbeitet. Damals hatte man sich - er Amerikaner, sie Französin - auf Reisen getroffen und eine Nacht miteinander verbracht. Das vereinbarte Treffen ein halbes Jahr später in Wien, so erfahren wir nun hier, hat nie stattgefunden. Auf einer Lesetour durch Europa kommt es in Paris zu einer erneuten Begegnung. Gemeinsam streift man durch Paris, lässt 9 Jahre Leben, Beziehung, Weltbild Revue passieren. Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.
Der Rest ist banal und albern, oft klug, mal ernst, dann ausgelassen, kurzum: charmant bis auf die Knochen. Nicht alles, was gesagt wird und es wird sehr viel gesagt, ist hehre Weisheit, aber einiges ist nah dran. Das macht einem den Film nahe, zumal nichts kalkuliert, aufgesetzt wirkt. Gewiss ist das auch nicht das Leben wie es ist. Aber: Im Gegensatz zu dem unsäglich gescheiterten Was nützt die Liebe in Gedanken?, der im Panorama zu sehen ist, kommt Before Sunset, in all seiner Klugheit, einem Bild von der Liebe, damit eben auch von dem Leben, vor allem aber der Tragik und Schönheit desselben, bemerkenswert nahe.Es gibt nicht viel zu berichten. Ähnlich wie Mein Essen mit André, ebenfalls ein nahezu reiner Dialogfilm, ist hier die Devise: Nicht lesen, sondern selber sehen! Oder aber, um Ekkehard Knörer zu zitieren, der in seiner Kritik einen mir unbekannten Schweizer Kollegen zitiert, der, wie der Film, schlicht und effizient alles auf den Punkt gebracht hat: "S'isch e wundrbare Film." Ganz genau!
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb.
>> Before Sunset (USA 2004)
>> Regie: Richard Linklater
>> Drehbuch: Richard Linklater, Julie Delpy, Ethan Hawke
>> Darsteller: Julie Delpy, Ethan Hawke
imdb
 Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)
Retrospektive: Pat Garrett and Billy the Kid (USA 1972/73, Sam Peckinpah)Ein Geniestreich die Besetzung Bob Dylans als Bewunderer Billy the Kids. Nachdem sich Kid in denkbar cooler Weise selbstständig aus seiner Gefangenschaft befreit, schließt sich Dylan dem Outlaw an. Ein Geniestreich auch die Entscheidung, den Soundtrack mit Dylans Musik zu bestreiten. Das verleiht der Geschichte zusätzliche Bedeutung als melancholischer Abgesang auf die gute alte Zeit, so sieht das Peckinpah zumindest, in der man zwar beim Whiskysaufen eingegrabenen Hähnen die Köpfe wegschoß, aber ansonsten einem moralischen Kodex verhaftet seinen Mann stand. Damit ist es vorbei, wenn Pat Garrett dem Auftrag schmieriger Geschäftsleute folgt und the Kid exekutiert. Peckinpahs Film hat nicht ganz das Format von "The Wild Bunch", ist dennoch Großes Kino mit unvergesslichen Szenen. Der Film wurde bei seiner Veröfentlichung drastisch gekürzt, Peckinpah hat Zeter und Mordio geschrien. In der Retrsopektive läuft die ursprüngliche, knapp 20 Minuten längere Fassung. Trotz der furchtbar zugerichteten Tonspur: unbedingt ansehen.
Retrospektive: The Outfit (USA 1973/74, John Flynn)
Robert Duvall in seiner ersten Hauptrolle, Karen Black an seiner Seite. Die Vorlage: Richard Starks alias Donald E. Westlakes Roman, an dessen Fiktion sich bereits John Boorman (Point Blank) und Jean-Luc Godard (Made in U.S.A) versucht haben, mit großem Erfolg. John Flynns Film will knallharter Neo-Noir Stoff sein, direkt, erbarmungslos, mit knappen Dialogen den Zynismus der Figuren auf den Punkt bringend. Der Film ist nicht frei von unfreiwilliger Komik, das Drehbuch vergallopiert sich in seinem Ansatz zusehends. Dennoch sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, kompromisslos.
Retrospektive: Shampoo (USA 1974/75, Hal Ashby)
Die Geschichte vom rammelnden Starfriseur in Beverly Hills, verdichtet in seiner Struktur - der Film spielt am Wahlabend des 5.November 1968, als Nixon an die Macht kam - ist mehr noch als Ashbys The Last Detail sarkastischer Geselschaftskommentar, beinahe schon Sittengemälde. Obwohl Shampoo bekannter ist, funktioniert meiner Meinung nach das Prinzip der Entlarvung nicht annähernd so gut wie in The Last Detail. Auch hier gibt es zwar unfassbar witzige Momente, speziell in der Charakterisierung des Friseurs, gespielt von Warren Beautty, die Geschichte ist jedoch in seiner Dramaturgie bereits stärker dem Mainstream Kino verhaftet, markiert bereits deutlich eine Abkehr vom klassischen New Hollywood. Es werden neu entstandene Erwartungshaltungen bedient, der Held, auch wenn es am Ende für ihn kein Happy End gibt, durchläuft eine Entwicklung, die ihn neugeboren aus der Handlung hervorgehen läßt. Das verweist bereits sehr stark auf die heute bis zum Exzess durchgehechelte Odyssee des Helden.
Thomas Reuthebuch
 Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.
Kim Ki Duk schafft in "Samaria" zuächst in klar skizzierten Szenen die Ausgangsposition zu einer letztlich religiös motivierten Erlösungsgeschichte. Die beiden Teenager Yeo-Jin und Jae-Young sind nicht nur beste Freundinnen, die eine fungiert auch als Zutreiberin reifer Männer, die sich dann gegen entsprechendes Honorar sexuell mit der anderen vergnügen können. Jae-Young ist nichts anderes als eine Prostituierte, die in Schuluniform die tugendhafte Lolita mimt, es dabei aber faustdick hinter den Ohren hat. Als sie sich in einen der Freier, einen Musiker, verliebt, reagiert Yeo-Jin eifersüchtig. Wenig später stürzt sich Jae-Young vor ihren Augen aus einem Fenster.Bis dorthin sind die Szenen von einer permanent spürbaren unterschwelligen Bedrohung geprägt, bis in die friedlich anmutende Szene hinein, in der Yeo-Jins Vater sich liebevoll um seine schlafende Tochter bemüht. Am Frühstückstisch genügen dem Film zwei knappe Sätze, um die der Kleinfamilie innewohnende Tragik, die Mutter ist kürzlich verstorben, und den beruflichen Background des Vaters, er ist Kriminalbeamter, zu umreißen.
Die Inszenierung schreitet in klaren Schritten ihre Handlung ab, der Soundtrack konterkariert die Unaufhaltsamkeit der Tragödie mit melancholischer Musik. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis sich die Befürchtungen des Zuschauers um die Figuren einlösen werden, und wenn Jae-Young sich nach dem Sturz in ihrem Blut krümmt, hat das eine Intensität, die nur schwer auszuhalten ist. Man glaubt zu wissen, besonders wenn man die bisherigen Filme Kim Ki Duks kennt, ohin das fhren wird.
Allerdings, in zunehmenden Maße kippen die bei "The Isle" oder auch dem später entstandenen "Bad Guy" noch so verstörend-poetischen Bilder ins Groteske, etwa wenn ein vom Vater in den Freitod getriebener Freier auf dem Boden aufschlägt, im Off, und sein auf dem Asphalt verspritztes Hirn langsam ins Bild fließt. Auch wenn der Film am Ende, in den letzten Szenen, nachdem Vater und Tochter gemeinsam das Grab der verstorbenen Ehefrau/Mutter aufsuchen, noch einmal auf eine transzendentale Ebene zurückfindet, wird der Verdacht bald zur Gewissheit.
Kim Ki Duk hat sich in seinem selbst erschaffenen Universum assoziativer Bildverästelung abgearbeitet. Samaria ist, vor allem wenn man die großartigen Arbeiten seines Regisseurs in den letzten Jahre in Betracht zieht, eine Enttäuschung. Vielleicht sogar die größte Enttäuschung des Festivals, bislang.
Thomas Reuthebuch
 Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation.
Es dauert eine knappe Stunde bis Helen (Kitty Winn) der Versuchung erliegt und endgültig zum Junkie wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück mehr, wird der Film seine Figuren auf eine abwärts führende Spirale schicken, die für sie dort enden wird, wo sie der junge Bulle, der Helens Entwicklung begleitet, von Anfang an gesehen hat: in der Selbstaufgabe jeglicher moralischer Wertvorstellungen, schließlich in der Denunziation. Jerry Schatzbergs Film landete in der Retrospektive in einer komplett neu restaurierten Fassung, ein Glücksfall für das Publikum, wirkten beim komplizierten Color Matching auch der Regisseur selbst und sein Kameramann Adam Holender mit. Die frisch gezogene Kopie trägt damit in nicht unerheblichem Maße zu einer atemberaubenden Zeitreise bei, die uns die Möglichkeit eröffnet, Schatzbergs dem Cinema Verite verhafteten Film in einer Art und Weise wiederzuentdecken, die an das ursprüngliche Kinoerlebnis im Jahr 1971 heranreicht.
Die bedrückende Authentizität des Films zerstreut jedoch sehr schnell die Freude am ästhetischen Genuß, zieht den Zuschauer mit unwiederstehlicher Sogwirkung in seine Geschichte, die sich ausschließlich in einem klar abgesteckten Rahmen abspielt, an der 72.ten Ecke Broadway, eben am titelgebenden "Needle Park", einem Drogenumschlagplatz für Manhattans Junkieszene.
Kitty Winn gewann zwar den Oscar für die beste Hauptrolle, es ist aber Al Pacino, der den Film unvergesslich werden läßt. Er spielt den Hustler Bobby, manisch, immer in Bewegung, eine faszinierend anzusehende Demonstration von der Technik des Method Acing beeinflusster Schauspielkunst. Es war seine erste große Rolle und man findet bereits hier all das wieder, was ihn zu einem der größten Filmschauspieler unserer Zeit werden ließ.
Schatzbergs Inszenierungsstil, kühl, kontrolliert, die unbarmherzige Umgebung in schäbige Farben gießend, zeigt uns ein New York, in das kein Tageslicht zu dringen scheint. Es ist ein langer Weg von der verbrähmten Drogenromantik der 60er Jahre bis hierhin, die Diskrepanz zu "Easy Rider" etwa könnte kaum größer sein.
Der erbarmungslos anmutenden Montagetechnik, die in abrupten Schnitten die Entwicklungsstufen der Protagonisten hart aneinanderreiht, kommt gesteigerte Bedeutung zu. Als Pacino einen Kurierjob erledigt, reicht die Andeutung eines Polizisten, der sich aus dem Schatten einer Häuserwand löst. In der nächsten Einstellung finden wir ihn unter der Dusche im Knast, mit anderen Inhaftierten scherzend, voll in seinem Element. Nächste Einstellung: Pacino tritt in die Freiheit, läuft an einer trostlosen Häuserzeile entlang. Hinter ihm taucht Helen auf, die ihn verraten hat. Sie will wissen, ob er nachtragend sei. Pacino entgegnet: "Well". Sie schließt zu ihm auf. Die beiden gehen nebeneinander, ohne sich anzusehen. Schnitt. Schwarzblende. Abspann. Keine Musik, kein Geräusch im Kinosaal. So macht man das.
Thomas Reuthebuch
 Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn.
Am Anfang von "The Last Detail" steht der Auftrag. Die beiden Navy Soldaten "Badass" Buddusky (Jack Nicholson) und "Mule" Mulhall (Otis Young) haben eine Woche Zeit um den 18-jährigen Seemann Larry Meadows (Randy Quaid) vom Stützpunkt in Virginia nach Portsmouth, New Hampshire zu überführen. Dort erwartet das Riesenbaby eine 8-jährige Gefängnisstrafe. Sein Vergehen: der Versuch, lächerliche 40$ aus einem Wohltätigkeitsfond zu veruntreuen. Badass und Mule sind alles andere als begeistert. Ihr Plan: schnelle Überführung des Delinquenten, der Rest der Woche freie Bahn. Ashby entwickelt aus dieser Prämisse mit Drehbuchautor Robert Towne eine bitterböse Satire mit einem überragenden Jack Nicholson, in deren Kern nicht nur die erfolgreiche Überführung alberner Militärromantik steht, sondern darüber hinaus nicht weniger als eine treffsichere und schließlich ergreifende Studie ausweglos erscheinender, sich aus Angst und Hilflosigkeit speisender Ohnmacht. Das darf man sich nun nicht etwa als Sozialstudie vorstellen sondern als, in seiner glasklaren Struktur am ehesten an eine mythologische Reise erinnerndes Road Movie. Dabei zeichnet sich Ashbys Inszenierung immer wieder durch seine genaue Beobachtung und dessen Fähigkeit zur Überführung ins Groteske aus.
Bereits der bierernste Aufbruch der drei aus dem Stützpunkt in einer lächerlich anmutenden Rostlaube, begleitet von schmissiger Militärmusik, bietet einen Vorgeschmack dieses durchgängigen Prinzips. Das Drehbuch schließlich bietet in seiner intelligenten Durchdeklinierung der sich ständig verändernden Dreierkonstellation jede Menge Fleisch für Ashbys Inszenierungsstil. Jack Nicholson ist dabei stets Verbündeter des Regisseurs als auch Dreh- und Angelpunkt der Dramaturgie innerhalb der Sequenzen, die den Film, respektive die Reise, in schöner Regelmäßigkeit in einzelne, sich am Ende immer weiter verdichtende Episoden auffächert.
Am beeindruckendsten sicherlich die bedrückende Darstellung der bereits angesprochenen Ausweglosigkeit Budduskys. Auch wenn der Film immer wieder Situationen herstellt, die man in Ermangelung eines treffenden deutschen Begriffs am ehesten mit "deadpan humor" umschreiben kann, verweisen die Figuren in ihrem offensichtlich ungebrochenen Obrigkeitsdenken und dem daraus resultierenden fehlendem Bewußtsein, geradezu exemplarisch auf die tiefgreifende verheerende Wirkung, die sich für das rückwärtsgewandte Individuum in einer sich ständig erneuernden Gesellschaft ergibt.
Das spannende an "The Last Detail" ist denn auch die Perspektive, Budduskys Perspektive, eines Verlierers, der intellektuell von den Veränderungen überfordert ist, emotional dieser Überforderung mit Aggression begegnet, der aber dennoch von Ashby niemals vorgeführt wird. Das ist schon ein Kunststück, speziell wenn man sich vor Augen führt, wie weit der Film in der Darstellung der Erbärmlichkeit seiner Figuren geht. Wenn sich die drei etwa in einem Stundenhotel hemmungslos besaufen, demonstriert Buddusky stolz seine "Kunst", die des "Signalmans", eine wenig elaborierte Aneinanderreihung einfachster Bewegungsabläufe, die selbst Meadows wenig später problemlos imitieren kann. Bei einer Hippieparty, in der Ashby mit unverhohlener Ironie die Erlösungshoffnungen der amerikanischen Jugend in fernöstliche Religionen persifliert, versucht der jodelnd-balzende Buddusky bei einem Mädchen (Nancy Allen) mit seiner lächerlich-kitschigen Masche vom harten Leben auf der See zu landen.
"The Last Detail" vermittelt durch die Ziellosigkeit seiner Figuren auch ein Gefühl für die anonyme Ödnis der USA, für die Austauschbarkeit seiner urbanen Landschaften, die endlos sich hinziehende Langeweile an den Ausfallstraßen der Großstädte. Jack Nicholson erhielt für seine aggressive, energiegeladene, dann wieder zart und einfühlsam angelegte Rolle die Goldene Palme beim Filmfestival von Cannes. Für den Oscar als bester Hauptdarsteller war er genauso nominiert wie Randy Quaid als bester Nebendarsteller und Robert Towne für das beste Originaldrehbuch.
Thomas Reuthebuch
 Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.
Immerhin zugute halten kann man diesem Film, dass er die Erwartungen, gleich auf welche Weise sie sich auch nach dem Trailer gestaltet haben mögen, komplett erfüllt. Man kann darin durchaus einen Film nicht so sehr über die Liebe als solche sehen, sondern über das Bild, das man sich von dieser macht. Oder aber man fasst sich während der Sichtung ob dieses nicht enden wollenden Kitschgebräus wiederholt resignierend an den Kopf. Das größte Problem des Films ist, dass er seinem Thema hoffnungslos erlegen, sich selbst ebenso verfallen ist, wiewohl es doch eigentlich nur juvenile Petitessen sind, die sich da ereignen. Distanz wäre da vonnöten, wo er überhöht, Nuance dort, wo er nur Brei zustande bringt.In den 20er Jahren finden sich in einem gutbürgerlichen Landhaus im Berliner Umland, weil die Eltern verreist sind, für ein ausgedehntes Wochenende die beiden Geschwister Guenter (August Diehl) und Hilde (Anna Maria Mühe) und der eher verarmte Dichter Paul (Daniel Brühl) ein. Nach etwas romantischer Schwärmerei steht fest: Paul und Guenter gründen einen Selbstmörderclub, dessen Mitglieder sich richten, sobald die Liebe sie verlassen hat. Am Abend finden sich weitere Freunde und Bekannte zu einer ausgelassenen Party ein. Ökonomien fordern ihren Tribut: Guenter liebt Hans, mit dem err mal was hatte, der hat aber nun was mit Hilde, die mit allen anderen auch was hat und in die aber Paul verliebt ist. Zwei Tage später sind Tote zu beklagen. Basierend auf einer wahren Geschichte.
 Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.
Jedem ist das mal passiert: Auf einer Party sein und der heimlich ausgesuchte Schwarm knutscht mit wem anders rum. Mal pampig gesagt: Deswegen bringt man sich aber noch lange nicht um, die wenigsten zumindest machen dies. Behauptet man das Gegenteil, sollte die Argumentation geschliffen sein. Was nützt die Liebe in Gedanken begnügt sich allerdings damit, auf der bloßen Oberfläche des Bildes durch allerlei schwülstige wie naheliegende Bilder viel zu behaupten. Da sitzen schmachtend betrachtete Schmetterlinge auf Pistolenläufen, Nebelschwaden ziehen über nächtliche Seen, Weizenähren wogen im Wind wie im Close-Up - Thanatos, ick hör Dir trappsen! Das ist alles so wohlbekannt, wie unerheblich: Nie ist man drin im Film, der Film aber geht in seiner liebestrunkenen Bilderwelt von nichts anderem als seiner Wirkmächtigkeit aus und entblößt damit eine nicht von der Hand zu weisende Lächerlichkeit: Eigentlich findet man das Geschwafel nur noch kleinkariert, die Figuren auf unsympathische Art und Weise naiv. Dabei haben auch (ich möchte sagen: gerade und besonders) romantische Stoffe, die sowieso schon mit sich und einer latenten Peinlichkeit zu kämpfen haben, eine gewisse Tiefe in der Herangehensweise verdient, die sich nicht im Aufgreifen von Naheliegendem, Offensichtlichem, schlicht Abgenagtem erschöpft.Dass der Film sich letztendlich nur in solchem Einerlei ergießen wird, steht als Drohung schon von Anbeginn im Raume, wenn man sich, neben all dem eh schon Ärgerlichen der ästhetischen wie narrativen Auflösung, das da folgen mag, auch noch mit einem der unelegantesten Kniffe der Dramaturgie beginnen lässt: Der inhaftierte Paul sitzt in der Wache, eine Art Testament wird verlesen, kurzer Blick auf die Medienberichterstattung der Ereignisse, dann Verhör und Paul verschwindet aus dem Bild, ins Off, von wo aus er seine illustrierten Erinnerungen an die letzten Tage kommentiert. Warum dieses bornierte Element deutschen Geschichtchen-Erzählkinos aus den Köpfen der Drehbuchautoren nicht rauszukriegen ist, bleibt auch bis auf weiteres zu fragen. Es funktioniert nur selten, meist nie, und ist mindestens ebenso häufig schlicht nicht notwendig. Und auch Was nützt die Liebe in Gedanken?" kann aus dieser Exposition kein Kapital schlagen, steht sich dadurch dramaturgisch eigentlich schon im Weg: Wer nun den Freitod wählen wird und wer nicht, ist somit nicht mehr von Belang, für die nächste Frage - Wie konnte es nur soweit kommen? - gibt der Film schlicht zu wenig her.
Bleibt einmal mehr die Erkenntnis: Auch ein auf hohem technischen Niveau an die Wand gefahrener Wagen wird in der Statistik lediglich als Versicherungsfall aufgeführt.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Panorama. Ab 12.02. zudem regulär im Kino.
Regie: Achim von Borries; Drehbuch: Achim von Borries, Hendrik Handloegten, Annette Hess, Alexander Pfeuffer; Darsteller: August Diehl, Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske, u.a.
imdb | offizielle Site
Schön ist da, wie nun gerade entdeckt, dass es diese Kritikenretrospektive komplett auch zum hier zum Download gibt, beim Filmmuseum Berlin, das für die Retrospektive mitverantwortlich zeichnet.
Zwar etwas mühsig nur als einzelne pdf-Dateien, aber immerhin.
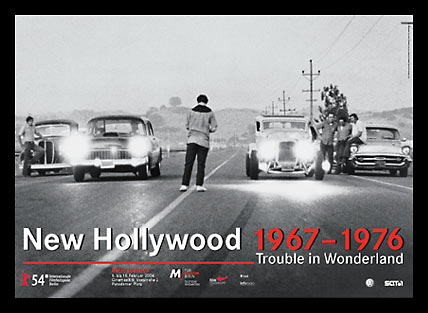

 Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.
Liegengebliebenes, nicht Rangewagtes, nicht ganz Durchdrungenes, kurzum: Was schlicht nicht zu verarbeiten war.Der Kritiker hats schwer auf einem Festival: Einerseits ist man ja Filmenthusiast wie jeder ander auch und will soviel wie möglich sehen. Andererseits muss man sich seinen Akkreditierungspass auch irgendwie rechtfertigen und was schreiben - nach Möglichkeit auch Sinnvolles -, seinen Lesern fühlt man sich schließlich auch irgendwie verpflichtet. Aber wer steht schon gerne eine Stunde lang vor dem Writing Room an, wenn währenddessen in der Retrospektive doch gerade ein unheimlich wichtiger Film läuft? Und dann will einem auch nicht zu jedem Film was einfallen, was niederzuschreiben wert wäre, die Zeit ist zudem begrenzt, die Sinne von zwischen drei bis fünf Filmen täglich eh schon überlastet, der Biorhythmus hoffnungslos im Eimer. Also sortiert man aus, schweren Herzens oft: Vieles bleibt liegen.
Deswegen nun: Short Cuts, in loser Folge. Kurze Eindrücke, ehrliche Eingeständnisse, wenn man überfordert war, Notizen, die es nicht zur Kritik gebracht haben.
The Last Detail (Retrospektive; Hal Asbhy, USA 1973) ist ein entspanntes Roadmovie mit satirischen Untertönen. Sehr laid-back und smooth, könnte man sagen, ideal jedenfalls für ein Matinée (und er lief auch morgens um 11): In den Sessel kuscheln und den Episoden einfach beim Plätschern zusehen. Schön, wenn Filme ihr eigentliches Anliegen - erste Szenen im Militärbunker, letzte Szenen im Militärknast - so ansprechend verstecken, ohne aber es zu leugnen. Dieser Kontrast macht auch in der Narration Sinn: Das eigentlich Schreckliche blenden wir aus, um das Schreckliche damit infolge nur noch schrecklicher zu machen. Sicherlich keine der größten Leistungen der Retrospektive, aber immerhin doch sehr charming und obendrein war die Kopie auch in recht guter Qualität (eine der 15 neugezogenen?). imdb
Weit weniger gut war die Qualität der Kopie von The Cool World (Retrospektive; USA 1964) von Shirley Clarke: Sehr unscharfe, eigentlich schon milchige Bilder mit ordentlich Laufstreifen und ähnlichem, kratziger Ton wie von alten Shellackplatten. Das ist ein Problem für den Film, der viel mit Reißschwenks, dynamischem Schnitt und hektischer Jazzmusik arbeitet. Folge deshalb: Nach gut einer Stunde pochende Kopfschmerzen. Trotzdem meine ich, Qualitäten erkannt zu haben: In der Montage kreuzt die Regisseurin dokumentarische Aufnahmen vom Straßenleben Harlems mit denen ihrer fiktiven Narration, von ein paar jugendlichen Schwarzen, die, beeindruckt von den cats, den coolen Gangstern, ebenfalls eine Karriere als Kriminelle einschlagen wollen, daran aber letztendlich, ähnlich wie im Verlauf die Vorbilder, scheitern. Es entsteht ein Patchwork aus Milieuschilderung, Zeitdokument und Krimi, das nicht ohne Reiz ist. Vielleicht sogar ähnlich wichtig wie Melvin van Peebles' Sweet Sweetback's Baaaadaaaasss Song? Angemerkt sei, dass der Film etwas zu alt ist für eine Retro, die sich auf die Jahre zwischen '67 und '76 konzentriert, ist mir nur gerade noch aufgefallen, aber egal. imdb
Nur wenige Jahre später entstanden und, wenn ich das jetzt richtig überblicke, in einer ähnlichen Ecke New Yorks angesiedelt wie auch der großartige David Holzman's Diary: The Panic in Needle Park (Retrospektive; Jerry Schatzberg, USA 1971). Die Konsequenz der Milieu- und auch Elendsschilderung ähnelt bisweilen sogar Clarkes Film, zumindest aber ist auch in diesem (Anti-)Drogenfilm ganz schön viel ganz schön schmutzig. Die Materialästhetik unterstreicht dies, trotz neugezogener Kopie, zudem: Selten war Fixen im Kino schmuddeliger anzusehen. Die Größe des Films besteht dann allerdings darin, dass er sich trotzdem an diese Menschen ranwagt, ganz dicht oft sogar, alles akribisch festhält, nie aber in den Duktus der moralischen Empörung verfällt (oder aber: sein Thema glorifiziert). Ein zutiefst menschlicher Film, der, zum Glück, dennoch nicht menschelt. Und wie er am abrupten Ende dann sowohl Hoffnung als auch Defätismus in ein Bild, in einen kurzen Moment packt, das ist ebenfalls sehr groß. Bei der Sichtung leider recht müde gewesen, deswegen war er hier und da etwas lang - eine erneute solche unter besseren Bedingungen meinerseits wird sich hiermit vorgenommen. imdb
 Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos.
Der Film beginnt mit einer wunderbaren Einstellung, ein Klavier, abgespannt, mit zwei Seilen, hängt von einem Kran scheinbar schwerelos in der Luft. Dann der Schnitt auf eine Gruppe Passanten (?), Anwohner (?), die das Schauspiel voller Anteilnahme verfolgen. Aus der Mitte der Gruppe löst die Inszenierung eine Dame (Aurore Clément), vielleicht Mitte fünfzig. Sie ist die Besitzerin des Klaviers, begleitet jedes Manöver mit beinahe lustvollem Stöhnen. In der nächsten Einstellung stürmt die Frau durch eine Wohnung, es ist Charlottes (Sylvie Testud) Wohnung, Chaos aller Orten. Endlich findet sie den Flügel, verschwendet keine Zeit und spielt munter drauflos. Auch Chantral Akerman verschwendet keine Zeit. Innerhalb weniger Minuten hat sie dem Zuschauer klar gemacht um welche Art Film es sich bei „Demain, on déménage“ handelt. Es ist eine Komödie, dem Slapstick verwandt, die ihr Heil in der halsbrecherischen Beschleunigung der Szenen zu finden glaubt. Es wird viel und schnell gesprochen, Kippen werden mit einer abrupten, knappen Bewegung im Aschenbecher zerdrückt, der Laptop, kaum zusammengeklappt, durch den Raum gezerrt. Im Café wird schnell zugehört, man macht sich schnell miteinander bekannt und irgendwann, das ist jetzt gemein, aber dennoch, hat man das Gefühl, dass man schnell raus muss, und sei es nur um sich zu erholen von so viel Hopplahopp.
Im Zentrum dieser Möchte-gern Screwball Comedy steht Sylvie Testud und wenn man einer Schauspielerin zutrauen mag einen entsprechenden Film zu tragen, dann sicher der zierlichen Belgierin. Ich habe im letzten Sommer Sylvie Testud in einem wunderbaren Film von Alain Corneau gesehen (Stupeur et tremblement) in dem sie eine grandiose Vorstellung gibt, ihre Rolle zwischen kindlicher Naivität und sinnlicher Erotik anlegt und dabei auch ihr Gespür für das notwendige Timing in den komödiantischen Momenten des Films zeigt. Ich erwähne das deshalb, um ihre Bandbreite zu verdeutlichen und auch deshalb, weil ich glaube, dass einzig und allein die Inszenierung schuld am Misslingen von „Demain, on déménage“ ist.
Es scheint, dass der Film durch die Hyperventilierung seiner Hauptdarstellerin die Luft zum Atmen nimmt, dass man dem Wortwitz des durchaus schlagfertigen Drehbuchs keine Raum zur Entfaltung läßt. Je länger der Film andauert desto deutlicher wird, wie sehr dieses Konzept ins Leere läuft, und wie wenig gut offensichtlich Chantal Akerman in diesem Genre aufgehoben ist. Da hilft auch das gelungene Casting nichts, bis in die kleinsten Nebenrollen hinein, es hilft auch nicht das schöne Set-Design, überhaupt die bemerkenswerte Kameraarbeit – das sagt man natürlich immer dann gern, wenn man einem Film nicht unnötig weh tun will, den man schlicht und ergreifend nicht mag. Warum viele behaupten dass die Komödie ein gefährliches Genre ist wird hier überdeutlich. Stimmt das Timing nicht, steckt man ganz tief im Schlamassel.
Thomas Reuthebuch
Demain, on déménage
Regie: Chantal Akerman
Buch: Chantal Akerman, Eric de Kuiper
Darsteller: Sylvie Testud, Aurore Clément, Jean-Pierre Marielle, Natacha Regnier
 Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films?
Die erste Überraschung gleich zu Beginn. Das 16mm Ausgangsmaterial, gefilmt mit der legendären Beaulieu, die damals gängige Grundausstattung professionell orientierter Dokumentarfilmproduktionen war, macht ihrem Ruf alle Ehre. Selbst über 35 Jahre nach Entstehung des Films sind die grobkörnigen s/w-Aufnahmen ein Genuß und auch bei der Tonqualität (verwendet wurde eine Nagra) kommt Wehmut auf, speziell wen man an die furchtbar zersetzte, kaum zu ertragende Tonspur des Screenings von Peckingpahs „Pat Garrett and Billy the Kid“ denkt. Wurde eine neue Kopie geszogen oder lags an der zu vermutenden, selten bemühten Aufführung des Films? Wenn Kit Carson sich im Spiegel selbst abfilmt, mit Equipement bepackt, ist das nicht ganz ohne Ironie, zumindest aus heutiger Perspektive betrachtet und erinnert an die vom Cyberpunk häufig beschworene Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und in diese Richtung kann man Jim McBrides Ansatz durchaus denken, auch wenn die Auflösung von Persönlichkeitsstruktur, letztendlich die Auslöschung des Individuums, von Bewußtsein überhaupt im Mittelpunkt steht. Gegen Ende des für seine Zeit bemerkenswerten Films gibt es schließlich eine Szene, die diesen Aspekt und die daraus resultierende Sprachlosigkeit auf den Punkt bringt. David Holzman alias Kit Carson alias Jim McBride positionisiert sich vor der Kamera, tritt schließlich aus dem Bild. Es folgt ein Schrei, aus dem Off, dann Schwarzblende, Zeitsprung, erneuter Versuch, eine Entschuldigung.
Am Besten ist „Davis Holzman´s Diary“ immer dann, wenn er sich auf seine experimentelle Struktur verläßt. In den letzten Einstellungen gewinnt der Film noch einmal an Format. In einer langen Einstellung gleitet die Kamera durch die Nacht, gnadenlos unterbelichtet. Aus der Schwärze des Raums lösen sich Objekte, ein Fenster, die Leuchtreklame eines Delis, kaum zu bestimmende Artefakte, Abstraktion in Reinkultur. Dann: Holzmans Equipement wurde gestohlen, es bleibt der Gang zur Billigvinylpresse (Ton) und in den Paßbildautomat (Bild). Ein Abschied, und der Film ist zu Ende.
Gut gefallen haben mir auch die aus der Geschichte herausbrechenden essayistischen Betrachtungen. Eine Parkbank mit Rentnern wird abgefilmt, die Kamerabewegung simuliert das rhythmische Auf und Ab des Abschreitens, auf der Tonebene die Originalaufnahmen der UN-Vollversammlung, die über die Zukunft Palästinas entscheidet. Holzman beobachtet zwei Bullen, die einen Obdachlosen schikanieren, aus dem Off, lakonisch, die Nachrichten des Tages. Plötzlich ist der Film beißender Kommentar, nicht nur deshalb ein wichtiges Zeitdokument.
Thomas Reuthebuch
 Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag.
Melvin Van Peebles legendärer Befreiungsschlag, die ultimative Undergroundproduktion "Sweet Sweetback...", ist vulgär, beinahe abstoßend, erinnert in seinem respektlosen Umgang nicht nur gängiger Hollywoodkonventionen, sondern auch grundsätzlich filmischem Handwerks gegenüber wie ein brutal zusammengeklopptes Patchwork an spontanen Einfällen und stilistischen Geschmacklosigkeiten. Man braucht eine ganze Weile um sich auf die collagenartige Oberflächenstruktur des Films einzulassen. Natürlich ist es denkbar schwer, über 30 Jahre nach der Entstehung des Films sowohl die politische als auch die künstlerische Radikalität des Entwurfs nachempfinden zu können - zumal als in Deutschland aufgewachsener Weißer, dessen Sozialisation vor allem in den 80er Jahren geschah. Dennoch vermittelt der Film eine Vorstellung von dem was Melvin Van Peebles Film ausgelöst haben mag. Während im Wettbewerb das Ausbleiben der großen Stars speziell von der "Bunten" Presse beklagt wird, dürfen sich die Cineasten in der Retrospektive über so manchen Überaschungsgast freuen. Da erscheint etwa das Phantom des "unabhängigen" amerikanischen Films, Terrence Malick, höchstpersönlich in einem Screening seines Klassikers "Badlands", da schlurft Peter Fonda durch die grauenhafte Max-Bar oder es taucht eben auch das Vater-Sohn Gespann Melvin und Mario Van Peeples im "Sweetback"-Screening auf. Stehende Ovationen gabs keine, was sicher auch an der erschreckenden Unterrepräsentierung farbiger Filmjournalisten liegt und lag. Van Peebles, mittlerweile in den Siebzigern, ist noch immer ein energiegeladener Mann mit Visionen und Plänen. Seine Ausführungen zur Enstehungsgeschichte des Films machen deutlich: "Sweetback..." entstand vollkommen abgetrennt von jeglicher Strömung, ist ein Einzelfall gewesen und geblieben. Der mit MGM entstandene Deal über drei Filme wurde aufgekündigt, Van Peebles konnte niemals als Filmemacher Fuss fassen, sein Sohn Mario hat das zumindest später nachgeholt (seine Spielfilmdoku über die Enstehung zu "Sweetback" läuft im diesjährigen Forum). Interessant auch die Offenheit mit der über die Produktionsrealitäten gesprochen wurde, die zu manch gestalterischer Entscheidung führten. Da gibt es etwa ziemlich zu Beginn des Films ein paar Einstellungen mit psychedelisch anmutenden Farbverfremdungen über die Mario bei der Recherche zu seinem Film gestolpert ist und die, ganz profan, quasi als Unfall, bei der Belichtung des Materials entstanden (man wollte Day for Night drehen).
Es gibt jedoch wohl kaum einen Film, bei dem bewußte stilistische Entscheidungen unwesentlicher erscheinen. Alles scheint intuitiv und spätestens nach der Totschlagszene, als Sweetback also seine über den gesamten Film andauernde Flucht beginnt, nimmt die Intensität in einem nicht geglaubten Maße zu - oder ist es nur die Gewöhnung des Betrachters an den expressionistischen Ansatz? So oder so, man spürt in jeder Einstellung den bedingungslosen Willen Van Peebles Ernst zu machen und sich einen Scheißdreck um Erwartungshaltungen zu kümmern. Die Umkehrung der Konvention ist denn auch das Prinzip, unabhängig von politischen Ausrichtungen, im übrigen. Sweetback wird als rammelnder Superlover mit großem Schwanz eingeführt, der sich vor einer Ansammlung Farbiger, aber eben auch libertärer Weißer vorführen läßt. Als er später auf die Hells Angels trifft, fickt er sich sprichwörtlich in die Freiheit und am Ende verendet er eben nicht, wie die auf ihn gehetzten Hunde in der Wüste, sondern es gelingt ihm die Flucht über eine Bergkette nach Mexiko. Ein bis dahin undenkbares Filmende für einen farbigen Protagonisten.
Thomas Reuthebuch
Sweet Sweetback´s Baadassss Song
Regie, Buch, Schnitt, Produktion, Musik: Melvin Van Peebles
Kamera: Bob Maxwell, Jose Garcia
Musik gespielt von: Earth, Wind and Fire
Darsteller: Melvin Van Peebles, Simon Chuckster, Hubert Scales, John Dullaghan
Eine Berlinale ohne Aprilwetter ist offensichtlich keine.
 Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen.
Zu Beginn der Vorführung herrscht Verwirrung. Bis wenige Minuten später der Anmoderator der Retrospektive mit Mikrofon die Situation kurz erläutert und sich beim Publikum für die technische Panne entschuldigt, läuft der Film ohne Ton. Ironie des Schicksals, denn man weiß ja eigentlich, dass David Holzman's Diary die Bedingungen von Produktion, Wahrnehmung und Einschätzung audiovisueller Medien untersucht und reflektiert. Was also sind diese stummen Bilder, die doch eigentlich, ihr Inhalt legt es zumindest nahe, Ton haben müssten? So gewollt, also erster künstlerischer Kniff dieses überaus cleveren Films? Verunsichertes Hüsteln im Saal, erste Aufforderungen, dass doch einer bitte mal dem Vorführer bescheid sagen soll, werden, wenn auch mit leichtem Timbre in der Stimme, geäußert. Wie gesagt: Verwirrung. Man darf wohl davon ausgehen: Dem Regisseur Jim McBride hätte das gefallen. Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.
Denn David Holzman's Diary kokettiert zu jedem Zeitpunkt mit der Verbindlichkeit seiner Bilder, mit einem Realismus, der sich nicht nur material- und bildästhetisch, sondern auch in den Bildern selbst zu bestätigen scheint. "Cinema is truth, 24 times per second.", dieses Zitat von Godard stellt der arbeitslos gewordene Filmemacher David Holzman, dem außerdem die Einberufung ins Haus steht, seinem filmischen Tagebuch voran. Eine der ersten Szenen zeigt ihn in einem Stuhl, über ihm ein Spiegel, der die aufnehmende Kamera zeigt und in diesem wiederum die Spiegelung eines hinter der Kamera sich befindenden Spiegels, der den Spiegel selbst wieder spiegelt: Der - scheinbar -bis ins Endlose übersichtlich gewordene Raum. Keine Techniker anwesend, die Schaffung des Films selbst ist sein Inhalt.Es folgen Fragmente des Alltags, Eindrücke, Spielereien, die Erschließung des nachbarlichen, urbanen Raumes - der Film spielt in New York, 1967 -, wie auch eine kleine Erzählung. Doch zuvor wird das Equipment selbst vorgestellt: Eine 18 Pfund schwere 16mm-Kamera, die ihre eigene Werbeanzeige und Bedienungsleitung abfilmt, und ein unhandlicher Taperekorder zum Umhängen bilden die Schnittstellen zu dem, was sich Wirklichkeit nennt. Holzman experimentiert im folgenden mit dieser Technik, weil er, so sein Anliegen, etwas über sich und die Wirklichkeit der äußeren, der Dingwelt herausfinden will. Ob dann beispielsweise ein Gespräch so wirklich stattfindet, ob die Präsenz der Kamera das Gespräch nicht beeinflusst oder ob der Dialog nicht sogar komplett inszeniert ist, ist eine Frage, die dabei stets im Raum steht und, trotz aller Verbindlichkeit, die die Bilder ausstrahlen - das heißt: einmal ist sie gebrochen, wenn sich in der Brille einer offensichtlich Prostituierten wiederholt eine Filmcrew spiegelt, Holzman im Bild selbst nicht anwesend ist, aber ein intimes Gespräch zwischen Holzman und der Frau suggeriert wird - kaum wirklich befriedigend aus der Diegese heraus beantwortet werden kann. Und wie verhält es sich mit den zahlreichen Monologen? Holzman selbst, bzw. auch ein minutenlanger Monolog eines Bekannten, reflektiert diesen Umstand: Was von dem, was er da spricht, ist verbindlich wahr und wie könnte eine solche Verbindlichkeit versichert werden?
Während zu Beginn Bild und Ton, obwohl separat voneinander aufgenommen, noch korrespondieren, trennt Holzman die Ebenen zusehends. Dann wird die Tonspur für Minuten zum Audiokommentar, etwa wenn er eine somit stumm gewordene Auseinandersetzung mit der Polizei - "And now they're gonna hit me!" und die Sequenz ist zuende - aus dem Off erläutert. Oder aber, wenn er in das Zimmer der Nachbarin filmt, die auf ihn eine seltsame Faszination ausübt. Diese küsst etwas mit einem fremden Mann und verschwindet dann aus dem Zimmerausschnitt, den die Kadrierung des Fensters gewährt. Der Ton befindet sich dabei bei Holzman, dann das Geräusch einer Wählscheibe, monotones Tuten und plötzlich taucht wieder die Nachbarin am Fenster auf, die zum Hörer greift und deren Stimme dann ganz nahe bei uns ist. In solchen Momenten ist dieser Film in seiner Reduktion schlicht großartig, atemberaubend geradezu. Wie auch das unvermittelte Ende selbst: Zunächst eine verkratzte Phonoaufnahme der vertraut gewordenen Stimme. Man habe ihm seine Wohnung ausgeräumt, alles technische Gerät wurde ihm gestohlen, dieser Film ist aus, vorbei, Ende, er selbst steht vor dem Nichts und spreche gerade in einen Phonoautomaten, der für wenig Geld ein paar Minuten Mikroton in eine Vinylsingle ritzt. Es folgen Bilder aus dem Passfotoautomaten, darauf Holzman und die - soeben? - produzierte Single - oder eine ganz andere? - in der Hand. Raum und Ton sind endgültig disparat geworden: Die Wahrheit liegt allenfalls 24mal pro Sekunden zwischen zwei belichteten Frames.
Ein berauschendes Filmerlebnis. Obwohl der Film rein bildqualitativ nie die Ebene eines bisweilen ungelenk produzierten Hobbyfilms überschreitet, entwickelt er förmlich einen faszinierenden Sog, in dem sich zu verlieren die unangenehmste Sache nicht ist. Beinahe endlos schon scheinen die Anschlussmöglichkeiten, ist man gespannt, was Holzman als nächstes einfallen wird (denn: bei aller Beliebigkeit, die manche Einstellungen ausstrahlen, beliebig wird es wirklich nie), unentwegt kommen einem Filmtitel in den Sinn wie Blair Witch Projekt, Cannibal Holocaust, Mann beißt Hund, auch Spike Jonzes Adaptation etwa, die allesamt ihr Verhältnis als Film zur äußeren Wirklichkeit zum Primat ihrer Erzählung erheben. Und doch wirken diese Reflektionsversuche des Genrekinos nach einer retrospektiven Sichtung von David Holzman's Diary mitunter ungelenk, nur halb zuende gedacht. Die Vorführung dieses Films, wenn auch nur in einer mäßig besuchten Vormittagsvorstellung, gehört sicherlich zu den größten Verdiensten der diesjährigen Retrospektive, deren Veranstalter man hierfür nicht genug danken kann.
David Holzman wird im übrigen von L.M. Kit Carson gespielt, seine Freundin Penny, die im Verlauf dieses Experiments mit ihm Schluss macht, weil sie nicht länger gefilmt werden möchte, vor allem nicht nackt, heißt im echten Leben Eileen Dietz. Doch wer weiß schon, ob der Abspann nicht auch nur aus Lug und Trug besteht.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.
>> David Holzman's Diary (USA 1967)
>> Regie/Drehbuch: Jim McBride
>> Kamera: Michael Wadley
>> Darsteller: L.M. Kit Carson, Eileen Dietz, Lorenzo Mans, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?
Die Verwirrung am Abend ist perfekt: Die Kartenkontrolle für die abendliche Retrospektivevorführung im CinemaxX 8 findet, anders als sonst, bereits eine Etage tiefer statt, vor jener Treppe, die in den letzten Tagen hinauf hinab führte, in die Erinnerungen an das alte New Hollywood. Und dann auch noch, zugegeben recht freundliches Personal extra für Taschenkontrollen. Ob man denn Kameras mit sich führe, wird da gefragt, obwohl man es doch eigentlich eilig hat, denn Badlands fängt gleich an und der Andrang lässt bereits um einen guten Platz fürchten. Wie kommt es, dass eine öffentliche Vorführung eines an sich für Raubkopierer doch denkbar uninteressanten Films Sicherheitskontrollen unterworfen ist, die sonst nur Blockbustern in den Pressevorführungen zuteil werden? Sollte die bislang so entspannte wie unbedingt sehenswerte Retrospektive als Treffpunkt für Raubkopierer und Von-der-Leinwand-Abfilmer in Verruf geraten sein?Wie auch immer. Im Saal angekommen - vierte Reihe, Platz in der Mitte, die beste Position also, trotz allem - lässt man die Gedanken kreisen. Seitens des Personals des Filmmuseums und der Retrospektive herrscht auffällige Betriebsamkeit. Sieh an, der Herr Prinzler ist ja auch anwesend und der findet sich doch bekanntlich nur mit Prominenz im Schlepptau im Cinemaxx 8 ein. Ein Gedanke setzt sich fest, so eigentlich absurd, wie irgendwie auch schön, einer jener Sorte, die man gerne weiterspinnt, und als Herr Prinzler dann auch noch das Mikro zur Hand nimmt und - "Ladies and gentlemen, it's an honor for me..." - einen Überraschungsgast ankündigt, werden für einen Moment die Träume eines Cinephilen wahr: Terrence Malick selbst, seit Jahrzehnten als "Jerome Salinger des Films" verschrien, der veranlasste, dass in den Pressematerialien seines letzten, seines dritten Films in knapp 30 Jahren, Der schmale Grat, kein Bild seiner Person aufzutauchen habe, tritt da auf einmal zur Tür hinein, seine Gattin obendrein im Schlepptau. Frenetischer Applaus im Saal sogleich, nach einem Moment schon die ersten standing ovations, denen sich bald das gesamte Publikum anschließt. Etwas verschüchtert, aber sichtlich gerührt über diese Reverenz, spricht dieses Phantom des US-Independentkinos nach dem minutenlangen (!) Applaus ein paar Worte des Dankes ins Mikro und versichert uns seines Stolzes darüber, dass dieser Film, dessen Vollendung seinerzeit unentwegt auf der Kippe stand, in dieser Reihe gezeigt wird und obendrein die Aufmerksamkeit ausverkaufter Kinosäle genießt. Ein paar weitere Anekdoten zum Film folgen, es ist mucksmäuschenstill im Saal.
Ein großer Moment ist das, schnell wieder vergangen, sicher, und leider stand Malick nach dem Screening auch nicht für Fragen des Publikums zur Verfügung, aber immerhin: Ich habe Terrence Malick gesehen. Und wer kann das schon von sich behaupten? Dafür lasse ich mir gerne in die Taschen blicken.
 Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte.
Man kann und darf vor dieser Frau durchaus Angst haben, wenn sie am Ende von Monster, nach dem über sie verhängten Todesurteil, wankend aufsteht und den Richter anfährt, er solle in der Hölle schmoren, und gegen die Beamten um sie rempelt. Die berichterstattenden Medien - das denkt man sich bloß, gezeigt wird es nicht - werden diese Frau nach dieser Show vermutlich als Ungeheuer und Monster abstempeln. Uns fällt das etwas schwieriger: Wir kennen ihre Geschichte. Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren.
Monster ist ein Serialkillermovie, wenn auch kein unbedingt typisches, und diese pflegen - was sie mit Vorsicht zu genießen macht - auf wahren Begebenheiten zu basieren. Im vorliegenden Fall wäre das die Mordserie von Aileen Wournos (Charlize Theron) in den 80er Jahren. Diese soll, so der Film, bereits in frühesten Kindheitstagen den Traum gehegt haben, einmal Filmstar zu werden, wie wir zu Beginn in körnigen Super8-Aufnahmen erfahren. Dazu muss man entdeckt werden, wie sie weiß, und weil die Jungs aus der Nachbarschaft gerne ihre körperlichen Reize entdecken, entblößt sie für ein paar Bucks auch mal ihre Brüste. Ein paar Jahre später ist die naive, eigentlich sogar recht tumbe Aileen noch immer nicht entdeckt worden und pflegt ein eher armseliges Dasein als White-Trash-Prostituierte und Obdachlose. Als die süße Selby (Christina Ricci), die selbst als Lesbe unter puritanischen Eltern an ihrem Leben zu scheitern droht, sie am Tresen anspricht, reagiert sie zunächst renitent, von der "Dyke" eher abgestoßen. Man landet nach einer durchzechten Nacht dennoch im gleichen Bett, wenngleich zunächst ohne Folgen. Aus der zarten Freundschaft wird bald ein inniges, auch intimes Verhältnis. Der Gedanke, endlich als Schönheit, wenn auch nicht als Star entdeckt zu sein, beflügelt und beengt Aileen gleichermaßen: Sie lebt auf, wie sie gleichzeitig auch Selby bis an Selbstaufopferung grenzend verfällt. Eine Ökonomie entwickelt sich, in der Aileen, jeglicher Souveränität verlustig, nach einer brutalen Vergewaltigung durch einen Freier sich zur Killerin entwickelt, die für ein paar Dollar jeden niederschießt, um das Glück der beiden - Selby ist mittlerweile von zuhause abgehauen - auch weiterhin zu finanzieren. Patty Jenkins hat ihr Debut als Regisseurin sehr einfühlsam gestaltet, nicht ohne dabei gelegentlich auch ein wenig über das Ziel hinaus zu schießen. Sehr bemerkenswert ist die fehlende psychopathologische Ebene des Films, die in Filmen mit vergleichbaren Sujets oft den Primat der Erzählung darstellt: Wenngleich eine Misshandlung der Killerin im Kindesalter zwar an einer Stelle erwähnt wird, wird diese Karte dankenswerterweise nicht ausgespielt. Auch andere archäologische Betätigungen in Wournos' Biografie finden nicht statt: Zu keinem Zeitpunkt des Films steht außer Zweifel, dass die Taten der Protagonistin - zumindest jene, die nicht, wie der Rachemord in Folge der Vergewaltigung, affektbedingt sind - nicht nur Folge sozialer und ökonomischer Bedingungen sind, sondern auch - aus Aileens Perspektive, die wir stets teilen - zumindest graduell Ergebnisse eines wach geführten Entscheidungsprozesses sind, ohne dabei die Rolle der vielfältigen Determinationen zu deminuieren. Weder ist sie das unsagbar Böse, wie es klassische Horrorfilme, deren Erbe mituter die Serialkillerfilme dereinst antraten, oft formulieren, noch ist sie Ergebnis eines verknappten vulgär-psychoanalytischen Allgemeinplatzes, die in ähnlichen Filmen oft so unsagbar nerven. Doch, man kann - bei aller Distanz, die man zu diesem ruppigen, unartikulierten Wesen auch verspüren kann - durchaus nachempfinden, warum der Mensch zumindest dieser filmischen Narration so gehandelt hat, ohne das Gefühl zu haben, über Gebühr vom Film überwältigt versucht zu werden. In seiner minutiösen Nachzeichnung der Ereignisse der letzten Tage vor Aileens Festnahme, entwickelt der Film bisweilen eine sensible Qualität, die für das Genre (insofern man Monster diesem wirklich zurechnen möchte) eher ungewöhnlich ist.
Was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass Monster nicht doch auch mit einigen Problemen zu kämpfen hat, die ihm nicht selten das Genick zu brechen drohen. Zum einen wäre da die Musik, die mitunter etwas penetrant eingesetzt und mit zweifelhaftem Geschick ausgewählt wurde: Vor allem jene Sequenzen, die von der ungeheuer aufgelösten, inneren Welt der Protagonistin erzählen, werden hier bisweilen auf auditiver Ebene schon fast wieder in ihrer Wirkkraft kastriert. Zum anderen wäre da eine über weite Strecken bestenfalls hausbackene, eigentlich sträflich anachronistische Art der Inszenierung,, die zwar sichtlich Nähe und Authentizität suggerieren will, dabei aber oft genug in der Sackgasse der Fernsehfilmästhetik versandet. Dies mag, gerade zu Beginn, als vor allem die Liebesgeschichte zwischen Aileen und Selby im Vordergrund der Erzählung steht, auch künstlerisch Sinn machen, wenn man sich gelegentlich auch rein äußerlich klassischen 80ies-Liebesfilmen annähert: Es macht Sinn, die glücklichen Momente eines eher schlichten Menschen, der derart seinen naiven Träumen verhaftet scheint, auf ästhetischer Ebene den Traumbildern jener Zeit anzugleichen. Auf lange Sicht geht diese Rechnung allerdings nicht auf: Der Film plätschert eher gemächlich vor sich hin, ohne dass der Zuschauer durch diese reduzierte Inszenierung tiefer in das Geschehen eingebunden wäre.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Wettbewerb.
>> Monster (USA 2003)
>> Regie/Drehbuch: Patty Jenkins
>> Darsteller: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen.
Cormans Wild Angels ist, wie kaum anders zu erwarten, ein waschechtes Exploitation-Movie, nach allen Regeln der Kunst. Strukturell nimmt dieser Bikerfilm (womit wesentliches an und für sich bereits gesagt wäre) bereits den nur wenige Jahre später (auf breiter Ebene wahrnehmbaren) Pornofilm vorweg: Die Handlung ist allenfalls sekundär, zumindest aber in so geringem Maße vorhanden, dass die Spielfilmlänge unter diesem Gesichtspunkt kaum berechtigt scheint. Sie dient allenfalls als Stichwortgeber für mal endlos lange und langweilige, mal endlos amüsante, spekulative Sequenzen, schnell und nur des billigen Effekts wegen runtergekurbelt: Minutenlang fährt man auf der Harley durch zerklüftete Landschaften, genüsslich lang inszenierte Schlägereien finden statt, wo es sich gerade anbietet und wenn sie sich nicht anbieten, wird eben irgendein Grund, bzw. Anlass erfunden. Knallige Setdesigns - wie etwa bizarre, mit allerlei Nazi-Memorabilia eingerichtete Kneipen und dergleichen mehr - werden einzig und allein des Knalligseins wegen ins Bild geholt und fungieren nicht notgedrungen sinnstiftend als Kulisse für die Narration. Kein Zweifel: Mit diesem Film wird exemplarisch in der Berlinale-Retrospektive "New Hollywood" jene oft unterschlagene Traditionslinie des Kinos gewürdigt, die unter hehren Cineasten bestenfalls Naserümpfen hervorruft. Ein diebisch unmoralisches Vergnügen bisweilen, dem nicht selten sinnentleerten Treiben auf der großen Leinwand zuzusehen.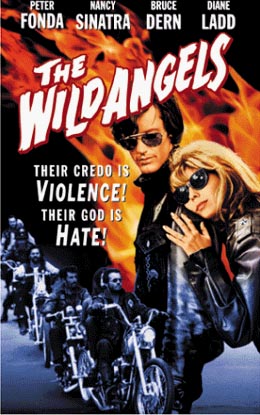 Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.
Wild Angels entstand 1966, gewissermaßen in einer Zwischenphase, was allzu freie Darstellungen von Gewalt angeht und das merkt man ihm sichtlich an: Seine zahlreichen Gewaltszenen stehen noch eindeutig in jener naiven, beinahe schon unschuldigen Tradition, die Hershell Gordon Lewis, Professor für englische Literatur, 3 Jahre zuvor mit seinem höchst amüsanten Blood Feast, gemeinhin als erster Gorefilm der Filmgeschichte bezeichnet, begründete und zugleich mit einer Schwemme ähnlich konzipierter Filmen fortführte. In Lewis' Werk fliegen, von monotonen Orgelsounds begleitet, mit Himbeersirup beschmierte Schaufensterpuppenarme durch die Luft, eindeutig als solche erkennbare Plastikmasken werden böse mit Frittieröl malträtiert und dergleichen mehr: Das an sich Widerwärtige in den Bildern bricht sich in der offen amüsierten bis unbeholfenen Darstellung, die, von den bestenfalls hölzernen Darbietungen der Mimen noch unterstützt, jede Ernsthaftigkeit aus dem Film treibt. Ganz ähnlich liegt der Fall in Wild Angels, der zwischen Hakenkreuzflaggen, Orgien unter Palmen und ruppigen Schlägerein sein exploitatives Spielchen treibt: Auch wenn in einer der Schlüsselszenen - das Begräbnis eines Gangmitglieds in einer Kirche schlägt nach nur wenigen Sekunden in eine wüste Party um, in der Pastoren geknebelt, Interieurs zerstört und Leichen pietätlos drapiert werden - eine Frau von mehreren Männern brutal vergewaltigt wird, kann man den Film, zumindest aber Peter Fondas Sonnenbrille, noch immer cool finden, ohne um seine Reputationen fürchten zu müssen. Erst zwei Jahre später würde George A. Romero Lewis' Vorlage bildästhetisch aufgreifen, drastische Gewalt auch drastisch, jenseits von Camp, in Night of the living Deadnachempfindbar gestalten und so der naiven Unschuld der bisherigen "Gewaltfilme", zumindest für die nächsten ca. 15 Jahre, ein Ende bereiten.Doch soll all der Ruch von Bahnhofskino und Dosenbier nicht davon ablenken, dass es durchaus auch ernste Untertöne in diesem Film gibt. Wenn "Loser" (Bruce Dern) zu Beginn, kurz bevor man einigen Hispanics ein paar auf die Zwölf geben wird, weil sie angeblich sein Bike gestohlen haben, ein Pferd an der Straße mit den Worten "Go now! You're free!" losbindet, dieses aber nicht so recht in Freiheit entfliehen will, ihm vielmehr sogar die nächsten Minuten auf Schritt und Tritt folgen wird, dann ist das, bei aller seltsam entrückten Komik, die dieser Moment ausstrahlt, auch als tragische Schlüsselszene zu verstehen. Nicht nur, weil das Pferd, wenn die Prügelei ihrem Höhepunkt entgegen sieht, scheut, damit die Polizei auf sich und das juristisch zu ahndende Vorgehen aufmerksam macht und eine Verfolgungsjagd in Gang setzt, an deren Ende Loser niedergeschossen am Boden liegen wird und dessen Begräbnis am Ende des Films auch das Ende von "Blues" (Peter Fonda) bedingt. Sie steht darüber hinaus auch symbolisch für den - paradoxerweise - eigentlich recht konservativen Nukleus des Films: Der Drang nach jener Freiheit, die an allen Ecken und Enden in diesem Film beschworen wird - nicht zuletzt als der Pastor in bereits angesprochener Begräbnissequenz kurz vor seiner Abreibung Blues darauf anspricht, was er denn eigentlich anfangen will, ist die Freiheit erst mal erreicht, worauf dieser verdächtig lange zögert und allenfalls leere Parolen als Antwort gibt -, stellt nicht viel mehr als eine diffuse Stoßrichtung dar, Rebellieren als Selbstzweck, ohne Ziel und Utopie. Gerade dieses Element begründet vielleicht erst die dem Dialog zwischen dem Pastoren und Blues folgende ausschweifende Festivität, die seinerzeit auch in Deutschland - "Unsere Jugend ist nicht so!" - ein empörtes Medienecho nach sich zog: In der überbordenden Groteske potenzieren sich alle Elemente jedweden rebellischen Habitus, die zuvor, eines nach dem anderen, minutiös und einzeln protokolliert, fast schon präsentiert wurden. Eine Rückkopplung quasi, die in ihrem steten signifyin' doch nur auf eine bedrückende Leere hinter dem dargebotenen Verhalten verweist: Dekadenz. Ein letztes Aufbegehren ist das, vor dem letzten, melancholischen Bild: Blues schaufelt schweigsam Erde in das Grab seines Freundes, auf der Tonspur von herannahenden Polizeisirenen begleitet, seine Gangfreunde hat er von dannen geschickt, als wüsste er, dass seine Zeit abgelaufen ist. Wenn die Kamera in einer Kranfahrt nach oben die Perspektive verschiebt und dem Bild emblematischen Charakter verleiht, könnte man fast meinen, er schaufelte sich da sein eigenes Grab.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.
>> The Wild Angels (USA 1966)
>> Regie: Roger Corman
>> Drehbuch: Charles B. Griffith
>> Darsteller: Peter Fonda, Nancy Sinatra, Bruce Dern, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Wie stellt man das Grauen eines repressiven Staates dar? Der Film zeigt die Arbeit der Wahrheitskommissionen in Südafrika, deren Aufgabe es Mitte der neunziger war, sich um die Offenlegung der Verbrechen des Apartheidregimes zu kümmern. Er tut dies aus der Perspektive von Langston Whitfield (Samuel L. Jackson), der für die Washington Post nach Südafrika reist, und sich dort mit der weißen, südafrikanischen Schriftstellerin Anna Malan anfreundet, die als Radioreporterin an den Hearings teilnimmt. Die Filmemacher, das Drehbuch stammt von der Südafrikanerin Ann Peacock, basierend auf einem Buch von Antji Krog, haben sich dafür entschieden, die Greuel des Regimes exemplarisch, anhand von Einzelschicksalen darzustellen. Die versöhnliche Botschaft, auf die der Film letztlich hinsauswill, ist dabei ein zutiefst humanistischer - es ist der Versuch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man mit der Vergangenheit, die über so viele Jahre lang eine scharfe Trennlinie durch eine Gesellschaft gezogen hat, klarkommen kann um einen gemeinsamen Neuanfang wagen zu können.
Wie stellt man das Grauen eines repressiven Staates dar? Der Film zeigt die Arbeit der Wahrheitskommissionen in Südafrika, deren Aufgabe es Mitte der neunziger war, sich um die Offenlegung der Verbrechen des Apartheidregimes zu kümmern. Er tut dies aus der Perspektive von Langston Whitfield (Samuel L. Jackson), der für die Washington Post nach Südafrika reist, und sich dort mit der weißen, südafrikanischen Schriftstellerin Anna Malan anfreundet, die als Radioreporterin an den Hearings teilnimmt. Die Filmemacher, das Drehbuch stammt von der Südafrikanerin Ann Peacock, basierend auf einem Buch von Antji Krog, haben sich dafür entschieden, die Greuel des Regimes exemplarisch, anhand von Einzelschicksalen darzustellen. Die versöhnliche Botschaft, auf die der Film letztlich hinsauswill, ist dabei ein zutiefst humanistischer - es ist der Versuch eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie man mit der Vergangenheit, die über so viele Jahre lang eine scharfe Trennlinie durch eine Gesellschaft gezogen hat, klarkommen kann um einen gemeinsamen Neuanfang wagen zu können. Das Fundament, auf dem diese mögliche Annäherung beruht, besteht in der Auseinandersetzung mit dem Schrecken. Boorman führt nun eine Französin (Julkiette Binoche) und einen US-Amerikaner (Samuel Jackson) und mit ihnen den Zuschauer durch eine ganze Reihe von exemplarischen Schicksalen, die vor dem Ausschuss verhandelt werden. So schrecklich diese Einzelschicksale auch sein mögen, so sehr sich die beiden Hauptdarsteller in den Halbtotalen auch Bemühen, in ihrem Spiel ihre Frustration, ihre Ohnmacht und ihre Empathie erfahrbar zu machen, so wenig wird davon dem Zuschauer vermittelt. Im Gegenteil: in den immer wiederkehrenden Schilderungen, mal ist es eine Frau, die den Tod ihres Sohns betrauert, mal ein Kind, dass seit dem Tod der Eltern die Sprache verlor, macht sich Langeweile breit - so furchtbar das klingen mag Und es ist der Film, der dafür die Verantwortung trägt. Das Buch und John Boorman bemühen sich zwar nach allen Kräften jede sich bietende Möglichkeit zu nutzen um die Geschichte aus dem lähmenden Fahrwasser wenig inspirierenden Betroffenheitskinos herauszuführen, doch es hilft alles nichts. Country of my Skull ist genau der Film geworden, den er vergeblich vorgibt vermeiden zu wollen. Die Entscheidung, in den Hauptrollen zwei internationale Stars zu besetzen um ihnen dann mit dem Einheimischen Menzi Ngubane in der Rolle des Dumi einen Sidekick zur Seite zu stellen, der mit seinem unumstößlichen Grundoptimismus für einen Großteil der spaßigeren Szenen verantwortlich zeichnet, hilft auch nicht gerade das bitter notwendige Grundvertrauen in die Geschichte zu untermauern. Eine Enttäuschung.
Thomas Reuthebuch
Country of my Skull
Großbritannien/Irland 2003
100 Minuten
Regie: John Boorman
Buch: Ann Peacock, nach einem Buch von Antije Krog
Darsteller: Juliette Binoche, Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson, Menzi Ngubane, Nick Boraine
imdb
alle Berlinale-Kritiken
 Die Welt ist aus den Angeln. Nicht nur die fast stets schräg gehaltene, aus verfremdenden Perspektiven filmende Kamera macht dies deutlich: Die Toten stehen aus den Gräbern auf, Gesetz und Moral existieren nicht mehr. Schwarze als Filmhelden, die sogar weiße Frauen schlagen dürfen. Wenngleich aus heutiger Perspektive gelegentlich naiv wirkend, so war dieser Film doch zur Zeit seiner Entstehung, mit Verlaub, ein Fickfinger in Richtung filmisches Establishment, ein Schlag in die Magengrube seiner Zuschauer. Was, wenn nicht diese Wirkmächtigkeit, prädestiniert gerade und besonders also diesen Film für die Retrospektive New Hollywood? Eben.
Die Welt ist aus den Angeln. Nicht nur die fast stets schräg gehaltene, aus verfremdenden Perspektiven filmende Kamera macht dies deutlich: Die Toten stehen aus den Gräbern auf, Gesetz und Moral existieren nicht mehr. Schwarze als Filmhelden, die sogar weiße Frauen schlagen dürfen. Wenngleich aus heutiger Perspektive gelegentlich naiv wirkend, so war dieser Film doch zur Zeit seiner Entstehung, mit Verlaub, ein Fickfinger in Richtung filmisches Establishment, ein Schlag in die Magengrube seiner Zuschauer. Was, wenn nicht diese Wirkmächtigkeit, prädestiniert gerade und besonders also diesen Film für die Retrospektive New Hollywood? Eben.
Und: Etwas von dieser Wirkmächtigkeit hat überlebt. Vergessen wir gelegentlich mangelnde Bild/Tonsynchronität, vergessen wir hölzern agierende Darsteller: Noch immer sind diese konstrastreichen Schwarzweißbilder beklemmend, bisweilen verstörend. Noch immer ist der Plot einer der fiesesten, in dem jedweder möglicher positiver Bezugspunkt verloren gegangen ist. Wenngleich Ben (Duane Jones) stets als Held, zumindest aber als Mann der Tat charakterisiert wird, bleiben sein Aktionismus und seine Argumentation letztendlich erfolglos: Ein großes Scheitern, ein galliges Scheitern, wenn man bedenkt, dass letztendlich der unsympathisch gezeichnete Redneck aus dem Keller (Karl Hardman) mit seinem Vorschlag, im Keller zu bleiben, vermutlich den besten des Films gemacht hat - wohlgemerkt: wir erfahren dies erst am Ende. Dann nämlich, wenn Ben selbst, als letzter der in der Hütte isolierten, stirbt. Nicht etwa infolge einer Auseinadersetzung mit einem lebenden Toten. Nein, ein Trupp Rednecks, das Gewehr locker gehalftert, hat ihn erlegt, einfach so, in den letzten Minuten: Er könnte ja einer von "diesen Dingern" sein. Die letzten Standbilder, zu karger Musik: Hinterwäldler, die den schwarzen Ben an Fleischerhaken aus dem Haus schleppen, ihn auf einem Scheiterhaufen drappieren, diesen entflammen. Grobkörnige Bilder, wie aus Zeitungen ausgeschnitten. Im Jahr 1968, als die Stimmung in Amerika brodelte, ein eindeutiges Statement, ein Zitat der alltäglichen Berichterstattung. Die Menschen, die das Land von den Zombies befreien, die Retter also, stehen ikonografisch in einer Tradition mit den Lynchmobs, die damals den Süden der USA zum Hexenkessel machten. Ein trauriges, pessimistisches, grimmiges Bild. Die Welt ist aus den Angeln.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin in der Retrospektive.
>> Die Nacht der lebenden Toten (Night of the living Dead, USA 1968)
>> Regie: George A. Romero
>> Drehbuch: George A. Romero/John Russo
>> Darsteller: Duane Jones, Judith O'Dea, Karl Hardman, Marilyn Eastman, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Es dauert gut eine Stunde bis Doyle (Gene Hackman) den von Fernando Rey gespielten französischen Drogenboß Alain Charnier in den Strassen Manhattans beschattet. Er folgt ihm bis in eine U-Bahn Station, um dort von ihm ausgetrickst zu werden. Diese Plansequenz ist ein Musterbeispiel für Friedkins Inszenierungsstil, den man wohl am ehesten als "Straight into your face" bezeichnen kann. Obwohl Friedkin sich immer wieder als frankophil bezeichnet hat, eine Haltung, die, wie manche behaupten, sich bis hin zur Obsession gesteigert hat und die schließlich in einer Heirat zu Jeanne Moreau mündete, outet er sich hier als amerikanischer Regisseur par excellence. Die Sequenz ist in ihrer Ökonomie atemberaubend, nichts ist überflüssig, alles notwendige im Bild. Doch damit nicht genug. Der Film nimmt Tempo auf, erreicht einen kaum zu übertreffenden Grad an Intensität und wird sich gute 30 Minuten lang keine Verschnaufpause gönnen. Erst wenn Doyle nach der vielleicht unglaublichsten Verfolgungssequenz der Kinogeschichte Charniers Hit Man stellt, fällt mit dem ohrenbetäubendem Todesschuß auch die Klappe für eine Demonstration in Sachen Filmhandwerk, die sich gewaschen hat.
Es dauert gut eine Stunde bis Doyle (Gene Hackman) den von Fernando Rey gespielten französischen Drogenboß Alain Charnier in den Strassen Manhattans beschattet. Er folgt ihm bis in eine U-Bahn Station, um dort von ihm ausgetrickst zu werden. Diese Plansequenz ist ein Musterbeispiel für Friedkins Inszenierungsstil, den man wohl am ehesten als "Straight into your face" bezeichnen kann. Obwohl Friedkin sich immer wieder als frankophil bezeichnet hat, eine Haltung, die, wie manche behaupten, sich bis hin zur Obsession gesteigert hat und die schließlich in einer Heirat zu Jeanne Moreau mündete, outet er sich hier als amerikanischer Regisseur par excellence. Die Sequenz ist in ihrer Ökonomie atemberaubend, nichts ist überflüssig, alles notwendige im Bild. Doch damit nicht genug. Der Film nimmt Tempo auf, erreicht einen kaum zu übertreffenden Grad an Intensität und wird sich gute 30 Minuten lang keine Verschnaufpause gönnen. Erst wenn Doyle nach der vielleicht unglaublichsten Verfolgungssequenz der Kinogeschichte Charniers Hit Man stellt, fällt mit dem ohrenbetäubendem Todesschuß auch die Klappe für eine Demonstration in Sachen Filmhandwerk, die sich gewaschen hat.  Ohne William Friedkin zu nahe treten zu wollen: die Art und Weise, wie er sich über sein eigenes Werk in der Vergangenheit geäußert hat, läßt den Schluß zu, dass exakt dieser Eindruck beabsichtigt war. Ich kenne keinen Film, der so sehr mit seinem eigenen überteigerten Selbstwertgefühl kokettiert und gleichzeitig jedes Versprechen einzulösen bereit ist. Man hat ganz schnell die Bilder vom selbstgefälligen Regisseur verdrängt, der überheblich seine Weisheiten zum Besten gibt. All das spielt beim Wiedersehen mit French Connection keine Rolle mehr. Man muss vor William Friedkin den Hut ziehen, ob seiner Meisterschaft im Umgang mit dem Material, man muss ihn lieben für sein Talent und noch vielmehr für seinen Mut, auch wenn die Unnachgiebigkeit im Bemühen um die bestmögliche Einstellung gefährlich nahe am Wahnsinn vorbeischrammt. Das Drehbuch von Ernest Tideman liefert knappe, in ihrer Präzision unvergessliche Dialoge, der vibrierende Score von Don Ellis konterkariert den stetig vorantreibenden Plot, jede Einstellung scheint unausweichlich der vorhergehenden folgen zu müssen, und am Ende findet Friedkin den perfekten Schluß. Doyle, längst jenseits von Gut und Böse, verliert sich in der Reduzierung auf sein Ziel in der Schwärze des Bildes. Es ertönt noch einmal ein Schuß, dann der Abspann.
Ohne William Friedkin zu nahe treten zu wollen: die Art und Weise, wie er sich über sein eigenes Werk in der Vergangenheit geäußert hat, läßt den Schluß zu, dass exakt dieser Eindruck beabsichtigt war. Ich kenne keinen Film, der so sehr mit seinem eigenen überteigerten Selbstwertgefühl kokettiert und gleichzeitig jedes Versprechen einzulösen bereit ist. Man hat ganz schnell die Bilder vom selbstgefälligen Regisseur verdrängt, der überheblich seine Weisheiten zum Besten gibt. All das spielt beim Wiedersehen mit French Connection keine Rolle mehr. Man muss vor William Friedkin den Hut ziehen, ob seiner Meisterschaft im Umgang mit dem Material, man muss ihn lieben für sein Talent und noch vielmehr für seinen Mut, auch wenn die Unnachgiebigkeit im Bemühen um die bestmögliche Einstellung gefährlich nahe am Wahnsinn vorbeischrammt. Das Drehbuch von Ernest Tideman liefert knappe, in ihrer Präzision unvergessliche Dialoge, der vibrierende Score von Don Ellis konterkariert den stetig vorantreibenden Plot, jede Einstellung scheint unausweichlich der vorhergehenden folgen zu müssen, und am Ende findet Friedkin den perfekten Schluß. Doyle, längst jenseits von Gut und Böse, verliert sich in der Reduzierung auf sein Ziel in der Schwärze des Bildes. Es ertönt noch einmal ein Schuß, dann der Abspann.
Thomas Reuthebuch
The French Connection
USA 1971
104 Minuten
Regie: William Friedkin
Buch: Ernest Tideman
Darsteller: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony LoBianco, Sonny Grosso, Eddie Egan
 Während nur wenige Türen weiter in ausgesuchten Kinosälen das New Hollywood und sein Aufbegehren gegen alte Studiosysteme, überkommene filmische Ausdrucksweisen und Denkschulen von vorgestern retrospektiv gefeiert wird, scheint sich in der us-amerikanischen Filmauswahl des diesjährigen Wettbewerbs ein penetranter Regress Bahn zu schlagen. Kein Zufall scheint es, dass die beiden bisherigen US-Filme jener Reihe mit einem sich auffällig gleichenden Bild enden: Die Konflikte sind befriedet, die Harmonie ist hergestellt, die restaurierte Familie - ein Keimzelle, man weiß das ja - findet sich am reich gedeckten Tisch ein und wonneproppiger Nachwuchs, den es in der Narration bislang nicht gegeben hat, springt auch schon durchs Bild, während Geiger geigen und Kameras in die Totale wechseln. Kein Zweifel: Hier wird eine neue, innere Harmonie ausgerufen, die sich, auch und gerade, weil in Something's Gotta Give mit Jack Nicholson eine Ikone des New Hollywood befriedet wird, förmlich mit der Retrospektive anzulegen scheint.
Während nur wenige Türen weiter in ausgesuchten Kinosälen das New Hollywood und sein Aufbegehren gegen alte Studiosysteme, überkommene filmische Ausdrucksweisen und Denkschulen von vorgestern retrospektiv gefeiert wird, scheint sich in der us-amerikanischen Filmauswahl des diesjährigen Wettbewerbs ein penetranter Regress Bahn zu schlagen. Kein Zufall scheint es, dass die beiden bisherigen US-Filme jener Reihe mit einem sich auffällig gleichenden Bild enden: Die Konflikte sind befriedet, die Harmonie ist hergestellt, die restaurierte Familie - ein Keimzelle, man weiß das ja - findet sich am reich gedeckten Tisch ein und wonneproppiger Nachwuchs, den es in der Narration bislang nicht gegeben hat, springt auch schon durchs Bild, während Geiger geigen und Kameras in die Totale wechseln. Kein Zweifel: Hier wird eine neue, innere Harmonie ausgerufen, die sich, auch und gerade, weil in Something's Gotta Give mit Jack Nicholson eine Ikone des New Hollywood befriedet wird, förmlich mit der Retrospektive anzulegen scheint. Bis zu dem beschriebenen Bild ist es ein langer, qualvoller Weg: Zu Beginn herrscht Rock'n'Roll, bzw. was davon übriggeblieben ist, zumindest aber ist Harry Sonborn jenseits der 60, Besitzer eines florierenden HipHop-Labels und vor allem besonders erfolgreich darin, junge Dinger abzuschleppen. In der Wohnung seines neuesten Aufrisses Marin (Amanda Peet) kommt schließlich, was kommen muss: Eine Herzattacke während des Vorspiels, von Marvin Gaye musikalisch unterlegt. Pikant obendrein, dass Marins zugeknöpfte Mutter Erica (Diana Keaton), eine angesehene Drehbuchautorin, und deren Schwester Zoe (selten so nebensächlich für einen Film: Frances McDormand) ebenfalls im Hause anwesend sind und sich dazu gezwungen sehen, den alternden Hengst ins Krankenhaus einzuliefern, um ihn später dann auch noch beherbergen müssen. Kleines Liebesgeplänkel mit dem Arzt Julian (Keanu Reeves), Annäherung Nicholson/Keaton, Nicholsons nackter Arsch und ebenso Keatons Titten, Sex zwischen Blutdruckmessgerät und Hornbrille. Konflikt, Keaton am Boden zerstört, dann eben Reeves, wenn Nicholson nicht will, Nicholson am Boden zerstört. Ein Drehbuch für ein Theaterstück als Rache an Nicholson, der ist beleidigt und noch mehr am Boden zerstört, am Ende dann Paris und Happy End wie oben erwähnt.
Bis zu dem beschriebenen Bild ist es ein langer, qualvoller Weg: Zu Beginn herrscht Rock'n'Roll, bzw. was davon übriggeblieben ist, zumindest aber ist Harry Sonborn jenseits der 60, Besitzer eines florierenden HipHop-Labels und vor allem besonders erfolgreich darin, junge Dinger abzuschleppen. In der Wohnung seines neuesten Aufrisses Marin (Amanda Peet) kommt schließlich, was kommen muss: Eine Herzattacke während des Vorspiels, von Marvin Gaye musikalisch unterlegt. Pikant obendrein, dass Marins zugeknöpfte Mutter Erica (Diana Keaton), eine angesehene Drehbuchautorin, und deren Schwester Zoe (selten so nebensächlich für einen Film: Frances McDormand) ebenfalls im Hause anwesend sind und sich dazu gezwungen sehen, den alternden Hengst ins Krankenhaus einzuliefern, um ihn später dann auch noch beherbergen müssen. Kleines Liebesgeplänkel mit dem Arzt Julian (Keanu Reeves), Annäherung Nicholson/Keaton, Nicholsons nackter Arsch und ebenso Keatons Titten, Sex zwischen Blutdruckmessgerät und Hornbrille. Konflikt, Keaton am Boden zerstört, dann eben Reeves, wenn Nicholson nicht will, Nicholson am Boden zerstört. Ein Drehbuch für ein Theaterstück als Rache an Nicholson, der ist beleidigt und noch mehr am Boden zerstört, am Ende dann Paris und Happy End wie oben erwähnt.Was für eine unerquickliche Anhäufung von Zoten, Peinlichkeiten und intellektuellen Fehlleistungen. Es geht, natürlich, um die an sich eh schon unnötige Domestizierung exaltierter Lebensentwürfe, wenn auch, um den Ruch des allzu Kleinbürgerlichen zu entgehen, im bildungsbürgerlichen Milieu angesiedelt. Natürlich darf aber auch die kulturell interessierte, still und heimlich etwas verhärmte Emanze in ihren späten 50ern noch etwas dazulernen, ihre Säfte, vor allem aber den Körper nämlich, indem er vom Lover - wie peinlich - mit der Schere aus dem Kokon der Rollkragenpullis herausgeschnitten wird. Dem folgt eine kleinkarierte Liebesfantasie vom stillen Glück zu zweit, im einsamen Strandhaus, bei Gewitter und Kerzenschein, die schmerzlich lange und sträflich unironisch ihr Spiel treiben darf. Und natürlich kann ein "old dog" nicht (so schnell) belehrt und in den Schoß der Familie zurückgeführt werden, deshalb wird sich an ihm auf die denkbar verknöchertste Art feministisch abgekämpft - soll er wenigstens im Theaterstück zum Schluss sterben -, bis er dann eben doch einlenkt und in Paris zum Charmeur heranreift. Ein in die Jahre gekommener, durch seine ideologischen Nachfolger selbst schon überholter Feminismus macht sich hier breit, der sich letztendlich doch nur als sturer Konservatismus mit etwas Kulturkolorit zu erkennen gibt - wie rundum und unsäglich langweilig. Nie war das alte New Hollywood wichtiger.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin außer Konkurrenz im Wettbewerb.
>> Was das Herz begehrt (Something's Gotta Give, USA 2003)
>> Regie/Drehbuch: Nancy Meyers
>> Darsteller: Jack Nicholson, Diana Keaton, Amanda Peet, Keanu Reeves, Frances McDormand, u.a.
imdb | mrqe | links@filmz.de
alle Berlinale-Kritiken
 Der Titel ist natürlich ein höhnischer Witz: Keineswegs wird hier ein Manifest ausgerufen, eher schon wird gekuckt, wie denn der Kapitalismus so funktioniert. Dazu zerlegt man ihn am besten in Einzelteile und nimmt die Position des äußeren Beobachters ein, zerlegt den Text, den auch dieses System darstellt, in Absätze, Sätze, Buchstaben. Obwohl Erzählung ein eigentlich noch besserer Begriff ist: Wie jede Ideologie verabsolutiert sich auch der Kapitalismus als große Erzählung mit unangreifbarer Konsistenz.
Der Titel ist natürlich ein höhnischer Witz: Keineswegs wird hier ein Manifest ausgerufen, eher schon wird gekuckt, wie denn der Kapitalismus so funktioniert. Dazu zerlegt man ihn am besten in Einzelteile und nimmt die Position des äußeren Beobachters ein, zerlegt den Text, den auch dieses System darstellt, in Absätze, Sätze, Buchstaben. Obwohl Erzählung ein eigentlich noch besserer Begriff ist: Wie jede Ideologie verabsolutiert sich auch der Kapitalismus als große Erzählung mit unangreifbarer Konsistenz.Um den Kapitalismus und was er mit Menschen macht filmisch zu ergründen, wäre eine Erzählung schon der erste fatale Fehlschritt, deswegen spielt sich Capitalist Manifesto vor allem, ganz nach den filmhistorischen Vorbildern, in der Montage und mise-en-scène ab. Zu Beginn ein kurzes Gespräch auf der Straße: Ein Junge wird von einer Frau angesprochen, bei ihr, bzw. ihrer Tochter, könne er ganz billig, bester Service, satisfaction guaranteed. Das Geschäft kommt zustande, man betritt das nächste Haus, zum Appartement, darin die Dienstleisterin. Als er das Zimmer betritt, ist es noch dunkel, also auch die Leinwand, dann macht er Licht - grell, für einen Moment -, die Kamera schwenkt und der Raum, das Erzählkino ist gebrochen: Eine Kartenrunde dreier Männer vor ihm, seine Vorgesetzten, wie sich herausstellt. Der Junge, er verkauft für die Kartenspieler Pornos auf der Straße, ist nicht verwundert, hat offenbar - und dann doch ein Schnitt - nie ein anderes Zimmer als das der Vorgesetzten betreten (wollen).
Dieser Bruch ist die Grundlage des folgenden, sehr klugen Films, der verabsolutierte Wahrheiten aufbricht und eine Perspektive ermöglicht, in der das eigentlich vertraute, alltägliche Bild - beispielsweise ein Laden von außen, eine Person tritt ein, etwas Geplänkel - seines mythischen Überbaus befreit und, nicht selten ohne Erfolg, der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Geld ist zudem kein Geld, man verteilt nur noch Rechnungen, trägt ominöse Plastiksparschweine mit sich, die ebenso getauscht werden, als wären sie Geld, feiert ein Fußballspiel im Fernsehen ab, der eigentlich doch kein Bild zeigt. Dazu bedienen sich die beiden Regisseure, die auch für den Schnitt verantwortlich zeichnen, des Mittels der Collage, der Gegenüberstellung, des konstruktiven wie analytischen Schnitts. Alltägliche Sätze - "Was kostet das?" - werden dem Kontext entrissen, Gespräche werden gestückelt, deren Elemente innerhalb von Raum und Zeit neu geordnet, sie selbst somit als inszeniert und auswendig aufgesagt denunziert.
Alles scheint sich zu wiederholen - endlos oft wird in das Zimmer der Prostituierten, der Vorgesetzten eingetreten -, doch immer gibt es auch leichte Abwandlungen, Verschiebungen ins Groteske. Dies dient nicht nur der Kenntlichmachung der Ritualisierung des Alltags, die im zunehmenden Verlauf mehr und mehr verstört, es imitiert auch die Stoßrichtung des Kapitalismus, der sich immer schneller, größer, besser (und somit eben also: grotesker) neu erfinden muss und sich dabei - das letzte der drei Kapitel titelt "Crisis" - notwendig selbst, in Folge steter Akkumulationen, zersetzt.
Ein trotz aller Sperrigkeiten ungemein spannender Film mit hohem Erkenntniswert. Umso bedauerlicher ist es da, dass die Klugheit der besten Momente durch den Abspann etwas konterkariert wird: "Thanks to Marx & Engels" steht da und "No thanks to Capitalism - I hate Capitalists!", während eine verzerrte E-Gitarre eine eigenwillige Interpretation der "Internationale" zum Besten gibt. Auch im Publikumsgespräch nach der Vorführung geben sich die beiden jungen Regisseure als Schlagwort-Kommunisten von altem Schrot und Korn zu erkennen. Dass der Kapitalismus der Weisheit letzter Schluss nicht ist, mag zwar Konsens sein, doch rechtfertigt dies noch nicht die Rückkehr in alte Reflexe und Rhetorik. Manchmal sollte man einen Film eben doch vor dem Abspann verlassen, um ihn als rundum gelungenen in Erinnerung behalten zu können.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im "Internationalen Forum des jungen Films".
>> Capitalist Manifesto: Working Men of All Countries, Accumulate! (Korea 2003)
>> Regie/Drehbuch/Schnitt: Kim Gok, Kim Sun
>> Darsteller: div.
 Gleich zu Beginn des Films, in der ersten Sequenz, wenn die fünf Outlaws verkleidet als Soldaten in ein Dorf einreiten, plaziert Peckingpah eine Szene, die in ihrer symbolistischen Metaphorik die weiteren Ereignisse des Films vorwegnimmt. Eine Gruppe Kinder hat sich neben den Eisenbahngleisen niedergelassen. Sie betrachten mit kindlich unverstellter Freude den Überlebenskampf von Skorpionen inmitten eines alles zersetzenden Ameisenheeres. Immer wieder werden Kinder oder harmlos wirkende junge Frauen die blutigen Masaker beobachten, später auch eingreifen. Wie vieles in The Wild Bunch verweisen diese Momente auf die aktuelle politische Situation Ende der sechziger Jahre, natürlich.
Gleich zu Beginn des Films, in der ersten Sequenz, wenn die fünf Outlaws verkleidet als Soldaten in ein Dorf einreiten, plaziert Peckingpah eine Szene, die in ihrer symbolistischen Metaphorik die weiteren Ereignisse des Films vorwegnimmt. Eine Gruppe Kinder hat sich neben den Eisenbahngleisen niedergelassen. Sie betrachten mit kindlich unverstellter Freude den Überlebenskampf von Skorpionen inmitten eines alles zersetzenden Ameisenheeres. Immer wieder werden Kinder oder harmlos wirkende junge Frauen die blutigen Masaker beobachten, später auch eingreifen. Wie vieles in The Wild Bunch verweisen diese Momente auf die aktuelle politische Situation Ende der sechziger Jahre, natürlich. Was den Film auch weit über 30 Jahre später als zeitloses Meisterwerk bestehen läßt, ist nicht die Radikalität des Blicks, den Peckingpah auf seine Figuren und ihre Umstände wirft. Es sind auch nicht die Gewaltexzesse, die in beinahe unvergleichlicher Weise speziell in den beiden den Film einrahmenden Masakern aus der Handlung herausbrechen. Sicher haben diese bis dahin mit ungekanntem ästhetischen Willen inszenierten Orgien ihre Spuren in den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Scorsese, Tarantino oder John Woo werden immer wieder gerne genannt. Alles richtig und dennoch: The Wild Bunch ist ganz nebenbei von einer künstlerischen Vision geprägt, die sich durch alle Departements hindurchzieht. Der Score von Jerry Fielding treibt die verbindenden Szenen unerbittlich voran, wenn sich die Geschichte eine Auszeit genommen hat und zum nächsten dramatischen Wendepunkt voranschreitet. Der Rhythmus, sowohl im Großen als auch in den Szenen selbst, unterstreicht das übergeordneten Prinzip des Films. Der Gewalt folgen ruhige, befriedete Momente, die bei Peckinpah einem Stillstand gleichkommen und lediglich einem Ziel dienen: dem erneuten Ausbruch von Gewalt. Wieder die Superlative: mit 3643 Schnitten stellte der Film einen neuen Rekord auf. Geschuldet ist dieses hohe Schnitttempo natürlich den in ausgiebiger Länge inszenierten Shoot-outs. Aber auch in den ruhigen Passagen entwickelt der Film eine hypnotische Sogkraft. Die Kameraarbeit von Lucien Ballard, mit ihren an Ford erinnernden Totalen und dann wieder der beklemmenden Reduzierung, die die Haltung des Films auf den Punkt bringt, wenn sie ihre Figuren nicht losläßt, und mit ihnen den Zuschauer.
Was den Film auch weit über 30 Jahre später als zeitloses Meisterwerk bestehen läßt, ist nicht die Radikalität des Blicks, den Peckingpah auf seine Figuren und ihre Umstände wirft. Es sind auch nicht die Gewaltexzesse, die in beinahe unvergleichlicher Weise speziell in den beiden den Film einrahmenden Masakern aus der Handlung herausbrechen. Sicher haben diese bis dahin mit ungekanntem ästhetischen Willen inszenierten Orgien ihre Spuren in den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Scorsese, Tarantino oder John Woo werden immer wieder gerne genannt. Alles richtig und dennoch: The Wild Bunch ist ganz nebenbei von einer künstlerischen Vision geprägt, die sich durch alle Departements hindurchzieht. Der Score von Jerry Fielding treibt die verbindenden Szenen unerbittlich voran, wenn sich die Geschichte eine Auszeit genommen hat und zum nächsten dramatischen Wendepunkt voranschreitet. Der Rhythmus, sowohl im Großen als auch in den Szenen selbst, unterstreicht das übergeordneten Prinzip des Films. Der Gewalt folgen ruhige, befriedete Momente, die bei Peckinpah einem Stillstand gleichkommen und lediglich einem Ziel dienen: dem erneuten Ausbruch von Gewalt. Wieder die Superlative: mit 3643 Schnitten stellte der Film einen neuen Rekord auf. Geschuldet ist dieses hohe Schnitttempo natürlich den in ausgiebiger Länge inszenierten Shoot-outs. Aber auch in den ruhigen Passagen entwickelt der Film eine hypnotische Sogkraft. Die Kameraarbeit von Lucien Ballard, mit ihren an Ford erinnernden Totalen und dann wieder der beklemmenden Reduzierung, die die Haltung des Films auf den Punkt bringt, wenn sie ihre Figuren nicht losläßt, und mit ihnen den Zuschauer.Es gibt so vieles an diesem Film, über das man ins Schwärmen geraten kann, doch die "brutale" Realität eines Filmfestivals, und dieser Vergleich sei mir in diesem Zusammenhang verziehen, beinhaltet eine unumstößliche Wahrheit. Der nächste Film wartet und die Zeit ist knapp.
Thomas Reuthebuch
 Dass Harvey Weinstein mit dem europäischen Kino aufgewachsen ist, gehört zu den vielen kleinen und großen Erzählungen, die sich um den stämmigen Produzenten aus New York ranken, die er selbst auch oft und gerne zum Besten gibt. So auch heute - wohl nicht ohne Kalkül, denkt man - auf der Pressekonferenz der Berlinale. In den Staaten herrsche blanke Diskriminierung, was europäisches Kino betrifft, wird da auf dem Podium gepoltert, seit 25 Jahren sei im US-Fernsehen kein Film dieser Herkunft zu sehen gewesen. Auch deshalb sei er stolz darauf, dass der von ihm produzierte Cold Mountain komplett in den Bergen von Rumänien entstanden ist, inszeniert von einem britischen Regisseur und mit vielen Europäern in tragenden Rollen. Dass der New Yorker Produzent darauf so insistiert, hat natürlich einen Hintergrund: In den USA gab es, wenngleich keinen Boykott, wie Weinstein kommuniziert wissen will, so doch Auseinandersetzungen, warum denn, auch in Hinblick der vielen Arbeitslosen in der Branche, gerade dieser Film, der doch vor allem auch von der Geschichte der USA handele, im Ausland entstanden sei. Und man meint in Weinsteins Auslassungen doch etwas Verbitterung herauszuhören, dass sein im Vorfeld der Oscarnominierungen am meisten gepushtes Baby dann doch nicht so gut wegkam, wie erhofft. Ausgesprochen wird er zwar nicht, doch der Vorwurf steht im Raum: Eine europäische Co-Produktion, wenn auch mit us-amerikanischem Geld finanziert, scheint für die Academy von vorneherein nicht relevant für die wichtigen Kategorien. Die Boxoffice indes zeigt sich solide: Trotz R-Rating aufgrund einiger drastischer Gewaltdarstellungen und etwas nackter Haut hält sich der Film an den Kassen recht passabel.
Dass Harvey Weinstein mit dem europäischen Kino aufgewachsen ist, gehört zu den vielen kleinen und großen Erzählungen, die sich um den stämmigen Produzenten aus New York ranken, die er selbst auch oft und gerne zum Besten gibt. So auch heute - wohl nicht ohne Kalkül, denkt man - auf der Pressekonferenz der Berlinale. In den Staaten herrsche blanke Diskriminierung, was europäisches Kino betrifft, wird da auf dem Podium gepoltert, seit 25 Jahren sei im US-Fernsehen kein Film dieser Herkunft zu sehen gewesen. Auch deshalb sei er stolz darauf, dass der von ihm produzierte Cold Mountain komplett in den Bergen von Rumänien entstanden ist, inszeniert von einem britischen Regisseur und mit vielen Europäern in tragenden Rollen. Dass der New Yorker Produzent darauf so insistiert, hat natürlich einen Hintergrund: In den USA gab es, wenngleich keinen Boykott, wie Weinstein kommuniziert wissen will, so doch Auseinandersetzungen, warum denn, auch in Hinblick der vielen Arbeitslosen in der Branche, gerade dieser Film, der doch vor allem auch von der Geschichte der USA handele, im Ausland entstanden sei. Und man meint in Weinsteins Auslassungen doch etwas Verbitterung herauszuhören, dass sein im Vorfeld der Oscarnominierungen am meisten gepushtes Baby dann doch nicht so gut wegkam, wie erhofft. Ausgesprochen wird er zwar nicht, doch der Vorwurf steht im Raum: Eine europäische Co-Produktion, wenn auch mit us-amerikanischem Geld finanziert, scheint für die Academy von vorneherein nicht relevant für die wichtigen Kategorien. Die Boxoffice indes zeigt sich solide: Trotz R-Rating aufgrund einiger drastischer Gewaltdarstellungen und etwas nackter Haut hält sich der Film an den Kassen recht passabel. Vielleicht aber ist die Academy Weinstein auch einfach nur nicht auf den Leim gegangen: Nur wenige Momente in diesem immerhin rund zweieinhalbstündigen Epos wirken nicht mit mehr als nur einem halben Auge auf entsprechende Nominierungen hinkalkuliert. Schon die Geschichte, eine Adaption eines Romans von Charles Frazier, deutet darauf hin: Weil Reverend Monroe (Donald Sutherland) es mit der Lunge hat, zieht er mit seiner naiven Tochter Ada (Nicole Kidman) vom Trubel in Charleston aufs Land, auf die kleine Farm Black Cove in dem beschaulichen Örtchen Cold Mountain/North Carolina. Dort lernt das schüchterne Wesen, vom Vater von allzu irdischen Dingen ferngehalten, den kernigen, aber wortkargen Inman (Jude Law) kennen, der Felder pflügt, Dächer deckt und anderes Handwerk verrichtet. Die unterschiedlichen Alltagsrealitäten erschweren zwar die Kommunikation, doch nähert man sich sachte an: Eine Liebesgeschichte wird das dennoch nicht, denn schon kommt der Bürgerkrieg übers Land und wie viele seiner Altersgenossen zieht auch Inman begeistert in den Krieg. Dies zumindest erfahren wir in zahlreichen Rückblenden zu Beginn, denn der Film setzt drei Jahre später ein, als die Südstaaten den Krieg bereits zu verlieren drohen. Ein vor dem Aufbruch hastig zugestecktes Buch, ein leidenschaftlicher Kuss auf der Veranda und sehnsüchtige Briefe aus Adas Feder geben Inman im Morast des Krieges Halt und veranlassen ihn schließlich, nach einer schweren Verletzung, sich nachts aus dem Lazarett zu stehlen, um, immer auf der Hut vor herumstreifenden Militärs, die den Auftrag haben, Deserteure umgehend hinzurichten, den beschwerlichen Weg zu Fuß zurück nach Cold Mountain, zurück zu Ada anzutreten. Auch dort hinterließ der Krieg bereits Spuren: Der runtergekommene Bauer Teague (Ray Winstone) hat das Gesetz in die Hand genommen und versucht mit hartem Terrorregiment, aus der Kriegssituation (Land-)Gewinn zu schlagen. Nach Reverend Monroes Tod liegt die Farm brach, Ada selbst ist, unfähig für das Nötigste zu sorgen, auf Almosen der Nachbarn angewiesen. Die burschikos und erdig auftretende Ruby (Renée Zellweger) wird ihr bald zur Seite gestellt, um gemeinsam das Gut wieder auf Vordermann zu bringen. Auch hier, parallel und ebenso episodisch wie Inmans "Long Walk Home" angelegt, kommt der Erinnerung an die flüchtige Begegnung mit dem liebgewonnenen anderen Menschen die Rolle des rettenden Strohhalms zu, die Hoffnung auf ein Wiedersehen wird zum letzten Halt.
Vielleicht aber ist die Academy Weinstein auch einfach nur nicht auf den Leim gegangen: Nur wenige Momente in diesem immerhin rund zweieinhalbstündigen Epos wirken nicht mit mehr als nur einem halben Auge auf entsprechende Nominierungen hinkalkuliert. Schon die Geschichte, eine Adaption eines Romans von Charles Frazier, deutet darauf hin: Weil Reverend Monroe (Donald Sutherland) es mit der Lunge hat, zieht er mit seiner naiven Tochter Ada (Nicole Kidman) vom Trubel in Charleston aufs Land, auf die kleine Farm Black Cove in dem beschaulichen Örtchen Cold Mountain/North Carolina. Dort lernt das schüchterne Wesen, vom Vater von allzu irdischen Dingen ferngehalten, den kernigen, aber wortkargen Inman (Jude Law) kennen, der Felder pflügt, Dächer deckt und anderes Handwerk verrichtet. Die unterschiedlichen Alltagsrealitäten erschweren zwar die Kommunikation, doch nähert man sich sachte an: Eine Liebesgeschichte wird das dennoch nicht, denn schon kommt der Bürgerkrieg übers Land und wie viele seiner Altersgenossen zieht auch Inman begeistert in den Krieg. Dies zumindest erfahren wir in zahlreichen Rückblenden zu Beginn, denn der Film setzt drei Jahre später ein, als die Südstaaten den Krieg bereits zu verlieren drohen. Ein vor dem Aufbruch hastig zugestecktes Buch, ein leidenschaftlicher Kuss auf der Veranda und sehnsüchtige Briefe aus Adas Feder geben Inman im Morast des Krieges Halt und veranlassen ihn schließlich, nach einer schweren Verletzung, sich nachts aus dem Lazarett zu stehlen, um, immer auf der Hut vor herumstreifenden Militärs, die den Auftrag haben, Deserteure umgehend hinzurichten, den beschwerlichen Weg zu Fuß zurück nach Cold Mountain, zurück zu Ada anzutreten. Auch dort hinterließ der Krieg bereits Spuren: Der runtergekommene Bauer Teague (Ray Winstone) hat das Gesetz in die Hand genommen und versucht mit hartem Terrorregiment, aus der Kriegssituation (Land-)Gewinn zu schlagen. Nach Reverend Monroes Tod liegt die Farm brach, Ada selbst ist, unfähig für das Nötigste zu sorgen, auf Almosen der Nachbarn angewiesen. Die burschikos und erdig auftretende Ruby (Renée Zellweger) wird ihr bald zur Seite gestellt, um gemeinsam das Gut wieder auf Vordermann zu bringen. Auch hier, parallel und ebenso episodisch wie Inmans "Long Walk Home" angelegt, kommt der Erinnerung an die flüchtige Begegnung mit dem liebgewonnenen anderen Menschen die Rolle des rettenden Strohhalms zu, die Hoffnung auf ein Wiedersehen wird zum letzten Halt.Große Gefühle, die vor historischer Kulisse so umgesetzt werden, wie man es, mitunter zähneknirschend, auch erwartet: Nachdenklich betrachtete Fotografien, nach dem verlorenen Gefecht ankokelnde Buchseiten in Großaufnahmen, dann wieder das weite, unberührte Land, durch das der verwundete, nicht wirkliche Held mit ernster Miene stapft, süßholzraspelnde Briefe, aus dem Off von Kidman vorgetragen, die so leer wie pathetisch sind, eine musikalische Untermalung, in der jede Nuance, jeder existenzielle Schmerz von Dutzenden von Geigern umgehend überkleistert wird. Zwar handwerklich routiniert in Szene gesetzt - vor allem die Kameraarbeit von John Seale und die hervorragende Arbeit der Ausstatter sind zu erwähnen - schafft der Film es vor allem aufgrund seines noch nicht mal mehr bloß vorhersehbaren Drehbuchs und einiger mitunter unfreiwillig komischer Dialogzeilen darin kaum, von mehr als nur seinem Bemühen nach großem Kino zu erzählen und verharrt entsprechend als kalkuliertes Kunsthandwerk. Auch gelegentliche Spitzen gegen die Sehgewohnheiten der anvisierten Klientel lassen keinen Zweifel daran, dass hier, wenngleich weitgehend erfolglos, großes Pathoskino inszeniert werden sollte: Besonders Inmans Reise im Veborgenen durchs Hinterland zeichnet den Menschen oft als des Menschen Wolf, wenn etwa verhungernde Soldaten im Morast Babies zur Geisel nehmen, deren Mütter vergewaltigen oder auf Deserteurjagd gehen.
 In solchen Momenten, wie auch zum Ende hin, als die blutige Auseinandersetzung zwischen Inman und Teague, auf die der Film unausweichlich zusteuert, endlich stattfinden darf, erinnert der Film - was vielleicht ja wirklich auch auf seinen europäischen Ursprung zurückzuführen ist - mitunter leicht an einige Vertreter des italienischen Westerns. Enzo G. Castellaris Keoma (Italien 1976) etwa erzählt eine in Auszügen ähnliche Geschichte, der Showdown vor schneeweißer Waldkulisse mit einer schwarzummantelnden Kidman lässt unweigerlich an Corbuccis Meisterwerk Leichen pflastern seinen Weg (Italien 1968) denken. Auch die zugrunde liegende Ideologie - der Zweifel des Einzelnen an Staatengebilde und ähnlichen Verbünde, eine Aussage, die Regisseur Minghella auf der Pressekonferenz mit Nachdruck unterstreicht - zielt in eine ähnliche Richtung. Ob man sich in diesen Momenten nun bewusst in solchen Traditionszusammenhänge verorten wollte oder nicht, sei dahingestellt. Fakt bleibt aber, dass der existenzielle Schmerz, von dem Cold Mountain vor allem in jenen Momenten zu erzählen versucht, schlicht nicht vermittelt wird, bzw. dort, wo ihn besagte Genrefilme künstlerisch glaubhaft umsetzten, in, böse gesagt, Heulsusenkino ausartet, vor allem wenn dem Bild noch die süßliche Streichermusik komplizenhaft zu Hilfe kommt. So verharrt der Film irgendwo zwischen großer Behauptung und geschäftsmännischem Kalkül und gibt sich so dergestalt allenfalls als Betrug am Zuschauer zu erkennen. Bleibt zu hoffen, dass diesem fadenscheinigen Eröffnungsfilm für den diesjährigen Wettbewerb, der bereits in den Ankündigungen eine mehr als offensichtliche, beinahe schon ausschließliche Tendenz zum sich besonders ernst und besorgt gebärdendem Kino nicht verhehlen kann, keine paradigmatische Rolle zufällt.
In solchen Momenten, wie auch zum Ende hin, als die blutige Auseinandersetzung zwischen Inman und Teague, auf die der Film unausweichlich zusteuert, endlich stattfinden darf, erinnert der Film - was vielleicht ja wirklich auch auf seinen europäischen Ursprung zurückzuführen ist - mitunter leicht an einige Vertreter des italienischen Westerns. Enzo G. Castellaris Keoma (Italien 1976) etwa erzählt eine in Auszügen ähnliche Geschichte, der Showdown vor schneeweißer Waldkulisse mit einer schwarzummantelnden Kidman lässt unweigerlich an Corbuccis Meisterwerk Leichen pflastern seinen Weg (Italien 1968) denken. Auch die zugrunde liegende Ideologie - der Zweifel des Einzelnen an Staatengebilde und ähnlichen Verbünde, eine Aussage, die Regisseur Minghella auf der Pressekonferenz mit Nachdruck unterstreicht - zielt in eine ähnliche Richtung. Ob man sich in diesen Momenten nun bewusst in solchen Traditionszusammenhänge verorten wollte oder nicht, sei dahingestellt. Fakt bleibt aber, dass der existenzielle Schmerz, von dem Cold Mountain vor allem in jenen Momenten zu erzählen versucht, schlicht nicht vermittelt wird, bzw. dort, wo ihn besagte Genrefilme künstlerisch glaubhaft umsetzten, in, böse gesagt, Heulsusenkino ausartet, vor allem wenn dem Bild noch die süßliche Streichermusik komplizenhaft zu Hilfe kommt. So verharrt der Film irgendwo zwischen großer Behauptung und geschäftsmännischem Kalkül und gibt sich so dergestalt allenfalls als Betrug am Zuschauer zu erkennen. Bleibt zu hoffen, dass diesem fadenscheinigen Eröffnungsfilm für den diesjährigen Wettbewerb, der bereits in den Ankündigungen eine mehr als offensichtliche, beinahe schon ausschließliche Tendenz zum sich besonders ernst und besorgt gebärdendem Kino nicht verhehlen kann, keine paradigmatische Rolle zufällt.Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin außer Konkurrenz im Wettbwerb.
>> Unterwegs nach Cold Mountain (Cold Mountain, USA 2003)
>> Regie/Drehbuch: Anthony Minghella
>> Darsteller: Nicole Kidman, Jude Law, Philipp Seymour Hoffman, Donald Sutherland, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Cold Mountain ist ein ausgesprochen cleveres Stück Mainstream Kino, und das ist mindestens zur Hälfte als Kompliment gemeint. Dabei geht der Film, inszeniert und gescriptet von Anthony Minghella, in der ersten halben Stunde ein beträchtliches Risiko ein. In der Exposition der Geschichte, die zwei Liebende inmitten der Wirren des amerikanischen Sezessionskrieges zeigt, gibt Minghella zunächst scheinbar alle Trümpfe aus der Hand, läßt die Erzählung zwischen den Zeitebenen hin und herschweben. Während wir bereits in der eindrucksvoll inszenierten und vor allem photografierten Eingangssequenz mit den blutigen Realitäten des Bürgerkriegs vertraut gemacht werden, führt uns Minghella immer wieder an die zaghafte Annäherung zwischen Ada (Nicole Kidman) und Inman (Jude Law) zurück. Schnell macht sich Langeweile breit. Zu klischeebeladen sind die Bilder, zu vorhersehbar die Dialoge, zu überdeutlich die ungelenken Drehbucheinfälle, die die beiden Zeitebenen miteinander verbinden. Das verleiht dem Film eine eigentümliche Leblosigkeit, gegen die Nicole Kidman mit aller Macht anspielt. In dieser ersten halben Stunde entwickelt der Film jedoch eine surreale Qualität, die ihn, möchte man eine solche Unterteilung vornehmen, durch den gesamten zweiten Akt tragen wird. Mitunter wirkt es, als bewege sich Ada in einem Stilleben.
Cold Mountain ist ein ausgesprochen cleveres Stück Mainstream Kino, und das ist mindestens zur Hälfte als Kompliment gemeint. Dabei geht der Film, inszeniert und gescriptet von Anthony Minghella, in der ersten halben Stunde ein beträchtliches Risiko ein. In der Exposition der Geschichte, die zwei Liebende inmitten der Wirren des amerikanischen Sezessionskrieges zeigt, gibt Minghella zunächst scheinbar alle Trümpfe aus der Hand, läßt die Erzählung zwischen den Zeitebenen hin und herschweben. Während wir bereits in der eindrucksvoll inszenierten und vor allem photografierten Eingangssequenz mit den blutigen Realitäten des Bürgerkriegs vertraut gemacht werden, führt uns Minghella immer wieder an die zaghafte Annäherung zwischen Ada (Nicole Kidman) und Inman (Jude Law) zurück. Schnell macht sich Langeweile breit. Zu klischeebeladen sind die Bilder, zu vorhersehbar die Dialoge, zu überdeutlich die ungelenken Drehbucheinfälle, die die beiden Zeitebenen miteinander verbinden. Das verleiht dem Film eine eigentümliche Leblosigkeit, gegen die Nicole Kidman mit aller Macht anspielt. In dieser ersten halben Stunde entwickelt der Film jedoch eine surreale Qualität, die ihn, möchte man eine solche Unterteilung vornehmen, durch den gesamten zweiten Akt tragen wird. Mitunter wirkt es, als bewege sich Ada in einem Stilleben.  Das Spannendste an Cold Mountain ist dann auch die Konsequenz, mit der Minghella diesen Inszenierungsstil gute zwei Stunden lang durchhält. Die Personen, auf die die beiden Protagonisten im Lauf der Geschichte treffen, sind als mythologische Figuren angelegt, entwickeln kaum ein Eigenleben, dienen lediglich als Reflexionsfläche. Wenn die Handlung ins Stocken zu geraten droht, kann man ganz beruhigt sein. Immer taucht im nächsten, im richtigen Moment die Lösung, der Ausweg auf. Irgendwann spielen die Dialoge keine Rolle mehr, werden sie Geräuschkulisse und findet der Film eine Einheit, die einen Moment lang auf Großes hoffen läßt. Am Ende wird dann leider doch ?nur? exekutiert (dramaturgisch betrachtet), wird der Wiedervereinigung ein finaler Showdown verpaßt, mit allem Drum und Dran.
Das Spannendste an Cold Mountain ist dann auch die Konsequenz, mit der Minghella diesen Inszenierungsstil gute zwei Stunden lang durchhält. Die Personen, auf die die beiden Protagonisten im Lauf der Geschichte treffen, sind als mythologische Figuren angelegt, entwickeln kaum ein Eigenleben, dienen lediglich als Reflexionsfläche. Wenn die Handlung ins Stocken zu geraten droht, kann man ganz beruhigt sein. Immer taucht im nächsten, im richtigen Moment die Lösung, der Ausweg auf. Irgendwann spielen die Dialoge keine Rolle mehr, werden sie Geräuschkulisse und findet der Film eine Einheit, die einen Moment lang auf Großes hoffen läßt. Am Ende wird dann leider doch ?nur? exekutiert (dramaturgisch betrachtet), wird der Wiedervereinigung ein finaler Showdown verpaßt, mit allem Drum und Dran. Cold Mountain ist sicherlich kein schlechter Film, vielleicht sogar Minghellas bester bislang. Für den großen Wurf jedoch hat es nicht gereicht.
Thomas Reuthebuch
Cold Mountain, USA 2003
155 Minuten
Regie/Buch: Anthony Minghella
Darsteller: Nicole Kidman, Jude Law, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman
 Badlands ist vor allem verwirrend, gleichzeitig hypnotisch und von rauher, unwirtlicher, karger Schönheit. Der Tod ist hier überall zugegen: Im einführenden Offkommentar von Holly wird vom Tod der Mutter erzählt, ein Hund liegt achtlos verwesend am Wegesrand, die Toten Kühe auf dem Feld der Schlachterei aufgedunsen in der Sonne. Wenig später ist dann auch Hollys Vater tot. Erschossen von ihrem Lover Kit, denn der Vater war gegen die Beziehung der beiden. Danach leben die beiden, gewissermaßen selbst wie die tiere, in der Wildnis, auch hier wieder dann das Töten, beiläufig, selbstverständlich. die 15jährige Holly betrachtet das ganze - den gewaltsamen Tod des Vaters, das Leben in der Wildnis, die anschließende Flucht über das Land - fast anteilnahmslos, scheint zu Gefühlsregungen kaum in der Lage. Sie stand vor der wahl: Outlaw oder nicht. Dann eben Outlaw. Alles, nur nicht durchschnittlich sein. Ein romantisches Motiv, zugegeben, doch denkbar unromantisch seine Umsetzung.
Badlands ist vor allem verwirrend, gleichzeitig hypnotisch und von rauher, unwirtlicher, karger Schönheit. Der Tod ist hier überall zugegen: Im einführenden Offkommentar von Holly wird vom Tod der Mutter erzählt, ein Hund liegt achtlos verwesend am Wegesrand, die Toten Kühe auf dem Feld der Schlachterei aufgedunsen in der Sonne. Wenig später ist dann auch Hollys Vater tot. Erschossen von ihrem Lover Kit, denn der Vater war gegen die Beziehung der beiden. Danach leben die beiden, gewissermaßen selbst wie die tiere, in der Wildnis, auch hier wieder dann das Töten, beiläufig, selbstverständlich. die 15jährige Holly betrachtet das ganze - den gewaltsamen Tod des Vaters, das Leben in der Wildnis, die anschließende Flucht über das Land - fast anteilnahmslos, scheint zu Gefühlsregungen kaum in der Lage. Sie stand vor der wahl: Outlaw oder nicht. Dann eben Outlaw. Alles, nur nicht durchschnittlich sein. Ein romantisches Motiv, zugegeben, doch denkbar unromantisch seine Umsetzung.  Von der leicht naiven Revolutionsromantik von nur wenig älteren Filmen wie Zabriskie Point oder Blutige Erdbeeren, die sich beide in ähnlichen Kontexten bewegen, ist nur sehr wenig geblieben, dort draußen in den badlands. Die Revolte verkommt zum bloßen Zeichen, etwas James-Dean-Habitus. Ansonsten nur die Weite des Landes, mitten drin, stets darin gefangen, die beiden Ausbrecher, die selbst nicht so recht wissen, warum und gegen was, für was sie eigentlich ausbrechen. Für die Liebe, möchte man das romantisch nennen, doch gleich zu Beginn wird die Romantik in ihre Schranken verwiesen: Die Hochzeitstorte von Hollys Eltern, über die Jahre tiefgeforen, schenkt der Vater, nach der Bestattung seiner Gattin, dem Totengräber, .
Von der leicht naiven Revolutionsromantik von nur wenig älteren Filmen wie Zabriskie Point oder Blutige Erdbeeren, die sich beide in ähnlichen Kontexten bewegen, ist nur sehr wenig geblieben, dort draußen in den badlands. Die Revolte verkommt zum bloßen Zeichen, etwas James-Dean-Habitus. Ansonsten nur die Weite des Landes, mitten drin, stets darin gefangen, die beiden Ausbrecher, die selbst nicht so recht wissen, warum und gegen was, für was sie eigentlich ausbrechen. Für die Liebe, möchte man das romantisch nennen, doch gleich zu Beginn wird die Romantik in ihre Schranken verwiesen: Die Hochzeitstorte von Hollys Eltern, über die Jahre tiefgeforen, schenkt der Vater, nach der Bestattung seiner Gattin, dem Totengräber, . Gefangen in den Konventionen also, der Ausbruch ist zum Scheitern verurteilt, wird als solcher ja eigentlich gar nicht mehr wirklich wahrgenommen, ganz im Gegenteil, Holly will bald schon zurück, hat "keine Lust" mehr. Wie es typisch für diese Art der us-amerikanischen Roadmovies ist sieht man auch hier oft weite, ebene Landschaftsflächen, in denen sich die Figuren bewegen, ein streng gezogener Horizont trennt Himmel von Erde. So sehr die Figuren auch mit der Welt ringen, die (exzellente) Kameraarbeit trägt Sorge dafür, dass diese Linie von den Protagonisten selten, kaum durchbrochen wird. Eine Annäherung bis auf wenige Millimeter im Bild, das ja, doch Gefangene ihrer Umgebung, der Umstände, dieses Landes bleiben sie dennoch.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Rahmen der Retrospektive.
>> Badlands (USA 1973)
>> Regie/Drehbuch: Terrence Malick
>> Darsteller: Martin Sheen, Sissy Spacek, u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Man hat sich noch nicht an Marseilles' Postkartenidylle sattgesehen, da gibt es auch schon den ersten Toten: Tiefrot spritzt ihm das eigene Blut ins Gesicht. Wie beiläufig - deswegen nur noch zynischer - bedient sich noch sein Mörder im Vorbeigehen an der Stange Weißbrot unter dem Arm des Erschossenen. Harter Schnitt auf die Straßen Brooklyns: Ein Weihnachtsmann an der Straßenecke, kleine Kinder rundherum, auch diese urbane Idylle ist nur von kurzer Dauer: Santa Clause ist eigentlich Detective "Popeye" Doyle (Gene Hackman), sein Kollege "Cloudy" Russo (Roy Scheider) nimmt gerade, nur wenige Schritte entfernt, im Alleingang eine Kneipe von Afro-Americans hoch, eine blutige Verfolgungsjagd ist die Folge. Doyle dreht durch, schlägt wie irr - noch immer in seiner Verkleidung, auch hier der Zynismus einer Brechung der Gewalt mit dem Grotesken - den jungen Schwarzen brutal zusammen, Tritte, Schreie, wüste Bedrohungen. Bei aller Desorientierung, die man als Zuschauer in diesen ersten Minuten durchlebt, ist das zynische Motto des Films bereits überdeutlich zu erkennen: Keine Gefangenen!
Man hat sich noch nicht an Marseilles' Postkartenidylle sattgesehen, da gibt es auch schon den ersten Toten: Tiefrot spritzt ihm das eigene Blut ins Gesicht. Wie beiläufig - deswegen nur noch zynischer - bedient sich noch sein Mörder im Vorbeigehen an der Stange Weißbrot unter dem Arm des Erschossenen. Harter Schnitt auf die Straßen Brooklyns: Ein Weihnachtsmann an der Straßenecke, kleine Kinder rundherum, auch diese urbane Idylle ist nur von kurzer Dauer: Santa Clause ist eigentlich Detective "Popeye" Doyle (Gene Hackman), sein Kollege "Cloudy" Russo (Roy Scheider) nimmt gerade, nur wenige Schritte entfernt, im Alleingang eine Kneipe von Afro-Americans hoch, eine blutige Verfolgungsjagd ist die Folge. Doyle dreht durch, schlägt wie irr - noch immer in seiner Verkleidung, auch hier der Zynismus einer Brechung der Gewalt mit dem Grotesken - den jungen Schwarzen brutal zusammen, Tritte, Schreie, wüste Bedrohungen. Bei aller Desorientierung, die man als Zuschauer in diesen ersten Minuten durchlebt, ist das zynische Motto des Films bereits überdeutlich zu erkennen: Keine Gefangenen!Die Spirale windet sich weiter: In Brooklyn geraten Doyle und Russo eher schon zufällig auf die Spur eines geplanten, internationalen Drogengeschäfts, in Marseille bereiten sich ein paar französische Bourgeois auf eine Reise vor, Ziel: New York. Dort umkreist man sich weiter: Ist man als unorthodoxer Ermittler zunächst der Jäger, ist man im nächsten Moment schon selbst Gejagter. Am Ende schließlich steht - nach allerlei Widrigkeiten und Rückschlägen, dann wenn die Schlinge sich zugezogen hat, wenn beide Linien in dieser Spirale der räumlichen Disparitäten und Beziehungen am Fixpunkt angekommen, untrennbar miteinander verschmolzen sind - ein existenzialistischer Showdown, wie ihn wohl wirklich nur der zornigste unter den "angry young men" des New American Cinemas der 70er Jahre, namentlich William Friedkin, inszenieren konnte: Verwirrend, verstörend, zutiefst verbittert.
 Friedkin zeichnet ein Bild der Auflösungserscheinungen innerhalb der Moderne: Alte Gewißheiten gibt es nicht mehr. Nicht etwa, wie ehedem, kriminologische Gewitztheiten und Kombinationsgeschick sind es, die die Handlung vorantreiben, allein Doyles aggressive Versessenheit und manischer Jagdtrieb sorgen für ein Vorankommen. Der nur widerstrebend von Oben bewilligte Sondereinsatz offenbart sich obendrein als Kakophonie des Scheiterns: Beschattungen werden nur unachtsam durchgeführt, man verliert den zu verfolgenden Wagen im New Yorker Straßendschungel, Doyle selbst lässt sich von dem Franzosen Charnier (Fernando Rey) in der New Yorker Metro als trottelig und tappsig vorführen.
Friedkin zeichnet ein Bild der Auflösungserscheinungen innerhalb der Moderne: Alte Gewißheiten gibt es nicht mehr. Nicht etwa, wie ehedem, kriminologische Gewitztheiten und Kombinationsgeschick sind es, die die Handlung vorantreiben, allein Doyles aggressive Versessenheit und manischer Jagdtrieb sorgen für ein Vorankommen. Der nur widerstrebend von Oben bewilligte Sondereinsatz offenbart sich obendrein als Kakophonie des Scheiterns: Beschattungen werden nur unachtsam durchgeführt, man verliert den zu verfolgenden Wagen im New Yorker Straßendschungel, Doyle selbst lässt sich von dem Franzosen Charnier (Fernando Rey) in der New Yorker Metro als trottelig und tappsig vorführen. Auch sind die beiden Ermittler keineswegs mehr Vorbilder, keine Sinnbilder mehr für Moral und Ordnung, wie dies, genealogisch gesehen, ihre Filmvorgänger gewesen sein mögen. Nein, eher sind sie selbst schon eigentlich recht zwielichtige Gestalten: Doyle profiliert sich durch latenten Rassismus, erscheint in seinem Jähzorn als unbändig, in seinem Jagdgebären zwangsneurotisch. Eine fast schon qualvoll lange Sequenz, das Ausschlachten eines verdächtigen Wagens, unterstreicht letztgenannten Aspekt besonders. Russo steht dem, wenn auch im Verlauf als etwas gesetzter inszeniert, in nichts nach: Unmöglich, sein Gebahren in seinem Auftritt - als einziger Weißer in einer Kneipe voller Schwarzer schlägt er um sich, erteilt harsche Befehle - vor dem Hintergrund der Entstehungszeit des Films, 1971, nicht als klare Charakterisierung zu verstehen. Obendrein scheint den Beiden die Beschattung der Verdächtigen ein Spiel mit dem Nervenkitzel zu sein, nicht etwa eine Angelegenheit der Moral (unnötig eigentlich auch zu erwähnen, dass das Element der Droge lediglich als McGuffin dient, die Folgen des Heroinkonsums und seine Opfer indes nicht mal erwähnt, geschweige denn gezeigt werden): Während des Telefonabhörens betrinkt man sich mit Dosenbier, ein sich als heiße Spur entpuppendes Gespräch dient zum Anlass für einen ausgelassen Tanz durchs Zimmer. Nein, mit diesen beiden Personen kann man sich als Zuschauer nur schwer identifizieren, als positive Helden gar sind beide nicht zu gebrauchen. Eine für den klassischen Hollywoodfilm obligatorische Hetero-Liebesbeziehung wird als Konnotationsmöglichkeit des "Guten" sogar vollkommen außen vor gelassen: Wer sollte sich auf diese auch einlassen? Einen Helden als solchen gibt es in Friedkins "New York von unten" nicht, wie könnte dieser Moloch einen solchen auch hervorbringen? Auch die "Gegenseite" bietet, wie dies nicht wenige andere Filme ja vorschlagen, kaum bis keine Möglichkeit zur Solidarität, wenngleich sie doch, gegenüber den beiden Polizisten, auffällig als zivilisiert und kultiviert in Szene gesetzt wird. Doch wer steckt hinter diesem Gewand? Opportunisten, skrupellose Killer, Heroinschmuggler und als graue Eminenzen kaltblütige Geschäftewitterer, die sich selbst die Hände nicht schmutzig machen wollen.
Wie kaum ein zweiter ist French Connection auch ein Film des Raums, der Beziehungen zueinander im Raum. Herrschen zu Beginn noch räumliche Disparitäten, die der gesamte Atlantik zu füllen weiß, endet der Film in seiner spiralenförmigen Annäherung der Beziehungspunkte konsequenterweise auf engstem Raume, in einem kleinen Kellergewölbe. Dem stehen zahlreiche Beschattungen in den Straßen von New York voran, das nur wenig mit dem medial aufbereiteten Bild der Glamour-Metropole, wie wir es kennen, zu tun hat. Orientierung ist kaum möglich: Die Straßen erscheinen beliebig verwinkelt, Touristenattraktionen - wie sie etwa in Sydney Pollacks nur wenige Jahre später entstandenem Die 3 Tage des Condor (USA 1975), mit gutem Grund, gehäuft zu sehen sind - geraten nie in den Bildkader. Der Asphalt ist aufgerissen, die ganze Stadt scheint aus Seitengassen zu bestehen, aus Kanälen aufsteigender Dampf erschwert noch zusätzlich das Zurechtfinden. Sich in dieser Stadt zu verirren, das ist eigentlich aufgrund des Straßensystems kaum möglich - jeder Tourist wird dies wohl bestätigen. New York durch Friedkins Augen indes ist verwinkelt, verwirrend, ein Ort ohne Anhaltspunkte, kurzum: Ein Moloch! Lediglich der gelegentlich oberirdische Verlauf der Metro kann zur verlässlichen Orientierungsstütze herangezogen werden: Für Doyle gerinnt die Jagd anhand dieser Stadtunterteilung der Moderne in kleine, aufgereihte Knotenpünktchen zur existenziellen Erfahrung: Eine der großartigsten Szenen des Films, eine der besten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte!
Friedkins Film ist bitter, verweigert sich, vor allem in seinem so großartigen wie verstörendem Beschluß, dem Zuschauer: Leicht rezipierbares Erzählkino ist das gewiss nicht. Wie die meisten Filme aus Friedkins Werk handelt auch French Connection von den als dramatisch wahrgenommenen Auflösungserscheinungen an allen Enden der Moderne, vom Verlust der Verbindlichkeiten. Dies hat Friedkin mitunter den Ruf eines reaktionären Krypto-Faschisten eingebracht, das eine oder andere Interview mit dem Regisseur mag dieser Unterstellung sogar Gewicht verleihen. Seine Filme aber, zumindest seine großen Klassiker aus den 70er Jahren, sind nicht selten wahre Meisterwerke eines existenzialistischen, wütenden Kinos. French Connection ist hierfür, mehr noch vielleicht als sein bekannterer Der Exorzist (USA 1973), der beste Beweis.
Der Film läuft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Rahmen der Retrospektive.
>> French Connection (USA 1971)
>> Regie: William Friedkin
>> Drehbuch: Ernest Tidyman
>> Darsteller: Gene Hackmann, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco u.a.
imdb | mrqe
alle Berlinale-Kritiken
 Am 06. Februar wird Ulrich Gregor im Kino Arsenal dem Pianisten Willy Sommerfeld die Berlinale Kamera verleihen. Der 1904 geborene Sommerfeld kann auf eine fast 80jährige Karriere zurückblicken, in der die musikalische Begleitung von (Stumm-)Filmen von Beginn an eine zentrale Rolle spielt. Als er 1933 nach einer Weigerung, den Hitlergruß durchzuführen, aus seiner Position als Kapellmeister im Staatstheater Braunschweig entlassen wird, beginnt er als als Komponist, Dirigent, musikalischer Leiter, Hörspiel- und Dokumentarfilmvertoner, Theatermusikschreiber, Arrangeur und Musiktherapeut zu arbeiten. Seit den 1970er Jahren ist er als Stummfilmpianist tätig.
Am 06. Februar wird Ulrich Gregor im Kino Arsenal dem Pianisten Willy Sommerfeld die Berlinale Kamera verleihen. Der 1904 geborene Sommerfeld kann auf eine fast 80jährige Karriere zurückblicken, in der die musikalische Begleitung von (Stumm-)Filmen von Beginn an eine zentrale Rolle spielt. Als er 1933 nach einer Weigerung, den Hitlergruß durchzuführen, aus seiner Position als Kapellmeister im Staatstheater Braunschweig entlassen wird, beginnt er als als Komponist, Dirigent, musikalischer Leiter, Hörspiel- und Dokumentarfilmvertoner, Theatermusikschreiber, Arrangeur und Musiktherapeut zu arbeiten. Seit den 1970er Jahren ist er als Stummfilmpianist tätig.Mit der Berlinale Kamera zeichnen die Internationalen Filmfestspiele Berlin seit 1986 Filmpersönlichkeiten aus, denen sie sich besonders verbunden fühlen.
Da diese Karriere untrennbar mit der der Coen-Brüder (Joel | Ethan) verbunden ist - Joel Coen und Frances McDormand sind obendrein seit knapp 20 Jahren miteinander liiert - zeigt das Filmkunsthaus als Ergänzung auch in einer separaten Reihe "die schönsten Filme der Coen-Brüder". Termine hier.
 Anke Westphal portraitiert auf der Titelseite der Berliner Zeitung kurz und prägnant die diesjährige Jurypräsidentin der Berlinale, Frances McDormand (imdb), derweil sich am Postdamer Platz, wie heute vormittag zu beobachten war, die alljährlichen Schlangen in den Arkaden bilden. Im Kino International wirds nicht anders sein, ist anzunehmen. Und erste Vorführungen sind auch schon ausverkauft, wie gnadenlose schwarze Striche, so hektisch wie zielsicher gezogen, markieren.
Anke Westphal portraitiert auf der Titelseite der Berliner Zeitung kurz und prägnant die diesjährige Jurypräsidentin der Berlinale, Frances McDormand (imdb), derweil sich am Postdamer Platz, wie heute vormittag zu beobachten war, die alljährlichen Schlangen in den Arkaden bilden. Im Kino International wirds nicht anders sein, ist anzunehmen. Und erste Vorführungen sind auch schon ausverkauft, wie gnadenlose schwarze Striche, so hektisch wie zielsicher gezogen, markieren.Die Zeichen sind mehr als deutlich: Noch zwei Tage.
 Diese Einschätzung kann man Siegel glauben oder auch nicht. Eine kurze Suchanfrage bei Amazon zeichnet ein eher widersprüchliches Bild: Zumindest im deutschsprachigen Raum scheint gerade mal ein einziges Buch zu Peckinpahs Werk erschienen zu sein, in den 80er Jahren bereits und obendrein allenfalls noch antiquarisch beziehbar. Vor diesem Hintergrund ist es etwas schade, dass auch mit dieser Veröffentlichung die Gelegenheit zur theoretisch-analytischen Auseinandersetzung mit Peckinpahs Filmen versäumt wurde: Mike Siegel zeigt sich, als glühender Verehrer und jahrelanger Sammler von Memorabilia und Artefakten, vor allem an einer Nachzeichnung der Biografie des Regisseurs anhand seiner Filmografie interessiert. Kindheit und Jugend werden entsprechend kursorisch auf wenigen Seiten zusammengefasst, um anschließend auf mehreren hundert Seiten akribisch die ersten TV-Jahre und ersten Gehversuche im Bereich des Spielfilms zu dokumentieren. Zu diesem Zweck werden unzählige Hintergrundinformationen zur Entstehung der jeweiligen Arbeiten, Anekdoten vom Set, biografische Details wie auch Mutmaßungen zu Peckinpahs inneren Befindlichkeiten zu einem eher schon literarischem Text, dessen einzelne Kapitel sich streng an der Chronologie des filmischen Schaffens orientieren, verwoben. Zu den Filmen selbst finden sich kaum verbindliche Aussagen, die über bloße Angaben zum Inhalt hinausgehen.
Diese Einschätzung kann man Siegel glauben oder auch nicht. Eine kurze Suchanfrage bei Amazon zeichnet ein eher widersprüchliches Bild: Zumindest im deutschsprachigen Raum scheint gerade mal ein einziges Buch zu Peckinpahs Werk erschienen zu sein, in den 80er Jahren bereits und obendrein allenfalls noch antiquarisch beziehbar. Vor diesem Hintergrund ist es etwas schade, dass auch mit dieser Veröffentlichung die Gelegenheit zur theoretisch-analytischen Auseinandersetzung mit Peckinpahs Filmen versäumt wurde: Mike Siegel zeigt sich, als glühender Verehrer und jahrelanger Sammler von Memorabilia und Artefakten, vor allem an einer Nachzeichnung der Biografie des Regisseurs anhand seiner Filmografie interessiert. Kindheit und Jugend werden entsprechend kursorisch auf wenigen Seiten zusammengefasst, um anschließend auf mehreren hundert Seiten akribisch die ersten TV-Jahre und ersten Gehversuche im Bereich des Spielfilms zu dokumentieren. Zu diesem Zweck werden unzählige Hintergrundinformationen zur Entstehung der jeweiligen Arbeiten, Anekdoten vom Set, biografische Details wie auch Mutmaßungen zu Peckinpahs inneren Befindlichkeiten zu einem eher schon literarischem Text, dessen einzelne Kapitel sich streng an der Chronologie des filmischen Schaffens orientieren, verwoben. Zu den Filmen selbst finden sich kaum verbindliche Aussagen, die über bloße Angaben zum Inhalt hinausgehen.Eine solche Textsorte birgt durchaus ihre Gefahren, zumal bereits Biografien über Peckinpah existieren. Doch Siegel schlägt daraus einen Vorteil, indem er sich ausdrücklich auf diese beiden Texte bezieht, bzw. sie miteinander abgleicht und, was der eigentliche Reiz ist, seine zahlreichen, wie es scheint recht freundschaftlichen, Beziehungen zu Hinterbliebenen und Freunden Peckinpahs nutzt, um die bisherige Quelllage zusammenzufassen und dieser neue biografische Erkenntnisse hinzuzufügen. Des weiteren kompiliert dieser nicht zu Unrecht "... in Pictures" untertitelte Band zahlreiche Fotografien - zum größten Teil äußerst rares, wenn nicht sogar bislang unveröffentlichtes Material - in beeindruckender Qualität. Darin offenbart sich schließlich die wahre Qualität dieser Publikation, die eine Materialsammlung von unschätzbarem, archivarischem Wert darstellt. Dies unterstreicht noch ein dem Text angefügter Appendix, der auf fast 100 Seiten qualitativ hochwertige, farbige Reproduktionen von internationalem Artwork zu Peckinpahs Filmen versammelt, darunter etwa auch so exotisches wie interessantes Material aus unter anderem Thailand, der Türkei oder Japan. Eine außergewöhnliche, schöne Zusammenstellung, in der man sich beim Schmökern regelrecht stundelang verlieren kann. Als einzigen Malus lassen sich vielleicht, wenn auch nur am Rande, die bisweilen etwas bemüht private Nähe suggerierenden Bildunterschriften festhalten, die das Gezeigte, ganz nach Familienfotoalbumtradition, gelegentlich auch mit ironischen Kommentaren oder Mutmaßungen über innere Prozesse der Fotografierten zu bereichern versuchen, wo doch das Bild schon für sich alleine steht.
Mike Siegels Illustration von Peckinpahs Biografie ist, allen Bedenken gegenüber der Methode zum Trotz, ein schönes Buch geworden, eher zum entspannten darin Blättern geeignet als für tiefergehende Studien am ästhetischen Material selbst. Der Lücke, die dahingehend in der Filmpublizistik noch immer besteht, ist man sich zwar auch weiterhin schmerzlich bewusst, doch könnte ein Publikation wie die hier vorliegende auch zu einer erneuten Beschäftigung mit Peckinpahs filmischem Werk, mit hoffentlich entsprechendem Ergebnis, einladen oder aber die Blicke überhaupt wieder auf diese Filmografie lenken. Wünschenswert wäre dies allemal.
>> Mike Siegel: Passion & Poetry. Sam Peckinpah in Pictures (Mitarbeit Ulrich Bruckner)
>> 480 Seiten, etwa 900 Abbildungen, davon ca. 400 in Farbe.
>> Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003
>> Premium Paperback auf Kunstdruckpapier, 16,5 x 23,5 cm
>> 29,90 EUR (D) / 50,50 sFr
>> ISBN 3-89602-472-8
 Und zwar hier als pdf-Download (ca. 640 KB).
Und zwar hier als pdf-Download (ca. 640 KB). Interessant im übrigen für alle Filmenthusiasten, die es dieses Jahr nicht nach Berlin schaffen: Erstmals werden die wichtigsten Events rund um das Filmfest auch online live streambar sein. Dies betrifft alle Pressekonferenzen und Galaempfänge. Desweiteren werden die Dateien auch in verschiedenen Sprachversionen auf der Website archiviert und können auch später und nach der Berlinale abgerufen werden. Hier der direkte Link zu dem (verständlicherweise) noch leeren Videoarchiv. Eine schöne Sache, will ich meinen.
Ansonsten geht es dann am Donnerstag richtig los: Mit Cold Mountain läuft dann der erste Wettbewerbsfilm. Eine Kritik dazu im Laufe des Tages dann natürlich auch hier in der die letzten Tage etwas vernachlässigten Berichterstattung.
Mögen die Spiele beginnen!
[via angelaufen.de]
 Menschen in der Krise: Nachdem die junge Sui Wai (Cecilia Cheung) ihren älteren Verlobten, einen Busfahrer, durch einen Verkehrsunfall während der Arbeit verloren hat, ist sie bemüht, ihr Leben und das seines Sohnes aus erster Ehe Lok Lok in den Griff zu kriegen. Zu diesem Zwecke lässt sie den beschädigten Bus ihres Verlobten reparieren (freilich aber auch aus romantischen Gründen: In diesem Bus fanden erste Annäherungen statt: Das Kennenlernen, das Sich-wieder-Begegnen und nicht zu letzt die Verlobung wie der Film sukzessive in verklärt ausgeleuchteten Rückblenden zu erkennen gibt) und heuert bei dem selben Busunternehmen als freie Mitarbeiterin an. Dies bringt viele Probleme mit sich: Sie ist dem Straßenverkehr nicht gewachsen, verdient zuwenig Geld, vernachlässigt den kleinen Jungen und droht, im männerbundähnlichen Busfahrermilieu aufgerieben zu werden. Zunächst noch aus der Ferne beobachtet Dai Fai (Lau Chin Wan) das junge Mächen, ein Kollege ihres Verlobten, der auch der erste an der Unfallstelle gewesen ist. Langsam führt er sie in das Gewerbe ein, steht ihr mit Tipps zur Seite, während die anderen Kollegen das unbeholfene Mädchen nur verspotten. Als er zunehmend auch von der desolaten Privatsituation von Sui Wai erfährt, die mit der Organisation ihres Alltags schlicht überfordert scheint, steht er ihr auch hier zur Seite und freundet sich mit dem kleinen Lok Lok an, der ihn bald als Vater anzusehen beginnt. Doch auch Dai Fai führt sein Leben nicht so souverän, wie seine große, gut eingerichtete Wohnung suggeriert: Erst spät erfahren wir Details aus seinem früheren Leben, die ihm das Engagement gegenüber Sui Wai zur Gewissensfrage machen.
Menschen in der Krise: Nachdem die junge Sui Wai (Cecilia Cheung) ihren älteren Verlobten, einen Busfahrer, durch einen Verkehrsunfall während der Arbeit verloren hat, ist sie bemüht, ihr Leben und das seines Sohnes aus erster Ehe Lok Lok in den Griff zu kriegen. Zu diesem Zwecke lässt sie den beschädigten Bus ihres Verlobten reparieren (freilich aber auch aus romantischen Gründen: In diesem Bus fanden erste Annäherungen statt: Das Kennenlernen, das Sich-wieder-Begegnen und nicht zu letzt die Verlobung wie der Film sukzessive in verklärt ausgeleuchteten Rückblenden zu erkennen gibt) und heuert bei dem selben Busunternehmen als freie Mitarbeiterin an. Dies bringt viele Probleme mit sich: Sie ist dem Straßenverkehr nicht gewachsen, verdient zuwenig Geld, vernachlässigt den kleinen Jungen und droht, im männerbundähnlichen Busfahrermilieu aufgerieben zu werden. Zunächst noch aus der Ferne beobachtet Dai Fai (Lau Chin Wan) das junge Mächen, ein Kollege ihres Verlobten, der auch der erste an der Unfallstelle gewesen ist. Langsam führt er sie in das Gewerbe ein, steht ihr mit Tipps zur Seite, während die anderen Kollegen das unbeholfene Mädchen nur verspotten. Als er zunehmend auch von der desolaten Privatsituation von Sui Wai erfährt, die mit der Organisation ihres Alltags schlicht überfordert scheint, steht er ihr auch hier zur Seite und freundet sich mit dem kleinen Lok Lok an, der ihn bald als Vater anzusehen beginnt. Doch auch Dai Fai führt sein Leben nicht so souverän, wie seine große, gut eingerichtete Wohnung suggeriert: Erst spät erfahren wir Details aus seinem früheren Leben, die ihm das Engagement gegenüber Sui Wai zur Gewissensfrage machen.Einen solchen Film kann man mit viel Schmalz und Sentiment anrühren, doch glücklicherweise ist Derek Yee Routinier genug, um genau in diese Fettnäpfchen nicht zu treten. Seine kleine Geschichte aus den Straßen Hongkongs ist weder rührselig noch pathetisch, sondern im besten Sinne der Wortes bodenständig und geradezu leicht, ohne dem herben Schicksalsschlag, den ein solcher Menschenverlust darstellt, die Dimension zu rauben. Zu diesem gehört nicht nur der anfängliche Schmerz, den Cecilia Cheung in einer ihrer bis dato wohl besten darstellerischen Leistungen prägnant vermittelt, ohne in simples overacting zu verfallen, dazu gehören auch die ersten Schritte des Darüberer-Hinwegkommens: In einem der schönsten Momente des Films gibt Dai Fai, ebenfalls ganz wunderbar von Lau Chin Wan dargestellt, dem Mädchen Busfahrer-Nachhilfeunterricht und zeigt ihr, wie man mit allerlei Spitzbübigkeit und laxer Auslegung der Verkehrsordnung den einen oder anderen Hongkong-Dollar mehr am Abend in der Kasse hat. Man lacht gerne mit, wenn Sui Wai in diesen Momenten das Lachen wiederlernt, und locker-leicht schlägt das Drama an dieser Stelle für eine befreiende Weile in eine kleine Komödie um, ohne dadurch aber die Balance zu verlieren.
Diese Sicherheit für den einzelnen Moment setzt sich fort, wenn zum Ende hin biografische Details aus Dai Fais Leben ins Zentrum des Films rücken und wir von seiner gescheiterten ersten Ehe erfahren. Die Frage, ob er Sui Wai aus reiner Nächstenliebe hilft oder ob er nicht nur einfach frühere Verfehlungen zu kompensieren versucht, ist eine unter diesen Voraussetzungen sehr einfühlsame, die zudem den Film auch davor bewahrt, zur lediglich banalen Liebesgeschichte zu werden. Denn eine Liebesgeschichte ist dieser Film durchaus auch: Keine rührselige gewiss, eine sehr reife, die von menschlicher Größe und auch menschlicher Schwäche erzählt ohne im Pathos zu versinken. Eine geglückte Gratwanderung.
Der Film lauft auf den 54. Internationalen Filmfestspielen Berlin im Rahmen des Panoramas.
>> Lost in Time (Mong bat liu; Hongkong 2003)
>> Regie: Derek Yee
>> Drehbuch: James Yuen
>> Darsteller: Cecilia Cheung, Lau Chin Wan, u.a.
imdb
alle Berlinale-Kritiken

