Thema: Filmtagebuch
08.11., Heimkino
 Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.
Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.
Ein Kino der Spektakel, im besten Sinne. Indem man zwei unterschiedlichen Franchises des Kung-Fu-Films - die fliegende Guillotine, eine groteske Waffe, wie den One-Armed Swordsman - kombiniert, schafft man, - nicht nur im Film, auch im Publikum, man kennt das ja - synergetische Effekte. Im Ergebnis brillantes Genrekino, allein die seltsame, aber dem Film gar nicht mal fremd bleibende Soundtrack-Kulisse - zu hören sind die B-Seite von Kraftwerks Autobahn, der eine oder andere Track von Neu und angeblich auch Tangerine Dream - irritiert zunächst.
Oder mit einem Wort: Großartig.
imdb | mrqe
 Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.
Spätestens wenn ein für die Narration eigentlich ganz offensichtlich nebensächliches Kung-Fu-Turnier denkbar lange mit immer wieder neuen Kämpfern mit abstrusen Styles und Skills präsentiert wird, macht sich bemerkbar, dass diesem Film die Spielhandlung lediglich als Perlenschnur für eine Aneinanderreihung technisch höchst gelungen inszenierter Kampfaustragungen dient. Und dies ist gar nicht negativ zu verstehen: Man entwickelt eine Poetik reiner Körperlichkeit, in der - wie ungewohnt für westliche Sehverhältnisse - Superhelden zwar übernatürliche Fähigkeiten besitzen - man läuft senkrechte Wände nach oben, fährt seine Arme aus, balanciert grotesk auf allem, was dafür nicht geschaffen ist -, die aber nie als solche und ihrem Ursprung nach thematisiert werden: Diesen finden sie, wie es scheint, in der Innerlichkeit der Agierenden.Ein Kino der Spektakel, im besten Sinne. Indem man zwei unterschiedlichen Franchises des Kung-Fu-Films - die fliegende Guillotine, eine groteske Waffe, wie den One-Armed Swordsman - kombiniert, schafft man, - nicht nur im Film, auch im Publikum, man kennt das ja - synergetische Effekte. Im Ergebnis brillantes Genrekino, allein die seltsame, aber dem Film gar nicht mal fremd bleibende Soundtrack-Kulisse - zu hören sind die B-Seite von Kraftwerks Autobahn, der eine oder andere Track von Neu und angeblich auch Tangerine Dream - irritiert zunächst.
Oder mit einem Wort: Großartig.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: ad personam
"Die Leidenschaft, die er auslöst - er muss sie ja nicht verstehen.".
Der Tagesspiegel durchlebt ein "High Noon beim Interview".
Wie auch immer: Morricone wird 75. Dazu herzlichen Glückwunsch!
Der Tagesspiegel durchlebt ein "High Noon beim Interview".
Wie auch immer: Morricone wird 75. Dazu herzlichen Glückwunsch!
° ° °
Thema: Kinokultur
10. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Filme sehen, ins Kino gehen - ein Spruch, der, angesichts des weitreichenden Kahlschlags hiesiger Kinokultur, nur blauäugig über die Lippen kommen kann. Wenngleich mittlerweile jährlich so viele Filme wie selten in den Jahrzehnten zuvor ins Kino kommen, so werden eben doch zahlreiche Filme auch teils namhafter Regisseure oft übergangen, vieles ist nur auf Festivals zu sehen, als DVD-Import beziehbar oder aber gerade mal mit geringer Kopienzahl in den Metropolen zu sehen.
Ein schmerzlicher Umstand, dem jump cut nun mit einer, wie ich finde, sehr schönen neuen Rubrik entgegen tritt: Der unsichtbare Film nennt sich nun dort eine Sektion, in der Filme, die man hierzulande unverzeihlicherweise selten oder gar nicht auf Leinwand zu Gesicht bekommt, ohne Rücksicht ans Tageslicht gezerrt werden. Regelmäßiges Vorbeischauen sei somit sehr empfohlen, damit man auch weiß, was man, warum auch immer, verpassen muss.
Vielleicht - man will's ja nicht beschreien - ändert sich auch durch eine solche Idee auch einfach mal was. Sei's nun bei den Verleihern oder auch beim Publikum.
Ein schmerzlicher Umstand, dem jump cut nun mit einer, wie ich finde, sehr schönen neuen Rubrik entgegen tritt: Der unsichtbare Film nennt sich nun dort eine Sektion, in der Filme, die man hierzulande unverzeihlicherweise selten oder gar nicht auf Leinwand zu Gesicht bekommt, ohne Rücksicht ans Tageslicht gezerrt werden. Regelmäßiges Vorbeischauen sei somit sehr empfohlen, damit man auch weiß, was man, warum auch immer, verpassen muss.
Vielleicht - man will's ja nicht beschreien - ändert sich auch durch eine solche Idee auch einfach mal was. Sei's nun bei den Verleihern oder auch beim Publikum.
° ° °
Thema: Berlinale 2004
06. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
 Noch drei Monate, dann steht der Potsdamer Platz zu Berlin wieder ganz unter dem Zeichen des internationalen Films. Im Berlinale-Büro gegenüber des Deutschen Filmhauses machen sich erste (aufregende) Regungen bemerkbar. So verkündete man jüngst, dass die Retrospektive des kommenden Filmfestivals ganz dem New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre gewidmet sei. Mit sage und schreibe 66 Filmen von u.a. Arthur Penn, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Terence Malick wird eines der spannendsten Kapitel der Filmgeschichte erneut auf der Leinwand zum Leben erweckt. Auf dem Bücherregal darf obendrein noch Platz gemacht werden: Der obligatorische Begleitband ist für den Berliner Bertz Verlag angekündigt. Der diesjährige Band zur Murnau-Retrospektive aus gleichem Hause lässt die freudige Erwartung bereits nach oben schnellen.
Noch drei Monate, dann steht der Potsdamer Platz zu Berlin wieder ganz unter dem Zeichen des internationalen Films. Im Berlinale-Büro gegenüber des Deutschen Filmhauses machen sich erste (aufregende) Regungen bemerkbar. So verkündete man jüngst, dass die Retrospektive des kommenden Filmfestivals ganz dem New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre gewidmet sei. Mit sage und schreibe 66 Filmen von u.a. Arthur Penn, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Terence Malick wird eines der spannendsten Kapitel der Filmgeschichte erneut auf der Leinwand zum Leben erweckt. Auf dem Bücherregal darf obendrein noch Platz gemacht werden: Der obligatorische Begleitband ist für den Berliner Bertz Verlag angekündigt. Der diesjährige Band zur Murnau-Retrospektive aus gleichem Hause lässt die freudige Erwartung bereits nach oben schnellen.Zum Berlinale 2004 Schwerpunkt.
° ° °
Thema: literatur
05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
D.I.Y., also "Do it yourself", ist nicht nur Parole und Glaubensbekenntnis ungezählter Flanellhemdträger mit Heimwerker-Ambitionen, es ist auch Kampfbegriff und identitätsstiftendes Moment jener Punk-Subkultur, die, jenseits von Kommerz und Major Labels, totale Kontrolle über das eigene Werk als Ideal formuliert. An Platten alleine hält sich das nicht auf: Selbstkopierte Fanzines, oft liebevoll mit Uhu und Schere gestaltet, ungewöhnliche Plattencover aus selbstbedrucktem Jutestoff oder gleich aus Pappe selbstgefaltet bis hin zum im Wohnzimmer veranstalteten Konzert sind die Markenzeichen jener Bewegung. Im Jahr 1978, dem Jahr als die erste große kommerzielle Punkwelle zusehends degenerierte (und somit letztendlich auch den ersten Nährboden für den folgenden Underground stellte), sollte auch ein zweites Großereignis der Geschichte der D.I.Y.-Kultur stattfinden, weitab von Punk und Jugendrebellion allerdings: Klaus Beyer, gelernter Kerzenwachszieher, bezieht in Kreuzberg eine Ein-Zimmer-Wohnung.
 Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.
Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.
Zu diesem Ereignis erschien im Martin Schmitz Verlag "Das System Klaus Beyer", in erster Linie eine Sammlung von Gesprächen von, wenn man so will, Fans und, zumindest entfernt, Geistesverwandter mit Klaus Beyer und seinem langjährigen Manager wie auch Herausgeber des Buches, Frank Behnke: Jörg Buttgereit, Christoph Schlingensief und der Journalist Detlef Kuhlbrodt stellten sich jeweils für ein "Kaffeekränzchengesprächen" (Verleger Schmitz) ein. Des weiteren finden sich Reproduktionen von Beyers handcolorierten Schwarzweißfotografien (darauf meist zu sehen: er selbst, wie sich überhaupt alles immer um die Person Beyer dreht) und selbstgemaltem und -gebasteltem Artwork, das auch vor kurzem in einer Ausstellung in Berlin zu sehen war, wie auch einige Texte aus Beyers akribisch geführtem Konzert-Tagebuch.
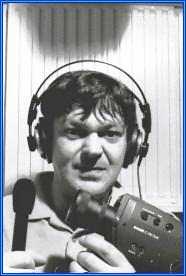 Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.
Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.
Eine kleine Welt tut sich beim Lesen auf, bestehend aus 70er Jahre Panorama-Tapeten, bemalten Bettlaken, Plattenspielern aus orangem Plastik und der naiven Gemütlichkeit von verschmitzt in Hosen steckenden Kragenhemden und Pantoffeln. Dies alles aber ohne den beißenden Zynismus des White Trash, ja selbst Trash ist, paradoxerweise, nur ein unzulänglicher Begriff für Klaus Beyers oft schon solipsistisch anmutende Arbeiten, die sich zwar aus ganz ähnlichen Quellen des 70er Jahre Universums speisen wie etwa die Retro-Filme Wenzel Storchs, von deren oft bemüht wirkendem Appeal aber weit entfernt sind. Mit dem Begriff vom "System Klaus Beyer" hat Schlingensief das Phänomen wohl in der Tat gelungen umrissen. Man muss Klaus Beyer einfach mögen, bzw. ernstnehmen.
>>> Frank Behnke (Hrsg) Das System Klaus Beyer
>>> Berlin: Martin Schmitz, 2003
>>> 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen
>>> 24,50 Euro
 Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.
Diese sollte sich in den folgenden Jahren zum Entstehungsort unzähliger Kleinkunstwerke gerieren, darunter Dutzende Super8-Videos, denen die charakteristische 70er-Tapete zur Kulisse diente. Weil seine Mutter kein Englisch verstand, begann Klaus Beyer Songs der Beatles merkwürdig zwar, aber an sich stimmig einzudeutschen und sang diese ein: "Es sollte sich reimen", so Beyer. Weil er zu der Musik noch ein Bild vermitteln wollte, drehte er kurzerhand mit seiner Kamera Videos dazu: Die Kulissen bastelte er selbst, wie er auch alle Rollen übernahm. Der Rest ist Legende: Im Berliner Frontkino entdeckte die damals sehr vitale Super8-Szene der Alternativ- und Punkkultur, der auch Regisseur und Filmkritiker Jörg Buttgereit entspringen sollte, die unbekümmerten Filme, es folgten die Documenta in Kassel, TV-Auftritte und Konzerte im ganzen Land: Mit seiner im besten Sinne des Wortes naiven Kunst wurde Beyer schnell Kult und obendrein Vaterfigur der in Berlin Mitte bis Ende der Neunzigerjahre überaus angesagten Wohnzimmerkonzert-Szene. Beyer blieb auf dem Boden und Kerzenwachszieher obendrein und lebt auch heute noch, wenn auch mittlerweile arbeitslos, in seiner Ein-Zimmer-Wohnung. Nur die Tapete ist mittlerweile weiß. Damit er einen neutralen Hintergrund für Aufnahmen habe, wie er meint. Unlängst beging man im Berliner Brotfabrikkino seinen 50. Geburtstag.Zu diesem Ereignis erschien im Martin Schmitz Verlag "Das System Klaus Beyer", in erster Linie eine Sammlung von Gesprächen von, wenn man so will, Fans und, zumindest entfernt, Geistesverwandter mit Klaus Beyer und seinem langjährigen Manager wie auch Herausgeber des Buches, Frank Behnke: Jörg Buttgereit, Christoph Schlingensief und der Journalist Detlef Kuhlbrodt stellten sich jeweils für ein "Kaffeekränzchengesprächen" (Verleger Schmitz) ein. Des weiteren finden sich Reproduktionen von Beyers handcolorierten Schwarzweißfotografien (darauf meist zu sehen: er selbst, wie sich überhaupt alles immer um die Person Beyer dreht) und selbstgemaltem und -gebasteltem Artwork, das auch vor kurzem in einer Ausstellung in Berlin zu sehen war, wie auch einige Texte aus Beyers akribisch geführtem Konzert-Tagebuch.
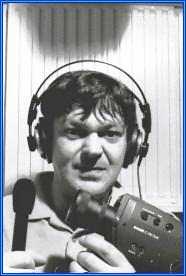 Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.
Dankenswerterweise hat man die Gespräche nicht einfach nur protokolliert, sondern - ähnlich der Vorgehensweise bei einem Dokumentarfilm, vielleicht ja aber auch an Beyers Collagen-Ästhetik selbst angelehnt - wesentliches ausgeschnitten und aneinander montiert: Zu gut zwei Dutzend Schlagworten, wie etwa Liebe, Kunst oder Wohnung, finden sich kurze Gesprächsfragmente, in denen, das ist das interessante, meist eher die Gesprächspartner über sich selbst und ihr Verhältnis zu Klaus Beyer sprechen, als dass Beyer selbst der Interviewte ist. Beyer beschreibt sich selbst als ruhigen Menschen und die Gespräche unterstreichen dies: Oft ist es nur ein kurzer Satz, eine Bestätigung oder kleine Relativierung, die er einbringt, gefolgt von absatzlangen Gedankengängen seiner Gegenüber. Ein sympathischer, uneitler Eindruck, der dem Idealbild vom Künstler, der sein Werk nicht erklärt, sehr nahe kommt. So ist es, neben den schön anzusehenden Reproduktionen natürlich, das Spannende an diesem Buch, dass etablierte Künstler wie Schlingensief und Buttgereit, die ähnliche Wurzeln aufweisen wie Beyer, sich selbst und ihr Werk zum "anderen Universum des Klaus Beyer" (so der Titel einer Dokumentation) in Bezug nehmen, Gemeinsamkeiten in Herangehensweise, Schaffungsprozess und Intention feststellen (oder aber im einzelnen auch nicht) oder aber Bezüge in der Kunstgeschichte aufdecken, die dem unbekümmerten Kreuzberger noch nicht einmal oder kaum bekannt sind: Buttgereit zieht John Waters und Andy Warhol heran, Schlingensief, der selbst schon mehrfach mit Beyer gearbeitet hat, verweist auf Méliès. Nur Kuhlbrodt ist weit weniger verkopft, sondern schlicht und ergreifend guter Bekannter und langjähriger Fan. Auch das ist im Rahmen des Buchs gewiss nicht ohne Reiz.Eine kleine Welt tut sich beim Lesen auf, bestehend aus 70er Jahre Panorama-Tapeten, bemalten Bettlaken, Plattenspielern aus orangem Plastik und der naiven Gemütlichkeit von verschmitzt in Hosen steckenden Kragenhemden und Pantoffeln. Dies alles aber ohne den beißenden Zynismus des White Trash, ja selbst Trash ist, paradoxerweise, nur ein unzulänglicher Begriff für Klaus Beyers oft schon solipsistisch anmutende Arbeiten, die sich zwar aus ganz ähnlichen Quellen des 70er Jahre Universums speisen wie etwa die Retro-Filme Wenzel Storchs, von deren oft bemüht wirkendem Appeal aber weit entfernt sind. Mit dem Begriff vom "System Klaus Beyer" hat Schlingensief das Phänomen wohl in der Tat gelungen umrissen. Man muss Klaus Beyer einfach mögen, bzw. ernstnehmen.
>>> Frank Behnke (Hrsg) Das System Klaus Beyer
>>> Berlin: Martin Schmitz, 2003
>>> 128 Seiten, zahlreiche Abbildungen
>>> 24,50 Euro
° ° °
Thema: Kinokultur
... findet leider ohne das Filmtagebuch statt. Der nette Nachbar von tristessedeluxe hingegen war dort und lässt uns hier an seinen Eindrücken teilhaben.
Festival-Website
Festival-Website
° ° °
Thema: Filmtagebuch
05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Zur heutigen Veröffentlichung des Films auf DVD von Kinowelt/Arthaus.
Die Zeichen der Macht - die Macht der Zeichen
 Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.
Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.
Peru zum Jahreswechsel 1590/1591. Von den spanischen Konquistadoren an den Rand der eigenen Existenz getrieben, erfinden die letzten Inkas in ihrer Not die Legende von El Dorado, dem güldenen Land des unermesslichen Reichtums, in der Hoffnung, die Besatzer ins unwegsame Landesinnere zu treiben. Unter der Führung von Gonzalo Pizarro ziehen einige Hundert Spanier, darunter auch Vertreter des Adels, des Klerus und Dutzende indigener Sklaven, ins Dickicht des Dschungels. Dieses entpuppt sich schon bald als undurchdringlich für die Konquistadoren mit ihren Rüstungen, Kanonen, Pferden und Vorräten - an einem Fluss wird der Plan gefasst, Flosse zu bauen, um einen Trupp von 40 Mann loszuschicken, die das Land erkunden und El Dorado ausfindig machen sollen.
Das Kommando wird Don Pedro de Ursua übertragen, doch auch der Vorstoß ins Innere des Landes mit dem Floß entpuppt sich als kaum zu meisternde Hürde. Angriffe von Indios und die reißenden Stromschnellen dezimieren die Truppe zusehends. Als Ursua angesichts der desolaten Situation den Rückzug zur Truppe befiehlt, kommt es zur Meuterei: der missgestaltete Unterführer Don Lope de Aguirre, schon zuvor durch Trotzigkeit aufgefallen, bringt die Soldaten und den Klerus mit Versprechungen von Macht und Reichtum hinter sich, legt Ursua und seine wenigen verbliebenen Anhänger in Ketten, rebelliert wider die spanische Krone und setzt den tapsigen, verfressenen Edelmann Don Fernando de Guzman als Marionetten-Kaiser auf den Thron von El Dorado. Die Suche nach dem goldenen Land auf dem Floß geht weiter. Tiefer in den Dschungel, tiefer in den alles verzehrenden Wahnsinn.
Werner Herzog bleibt sich treu und erzählt hier, wie auch in vielen anderen seiner Filme, eine Geschichte vom "ganz großen Scheitern". Macht und Ruhm - damit einhergehend der Hang zum Größenwahn - sind die bestimmenden Koordinaten, vor allem aber die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Kategorien, deren Gültigkeit im wesentlichen nur in Form von Ritualen, stillschweigenden Übereinkommungen, bestätigt wird. Deutlich wird dies vor dem Hintergrund der erbarmungslosen Kräfte des Dschungels, die den Menschen in seine Schranken verweisen und ihn zu allerlei Groteskem zwingen, wenn zum Beispiel Kanonenrohre als Insignien der politischen Macht durch den Schlamm gezerrt werden, junge Adelsdamen auf Sänften mühselig von Sklaven durch den Wald geschleppt werden oder wenn mitten im Dschungel feierlich die offizielle Erklärung der Meuterei und der Inbesitznahme von El Dorado an den spanischen König, der ja nicht nur bloß absent ist, sondern sich obendrein noch auf einem anderen Kontinent befindet, verlesen wird.
Schon das erste Bild - ein zermartertes, nebelverhangenes Gebirge auf dem sich, zunächst kaum erkennbar, eine Hunderte Mann starke Expedition gezwungenermaßen mühsig im Gänsemarsch fortbewegt - erklärt den Menschen zum Spielball einer ihm entfremdeten, ihn bestimmenden Natur und reduziert seine Machtgelüste und -spiele zum bloßen Zeichen innerhalb reeller Machtgefälle. Umso irrealer wirken somit die zahlreichen Rituale, die der Film uns der Reihe nach präsentiert und in deren Dienste sich die Menschen stellen, von denen sie sich leiten lassen und nach denen sie streben. Die Symbole der Macht verkümmern vor der Kulisse des Dschungel mehr und mehr zum reinen Selbstzweck ohne Legitimation, ohne Aussage. Und sie verpuffen, genau wie der Glanz von El Dorado, im Nirgendwo der kollektiven Halluzinationen gegen Ende des Filmes. "Kein Fluss kann so hoch steigen", sagt der die Mission begleitende Mönch gegen Ende im Fieberwahn, als er ein Schiff in den Wipfeln eines Baumes entdeckt. Nun, die Macht des Menschen offenbar ebenfalls nicht, auch wenn Aguirre in seinem Monolog von sich als dem "Zorn Gottes" spricht und die Vögel auf sein Geheiß hin tot von den Bäumen fielen.
 Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".
Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".
Ganz im Gegenteil dazu die Menschen: degeneriert und perspektivenlos ziehen diese Machthungrigen durch den endlosen Dschungel, legitimieren ihr Verhalten gegenseitig durch sich stetig wiederholende Machtrituale und -duelle und wähnen sich selbst noch in den verzweifelsten Momenten als baldige Herrscher eines monumentalen Weltreichs. "Unser Reich ist jetzt schon 6 mal größer als Spanien", verkündet Guzman von seinem schäbigen Thron auf dem Floß aus, "und mit jedem Tag, der vergeht, wird es größer.". Dabei hat er von seinem Reich noch nicht mal mehr gesehen als ein paar Bäume und einen endlosen Fluss. Vor dem, was ist, haben sich die Menschen in ihrem Drang zur Zeichenhaftigkeit verloren, stürzen in ihr Verderben und sterben - Ironie des Schicksals - im Fieber halluzinierend. Die wohltuend langsame und bedachte Inszenierung tut ihr übriges, um den Zuschauer zum Endes des Films in Zweifel zu lassen, ob er gerade Zeuge einer hypnotischen Halluzination gewesen sei. Ein Effekt, den die sphärische Musik des Musiker-Projektes Popol Vuh, das zahlreiche Herzog-Filme musikalisch untermalt hat, noch verstärkt.
Erwähnenswert selbstverständlich auch Klaus Kinski, der hier eine seiner Glanzleistungen im schauspielerischen Bereich seines Schaffens darbietet. Er zeichnet Don Lope de Aguirre gerade durch eine ganz bewusste Reduktion auf erschreckende Art und Weise als machthungrige Bestie. Ein Mensch der in seiner Erhabenheit über allem zu stehen scheint, dem man nur zu gerne glauben möchte, dass die Erde unter seinen Füßen zu beben beginnt und die Vögel auf sein Wort hin tot von den Bäumen fallen. Ein Über-Charakter, wie er typisch für die Herzog-Filme ist. Nur sehr selten und pointiert kommt es zu den expressiven, "kinski-esquen" Ausbrüchen, ansonsten unterstreichen reduzierte Mimik, Gestik und Wortausdruck die Diabolik seines Charakters, der tausende von Meilen entfernt gegen die spanische Krone rebelliert und eine neue Dynastie gründen will. Es ist ein cineastischer Genuß par excellence Kinskis Monologe - gerade und besonders den packenden Schlussmonolog, in dem sich Aguirre noch im Moment des "großen Scheiterns" des eigenen Ruhms versichert - zu verfolgen, seinem ausdrucksstarken Gesicht und den minimalen Muskelregungen darauf zuzusehen und sich von der Aura dieses "wahren Aguirres" hypnotisieren zu lassen.
Auch wenn Aguirre, der Zorn Gottes nicht der Ästhetik und den Schauwerten klassischen "Abenteuer-Kinos" entspricht, so ist dem Gespann Herzog-Kinski - ohne Kinski wäre der Film vermutlich nur halb so faszinierend - ein beeindruckendes Stück (leiser) Kinogeschichte und eine meditative Reflexion über die Zeichen der Macht - oder aber eben auch über die Macht der Zeichen - geglückt. Und auch wenn uns von den armen Teufeln aus Aguirre, der Zorn Gottes immerhin die Epoche der (fortgeschrittenen) Aufklärung trennt, so ist der Film mit seiner Denunziation des "Fetisch Macht" doch noch immer aktuell.
Zur DVD
Die DVD von Kinowelt/Arthaus besticht in allen Belangen durch eine liebe- und respektvolle Aufbereitung: Das schön gestaltete Cover unterstreicht durch edle Reduktion die Gediegenheit des Filmes. Bild- und Tonqualität (nur Dolby Digital 1.0) sind für einen Film diesen Alters absolut hervorragend und garantieren ungetrübten Heimkinogenuß. Das Bild ist im Format 4:3 und entspricht somit dem Originalformat des Films.
Werner Herzog, der bereits für die DVD-Edition von Anchor Bay einen englischen Audiokommentar eingesprochen hatte, hat zusammen mit dem damaligen Verleiher Laurens Straub extra einen deutschsprachigen Kommentar eingesprochen. Die Nähe der beiden Kommentatoren zueinander kommt dem Zuschauer zugute, der mit vielen interessanten Informationen zum Schaffungsprozess des Films und schönen Anekdoten beschenkt wird. Schade allein, dass nicht auch der englische Audiokommentar enthalten ist. Dafür aber ist eine zwar kurze, aber dennoch schöne Werkfotoschau als Bonus zu sehen, die nicht auf der internationalen DVD zu finden ist. Desweiteren gibt es obligatorische Dreingaben wie Biographien der Beteiligten und den Trailer.
==
Aguirre - Der Zorn Gottes (Deutschland 1973)
Regie/Drehbuch: Werner Herzog, Kamera: Thomas Mauch, Musik: Popol Vuh, Schnitt: Beate Mainka-Jellinghaus, Darsteller: Klaus Kinski, Daniel Ades, Peter Berling, u.a.
Anbieter: Kinowelt/Arthaus
» imdb | mrqe.com | rottentomatoes
» werner herzog - offizielle website | klaus kinski forum | tv-termine: kinski
Die Zeichen der Macht - die Macht der Zeichen
 Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt.
Klaus Kinski und Werner Herzog. Zwei Namen, zwei Genies, eine Legende der deutschen Filmgeschichte. Zahlreiche Mythen ranken sich um das gemeinsame Schaffen der beiden - seien es die berüchtigten, oft stundenlangen Wutausbrüche Kinskis während der Dreharbeiten, sei es die Legende von Herzog, der während der Aufnahmen den agierenden Kinski vom Regiestuhl aus stets mit dem Gewehr anvisiert habe. 16 Jahre dauerte die kreative Allianz der beiden, fünf Filme wurden in dieser Zeit geschaffen. Mit Aguirre, der Zorn Gottes wurde im Jahr 1973 der Grundstein für den noch immer lebendigen Mythos gelegt. Peru zum Jahreswechsel 1590/1591. Von den spanischen Konquistadoren an den Rand der eigenen Existenz getrieben, erfinden die letzten Inkas in ihrer Not die Legende von El Dorado, dem güldenen Land des unermesslichen Reichtums, in der Hoffnung, die Besatzer ins unwegsame Landesinnere zu treiben. Unter der Führung von Gonzalo Pizarro ziehen einige Hundert Spanier, darunter auch Vertreter des Adels, des Klerus und Dutzende indigener Sklaven, ins Dickicht des Dschungels. Dieses entpuppt sich schon bald als undurchdringlich für die Konquistadoren mit ihren Rüstungen, Kanonen, Pferden und Vorräten - an einem Fluss wird der Plan gefasst, Flosse zu bauen, um einen Trupp von 40 Mann loszuschicken, die das Land erkunden und El Dorado ausfindig machen sollen.
Das Kommando wird Don Pedro de Ursua übertragen, doch auch der Vorstoß ins Innere des Landes mit dem Floß entpuppt sich als kaum zu meisternde Hürde. Angriffe von Indios und die reißenden Stromschnellen dezimieren die Truppe zusehends. Als Ursua angesichts der desolaten Situation den Rückzug zur Truppe befiehlt, kommt es zur Meuterei: der missgestaltete Unterführer Don Lope de Aguirre, schon zuvor durch Trotzigkeit aufgefallen, bringt die Soldaten und den Klerus mit Versprechungen von Macht und Reichtum hinter sich, legt Ursua und seine wenigen verbliebenen Anhänger in Ketten, rebelliert wider die spanische Krone und setzt den tapsigen, verfressenen Edelmann Don Fernando de Guzman als Marionetten-Kaiser auf den Thron von El Dorado. Die Suche nach dem goldenen Land auf dem Floß geht weiter. Tiefer in den Dschungel, tiefer in den alles verzehrenden Wahnsinn.
Werner Herzog bleibt sich treu und erzählt hier, wie auch in vielen anderen seiner Filme, eine Geschichte vom "ganz großen Scheitern". Macht und Ruhm - damit einhergehend der Hang zum Größenwahn - sind die bestimmenden Koordinaten, vor allem aber die Sinnlosigkeit dieser menschlichen Kategorien, deren Gültigkeit im wesentlichen nur in Form von Ritualen, stillschweigenden Übereinkommungen, bestätigt wird. Deutlich wird dies vor dem Hintergrund der erbarmungslosen Kräfte des Dschungels, die den Menschen in seine Schranken verweisen und ihn zu allerlei Groteskem zwingen, wenn zum Beispiel Kanonenrohre als Insignien der politischen Macht durch den Schlamm gezerrt werden, junge Adelsdamen auf Sänften mühselig von Sklaven durch den Wald geschleppt werden oder wenn mitten im Dschungel feierlich die offizielle Erklärung der Meuterei und der Inbesitznahme von El Dorado an den spanischen König, der ja nicht nur bloß absent ist, sondern sich obendrein noch auf einem anderen Kontinent befindet, verlesen wird.
Schon das erste Bild - ein zermartertes, nebelverhangenes Gebirge auf dem sich, zunächst kaum erkennbar, eine Hunderte Mann starke Expedition gezwungenermaßen mühsig im Gänsemarsch fortbewegt - erklärt den Menschen zum Spielball einer ihm entfremdeten, ihn bestimmenden Natur und reduziert seine Machtgelüste und -spiele zum bloßen Zeichen innerhalb reeller Machtgefälle. Umso irrealer wirken somit die zahlreichen Rituale, die der Film uns der Reihe nach präsentiert und in deren Dienste sich die Menschen stellen, von denen sie sich leiten lassen und nach denen sie streben. Die Symbole der Macht verkümmern vor der Kulisse des Dschungel mehr und mehr zum reinen Selbstzweck ohne Legitimation, ohne Aussage. Und sie verpuffen, genau wie der Glanz von El Dorado, im Nirgendwo der kollektiven Halluzinationen gegen Ende des Filmes. "Kein Fluss kann so hoch steigen", sagt der die Mission begleitende Mönch gegen Ende im Fieberwahn, als er ein Schiff in den Wipfeln eines Baumes entdeckt. Nun, die Macht des Menschen offenbar ebenfalls nicht, auch wenn Aguirre in seinem Monolog von sich als dem "Zorn Gottes" spricht und die Vögel auf sein Geheiß hin tot von den Bäumen fielen.
 Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird".
Dass sich dieser allegoriereiche Film nicht im - dieser Grundthematik ja verführerisch nahe liegenden - überwältigenden Bilderrausch ergeht, ist ein großer Verdienst Werner Herzogs. Anstatt dem Pathos zu erliegen, kleidet Herzog die Geschichte des großen Verrats in schon beinahe "langweilige" Momentaufnahmen der Agonie. Und anstatt mit bombastischen Landschaftsaufnahmen in verkitschter Postkartenromantik zu schwelgen, wird die Natur fragmentarisch und vor allem real-existent, also unzeichenhaft, inszeniert. Eine Kulisse, die in sich "ist", schon immer "war" und vermutlich auch trotz des Treibens seiner Gäste darin auch in Zukunft "sein wird". Ganz im Gegenteil dazu die Menschen: degeneriert und perspektivenlos ziehen diese Machthungrigen durch den endlosen Dschungel, legitimieren ihr Verhalten gegenseitig durch sich stetig wiederholende Machtrituale und -duelle und wähnen sich selbst noch in den verzweifelsten Momenten als baldige Herrscher eines monumentalen Weltreichs. "Unser Reich ist jetzt schon 6 mal größer als Spanien", verkündet Guzman von seinem schäbigen Thron auf dem Floß aus, "und mit jedem Tag, der vergeht, wird es größer.". Dabei hat er von seinem Reich noch nicht mal mehr gesehen als ein paar Bäume und einen endlosen Fluss. Vor dem, was ist, haben sich die Menschen in ihrem Drang zur Zeichenhaftigkeit verloren, stürzen in ihr Verderben und sterben - Ironie des Schicksals - im Fieber halluzinierend. Die wohltuend langsame und bedachte Inszenierung tut ihr übriges, um den Zuschauer zum Endes des Films in Zweifel zu lassen, ob er gerade Zeuge einer hypnotischen Halluzination gewesen sei. Ein Effekt, den die sphärische Musik des Musiker-Projektes Popol Vuh, das zahlreiche Herzog-Filme musikalisch untermalt hat, noch verstärkt.
Erwähnenswert selbstverständlich auch Klaus Kinski, der hier eine seiner Glanzleistungen im schauspielerischen Bereich seines Schaffens darbietet. Er zeichnet Don Lope de Aguirre gerade durch eine ganz bewusste Reduktion auf erschreckende Art und Weise als machthungrige Bestie. Ein Mensch der in seiner Erhabenheit über allem zu stehen scheint, dem man nur zu gerne glauben möchte, dass die Erde unter seinen Füßen zu beben beginnt und die Vögel auf sein Wort hin tot von den Bäumen fallen. Ein Über-Charakter, wie er typisch für die Herzog-Filme ist. Nur sehr selten und pointiert kommt es zu den expressiven, "kinski-esquen" Ausbrüchen, ansonsten unterstreichen reduzierte Mimik, Gestik und Wortausdruck die Diabolik seines Charakters, der tausende von Meilen entfernt gegen die spanische Krone rebelliert und eine neue Dynastie gründen will. Es ist ein cineastischer Genuß par excellence Kinskis Monologe - gerade und besonders den packenden Schlussmonolog, in dem sich Aguirre noch im Moment des "großen Scheiterns" des eigenen Ruhms versichert - zu verfolgen, seinem ausdrucksstarken Gesicht und den minimalen Muskelregungen darauf zuzusehen und sich von der Aura dieses "wahren Aguirres" hypnotisieren zu lassen.
Auch wenn Aguirre, der Zorn Gottes nicht der Ästhetik und den Schauwerten klassischen "Abenteuer-Kinos" entspricht, so ist dem Gespann Herzog-Kinski - ohne Kinski wäre der Film vermutlich nur halb so faszinierend - ein beeindruckendes Stück (leiser) Kinogeschichte und eine meditative Reflexion über die Zeichen der Macht - oder aber eben auch über die Macht der Zeichen - geglückt. Und auch wenn uns von den armen Teufeln aus Aguirre, der Zorn Gottes immerhin die Epoche der (fortgeschrittenen) Aufklärung trennt, so ist der Film mit seiner Denunziation des "Fetisch Macht" doch noch immer aktuell.
Zur DVD
Die DVD von Kinowelt/Arthaus besticht in allen Belangen durch eine liebe- und respektvolle Aufbereitung: Das schön gestaltete Cover unterstreicht durch edle Reduktion die Gediegenheit des Filmes. Bild- und Tonqualität (nur Dolby Digital 1.0) sind für einen Film diesen Alters absolut hervorragend und garantieren ungetrübten Heimkinogenuß. Das Bild ist im Format 4:3 und entspricht somit dem Originalformat des Films.
Werner Herzog, der bereits für die DVD-Edition von Anchor Bay einen englischen Audiokommentar eingesprochen hatte, hat zusammen mit dem damaligen Verleiher Laurens Straub extra einen deutschsprachigen Kommentar eingesprochen. Die Nähe der beiden Kommentatoren zueinander kommt dem Zuschauer zugute, der mit vielen interessanten Informationen zum Schaffungsprozess des Films und schönen Anekdoten beschenkt wird. Schade allein, dass nicht auch der englische Audiokommentar enthalten ist. Dafür aber ist eine zwar kurze, aber dennoch schöne Werkfotoschau als Bonus zu sehen, die nicht auf der internationalen DVD zu finden ist. Desweiteren gibt es obligatorische Dreingaben wie Biographien der Beteiligten und den Trailer.
==
Aguirre - Der Zorn Gottes (Deutschland 1973)
Regie/Drehbuch: Werner Herzog, Kamera: Thomas Mauch, Musik: Popol Vuh, Schnitt: Beate Mainka-Jellinghaus, Darsteller: Klaus Kinski, Daniel Ades, Peter Berling, u.a.
Anbieter: Kinowelt/Arthaus
» imdb | mrqe.com | rottentomatoes
» werner herzog - offizielle website | klaus kinski forum | tv-termine: kinski
° ° °
Thema: ad personam
05. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Das weiß ja nun mittlerweile wohl beinahe jeder. Die Hintergründe indes scheint kaum jemand zu kennen, entgegen aller Beteuerungen. In der SZ schlug man sich auf die Seite des Künstlers, der Spiegel hingegen witterte Medienmanipulation eines eitlen Regisseurs. Das im übrigen sehr lesenswerte Blog vom Unheilpraktiker hat nun wiederum an deren Text so einiges auszusetzen.
Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
° ° °
Thema: literatur
04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Nicht nur die Größe der Leinwand macht das Kino "bigger than life", auch die darauf gestrahlten Spektakel lassen die Koordinaten des Alltags oft weit hinter sich. Besonders Katastrophen in allen Facetten und Erscheinungsformen gehören zu den sensationellen Dauerbrennern der Filmgeschichte: Die Darstellung sorgt für aufsehenerregende und gut vermarktbare Schauwerte, die das Publikum im sicheren Saal erstaunen und erschaudern lassen, die mit der Katastrophe einhergehende Schilderung persönlicher Schicksale sorgt für emotionale Rührung, das in der Regel siegreiche Überwinden für Triumphgefühle. Und natürlich lassen sich rückblickend auch ganz vortrefflich gesellschaftliche Diskurse anhand der Filme ablesen. Ob nun in den 50ern die Angst vor den Kommunisten den Ufos die Genese im Kinosaal bescherte, ob in den 90ern unbändige Naturgewalten die Metropolen bedrohten oder ob Godzilla über Jahrzehnte hinweg, ähnlich den Atombomben auf Hiroshima oder Nagasaki, jede nennenswerte Siedlung Japans platt walzte: Immer ist die filmische Erzählung von der Katastrophe auch Ausdruck sozialer Befindlichkeiten und Selbstverständnisse.
 In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.
In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.
Ansonsten weiß die Zusammenstellung zu überzeugen: Aufgelistet werden einige Hundert Titel mit den wichtigsten Credits und einer für lexikalische Verhältnisse überaus ausführlichen Inhaltsangabe, jeweils noch mit einem oder mehreren wertenden Zitaten meist zeitgenössischer Filmkritik aus so unterschiedlichen Quellen wie etwa dem Lexikon des internationalen Films oder aber auch TV Movie und Konsorten. Vor allem diese Zitate sind von großem Interesse, entsprechen sie doch, im Idealfalle, einem kleinen Überblick über die Rezeptionsgeschichte und bereichern das ansonsten sehr auf die Vermittlung bloß empirisch messbarer Fakten konzentrierte Buch. Erfreulich obendrein, dass man auch tiefer in den Kellern der Filmgeschichte geforscht hat und auch hierzulande gerne von der Zensur weggesperrte oder schlicht weitestgehend in Vergessenheit geratene Filme, wie etwa einige Schlüsselfilme des italienischen Splatterfilms, mit einreiht. Ausgesuchtes Bildmaterial, dem man vielleicht nur hier und da ein wenig mehr Platz und ein etwas qualitativ geeigneteres Papier als Grundlage gewünscht hätte, sorgt obendrein für eine erfreuliche Abwechslung in der Gestaltung der großen Masse an Text.
Gewiss, ein so leidenschaftlicher Band wie das aus gleichem Verlagshause stammende Italowestern-Lexikon, mit seiner bald schon unüberschaubaren Fülle an akribisch zusammengetragenen Hintergrundinformationen, historischen Fakten und Filmvorstellungen, ist das Katastrophenfilm-Lexikon nicht geworden. Eine weitgehend solide und überzeugende Zusammenstellung von Filmen anhand eines bestimmenden Topos mit genügend Informationen, um auch jenseits der bloßen Auflistung bestehen zu können, die man gerne zu Recherchezwecken aber auch zum entspannten Schmökern und Filme-Entdecken zur Hand nimmt, ist Manfred Hobsch allemal gelungen.
Manfred Hobsch: Das große Lexikon der Katastrophenfilme
Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003
770 Seiten, zahlreiche Abbildungen
24,90 Euro
 In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden.
In seinem "Lexikon der Katastrophenfilme" versucht sich nun Manfred Hobsch an einer Katalogisierung des Topos. Ein schwieriges Unterfangen natürlich, da die Katastrophe im Film an sich noch keine Grundlage für ein fest umrissenes Genre bildet, sondern sich, dem Kriegsfilm nicht unähnlich, eher als bestimmende Kulisse eines davor sich abspielenden Horror-, Action- oder Science-Fiction-Film geriert. In einem dem lexikalischen Segment des umfangreichen Bandes vorangestellten knappen Aufsatz arbeitet Hobsch dennoch, vornehmlich unter Rekurs auf zahlreiche Quellen, einige Motive und Regularien des Katastrophenfilms heraus, die den folgenden Korpus grob definieren und an den Rändern dennoch ausreichend Spielraum gewähren. Dennoch verwundert es zumindest ein wenig, dass sich unter den aufgelisteten Filmen dann auch etwa Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum (UK 1968) findet, was im Text etwas bemüht gerechtfertigt wird: "... der intelligente Bordcomputer ihres Raumschiffs, HAL, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Mission endet mit einer Katastrophe." Dass man auf der anderen Seite dann aber etwa The Texas Chain Saw Massacre (USA 1974), der mit ähnlicher Begründung erwähnt werden könnte, oder M. Night Shymalans Signs (USA 2002), der unter dem Aspekt des Invasionsfilms nun ganz gewiss einen Eintrag verdient hätte, übergeht, erscheint nicht sonderlich plausibel. Allerdings lassen sich solche Unschärfen am Rande in einem Lexikon, dessen Gegenstand an sich schon nicht klar zu umreißen ist, wohl wirklich kaum vermeiden. Ansonsten weiß die Zusammenstellung zu überzeugen: Aufgelistet werden einige Hundert Titel mit den wichtigsten Credits und einer für lexikalische Verhältnisse überaus ausführlichen Inhaltsangabe, jeweils noch mit einem oder mehreren wertenden Zitaten meist zeitgenössischer Filmkritik aus so unterschiedlichen Quellen wie etwa dem Lexikon des internationalen Films oder aber auch TV Movie und Konsorten. Vor allem diese Zitate sind von großem Interesse, entsprechen sie doch, im Idealfalle, einem kleinen Überblick über die Rezeptionsgeschichte und bereichern das ansonsten sehr auf die Vermittlung bloß empirisch messbarer Fakten konzentrierte Buch. Erfreulich obendrein, dass man auch tiefer in den Kellern der Filmgeschichte geforscht hat und auch hierzulande gerne von der Zensur weggesperrte oder schlicht weitestgehend in Vergessenheit geratene Filme, wie etwa einige Schlüsselfilme des italienischen Splatterfilms, mit einreiht. Ausgesuchtes Bildmaterial, dem man vielleicht nur hier und da ein wenig mehr Platz und ein etwas qualitativ geeigneteres Papier als Grundlage gewünscht hätte, sorgt obendrein für eine erfreuliche Abwechslung in der Gestaltung der großen Masse an Text.
Gewiss, ein so leidenschaftlicher Band wie das aus gleichem Verlagshause stammende Italowestern-Lexikon, mit seiner bald schon unüberschaubaren Fülle an akribisch zusammengetragenen Hintergrundinformationen, historischen Fakten und Filmvorstellungen, ist das Katastrophenfilm-Lexikon nicht geworden. Eine weitgehend solide und überzeugende Zusammenstellung von Filmen anhand eines bestimmenden Topos mit genügend Informationen, um auch jenseits der bloßen Auflistung bestehen zu können, die man gerne zu Recherchezwecken aber auch zum entspannten Schmökern und Filme-Entdecken zur Hand nimmt, ist Manfred Hobsch allemal gelungen.
Manfred Hobsch: Das große Lexikon der Katastrophenfilme
Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, 2003
770 Seiten, zahlreiche Abbildungen
24,90 Euro
° ° °
Thema: Filmtagebuch
04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
29.10.2003, Heimkino
Ganz hinten, am Ende einer Sackgasse, liegt das Haus der alten Mrs. Wimmerforce. Zur Sackgasse soll dieses Haus auch fünf zwielichtigen Gestalten werden, die sich bei dem naiven Muttchen zur Untermiete einquartieren, um, getarnt von der Fassade biederer Bürgerlichkeit, den ganz großen Coup zu landen. Derweil ziehen die Züge weiter hinten vorbei, unter der Brücke hinter dem Haus. Viel wird bald auf sie herabgeworfen werden ...
 Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.
Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.
Wie man hört, arbeiten die Coens derzeit an einem Remake. Ein rundum passender Stoff für die beiden, möchte ich meinen. Auf das Ergebnis darf man so freudig gespannt wie neugierig sein.
imdb | mrqe | rottentomatoes | Alec Guinness: aktuelle TV-Termine
Ganz hinten, am Ende einer Sackgasse, liegt das Haus der alten Mrs. Wimmerforce. Zur Sackgasse soll dieses Haus auch fünf zwielichtigen Gestalten werden, die sich bei dem naiven Muttchen zur Untermiete einquartieren, um, getarnt von der Fassade biederer Bürgerlichkeit, den ganz großen Coup zu landen. Derweil ziehen die Züge weiter hinten vorbei, unter der Brücke hinter dem Haus. Viel wird bald auf sie herabgeworfen werden ...
 Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.
Wo nur anfangen bei diesem wunderbarem Stück Filmgeschichte, diesem augenzwinkernden Juwel des schwarzen Humors? Wie schön das kleine, verwinkelte Häuschen noch durch die Kameraarbeit verwinkelter, verschrobener zu sein scheint als es doch eigentlich schon ist. Und dann Alec Guinnes, wie er mit diesem irren Blick eines Vampirs, eines Caligari durch diese Behausung schleicht, so unheimlich weit weg von den sanften Augen dieses Mannes, wie man sie etwa aus Star Wars (USA 1977) kennt. Wie er zunächst als Schatten auf der Straße auftaucht, um das Haus schleicht. Oder die immer wiederkehrende Ansicht des Häuschens aus der Vogelpespektive, so schlicht wie effektiv: Zu Beginn heimelig, dann schon unheimlicher, zum Ende hin gruselig und mysteriös. Und natürlich die Schlußpointe des Films, das Tüpfelchen auf dem i, wenn sich fadenscheinige Beschwichtigungen auf der einen Seite und verhätschelnde Nachsichtigkeit auf der anderen zu einem so elegant aufgelöstem wie stimmigen Beschluß münden.Wie man hört, arbeiten die Coens derzeit an einem Remake. Ein rundum passender Stoff für die beiden, möchte ich meinen. Auf das Ergebnis darf man so freudig gespannt wie neugierig sein.
imdb | mrqe | rottentomatoes | Alec Guinness: aktuelle TV-Termine
° ° °
Thema: Filmtagebuch
04. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
29.10.2003, Heimkino
 "Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)
"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)
Sorglos hinsichtlich der eigenen Ambitionen entfaltet sich der Film, allzu sorglos leider über weite Strecken. Zu Beginn nicht sonderlich hastig, benötigt er lange, um zum Punkt zu kommen, nur um am Ende dann, wenn es dann denn wirklich amüsant zu werden droht, sein ganzes Pulver binnen weniger Minuten zu verschießen. Im Ergebnis bleibt ein Film, der gerne den Arthaus-Witz der üblichen Verdächtigen auch für sich beanspruchen würde, im wesentlichen hingegen harmlos ist, zum Schluß ein paar so herzliche wie tausend Mal zuvor bescherte Lacher bringt, im Ganzen dann aber nicht darüber hinweg täuschen kann, dass er letzten Endes doch nicht genügend Klasse aufweist, um sich langfristig in die Erinnerung der Zuschauer einzubrennen. Recht unerheblich also und bald schon größtenteils vergessen. Ein Film wie gemacht, um während des lustlosen Zappens dran hängen zu bleiben - und ich bin mir nicht sicher, ob das ein positives Urteil ist.
imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de | filmz.de
 "Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)
"Als fünf geistig eher minderbemittelte Kleinkriminelle von einem unzureichend bewachten, prall gefüllten Safe erfahren, glauben sie an die Chance ihres Lebens. Aus ironischer Distanz erzählte Geschichte von klassischen Verlierer-Typen, die die Standardsituationen des Caper-Movies in ihr Gegenteil verkehrt. Zwischen Anteilnahme am Schicksal seiner Figuren und forcierter Skurrilität schwankend, überzeugt der Film nur stellenweise als Komödie." (Lexikon des internationalen Films)Sorglos hinsichtlich der eigenen Ambitionen entfaltet sich der Film, allzu sorglos leider über weite Strecken. Zu Beginn nicht sonderlich hastig, benötigt er lange, um zum Punkt zu kommen, nur um am Ende dann, wenn es dann denn wirklich amüsant zu werden droht, sein ganzes Pulver binnen weniger Minuten zu verschießen. Im Ergebnis bleibt ein Film, der gerne den Arthaus-Witz der üblichen Verdächtigen auch für sich beanspruchen würde, im wesentlichen hingegen harmlos ist, zum Schluß ein paar so herzliche wie tausend Mal zuvor bescherte Lacher bringt, im Ganzen dann aber nicht darüber hinweg täuschen kann, dass er letzten Endes doch nicht genügend Klasse aufweist, um sich langfristig in die Erinnerung der Zuschauer einzubrennen. Recht unerheblich also und bald schon größtenteils vergessen. Ein Film wie gemacht, um während des lustlosen Zappens dran hängen zu bleiben - und ich bin mir nicht sicher, ob das ein positives Urteil ist.
imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de | filmz.de
° ° °
Thema: Lesezeichen
03. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
... nennt sich diese Website. Scheint mir auf den ersten Blick eine der interessanteren Websites zu Kubricks meisterlichem Film zu sein.
<via Striptease-Raserei>
<via Striptease-Raserei>
° ° °
Thema: Filmtagebuch
03. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
29.10.2003, Heimkino
Einer von jenen Filmen, über die man sich im Nachhinein schier endlos aufregen könnte. Nicht etwa, weil er einfach nur nicht sehenswert gewesen wäre, nein. Solche Filme sind schneller vergessen als angesehen, als für hedonistische Zwecke gleich welcher Art unbrauchbar im Archiv der Erinnerung abgebucht und gut. Nein, Dardevil ist da viel schlimmer: Er ist einer jener Filme, die mit denkbar besten Voraussetzungen ans Werk gingen, nur um eigentlich so recht alles zu versieben.
 So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.
So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.
Ohne weiteres wäre das ein Stoff, der, ästhetisch entsprechend aufbereitet, das Zeug zum würdigen Erbe des ersten Batman-Films von Tim Burton hätte. Doch dafür hätte es vielleicht etwas weniger Kalkül, etwas mehr Vision gebraucht. Dass erste Teile von Superhelden-Serials gerne etwas behäbig sind, weil man die traumatische Biografie des Charakters als Weichenstellung für das folgende darlegen muss, ist soweit bekanntes Handicap und somit ist die im Vergleich zur Filmlänge beinahe ungelenk lang ausgefallene Exposition auch schnell verziehen. Dass der innere Konflikt nur in den Raum gestellt wird, niemals aber fesselnd umgesetzt wurde, ist schon weit weniger hinnehmbar. Immer dann, wenn es nötig wäre, den eigentlich Antihelden noir zu zeichnen, lässt er ihn, wie eine abgepackte Kampfwurst eng eingeschnürt, zu NuRock-Klängen rumhopsen und rumprügeln. Wo es nötig wäre, verbittert und zynisch zu sein, wird man, selbst für Comic-Verhältnisse, unangenehm unrealistisch und bisweilen unfreiwillig komisch. Da hilft es auch nichts, dass man zwar in der Tat so bemerkensweit weit geht, das "Mädchen des Heldens" im Kampf mit dem eher nervigen und affektieren denn sardonisch-bösartigen Gegenspieler zu opfern, wenn dies auf der anderen Seite dadurch geschieht, dass Daredevil, verletzt darliegend, das Unglück nicht verhindern kann, nur um aber im nächsten Moment wieder, wie nach drei Dosen Red Bull, vital durch's Kirchturmgebälk zu springen, um den Tod der Geliebten zu rächen.
So geht es in einer Tour. Das Potential der Vorlage wird als solches offenbar noch nicht mal wahrgenommen, zumindest aber zugunsten zweifelhafter Absichten fahrlässig verschenkt. Statt verzweifelt und mehr oder weniger kläglich zu versuchen, auf den seinerzeit durch Matrix (USA 1999) losgetretenen NuRock-Cyber-Martial-Arts-Trend aufzuspringen, hätte man echten Pathos, echte Epik wagen müssen. So aber warf man sich selbst nur allzu willfährig dem freien Markt zum Fraß vor, flüchtete sich in die Profillosigkeit von vorne bis hinten durchkalkulierter Kulturindustriemanierismen. Und diese führen in diesme Falle noch nicht mal mehr zu charmantem Trash, wie das zum Beispiel Armageddon (USA 1997) gewesen ist.
Bitte kein Sequel, sondern umgehend ein Remake. Und zwar eins mit Eiern bitteschön, damit diese Gülle hier umgehend aus dem Gedächtnis streichbar ist.
imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de
Einer von jenen Filmen, über die man sich im Nachhinein schier endlos aufregen könnte. Nicht etwa, weil er einfach nur nicht sehenswert gewesen wäre, nein. Solche Filme sind schneller vergessen als angesehen, als für hedonistische Zwecke gleich welcher Art unbrauchbar im Archiv der Erinnerung abgebucht und gut. Nein, Dardevil ist da viel schlimmer: Er ist einer jener Filme, die mit denkbar besten Voraussetzungen ans Werk gingen, nur um eigentlich so recht alles zu versieben.
 So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.
So ist die Figur und ihr Konflikt eine überaus reizvolle (und mir als relativem Comic-Ignoranten auch bis dato kaum bekannt gewesen): In ärmlichen Verhältnissen als Sohn eines Hinterhof-Boxers in New York aufgewachsen, erblindet der junge, von seinen Mitschülern gegängelte Matt Murdock in Folge einer Verätzung seiner Augen durch eine toxische Substanz. Eine tragische Verquickung unglücklicher Ereignisse führten dazu: Als er seinen Vater, der ihm trotz aller finanzieller Widrigkeiten Held und Idol ist, in einer Nebengasse als Straßendieb erkennt, rennt er wie hysterisch druch die Straßen und verursacht einen Beinahe-Unfall mit einem Giftmülltransporter, nicht ohne noch einen Strahl des Gifts mitten ins Gesicht abzubekommen. In Folge entwickelt der Kleine in Kompensation ein unheimlich scharfes Gehör, das es ihm, einer Fledermaus ähnlich, ermöglicht, anhand noch feinster Echos vor dem geistigen Auge ein Abbild seiner Umgebung zu konstruieren. Als sein Vater schließlich von einem Haufen Gangster ermordet wird, schwört der Junge, selbst oft Opfer von Gewaltübergriffen gewesen, Rache im Namen all derjeniger zu nehmen, denen sonst keiner zu Hilfe kommt. Wo andere Saubermann-Superhelden vor allem an der Übergabe einschlägiger Delinquenten an die zuständigen Behörden interessiert sind, ist Daredevils Projekt weit archaischer, vormoderner: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Vor allem dann, wenn die Institutionen der Justiz zur Rechtsprechung nicht mehr fähig scheinen. Dies bleibt nicht ohne Folgen. Im Blutrausch sieht sich Daredevil bald selbst in die Position der Mörder seines Vaters versetzt, als er vor den Augen des Sohns einen Vater richtet. Ist er einer von den Guten? Einer von den Bösen? Ein innerer Konflikt schwillt an, die Stadt indes ist, einer spekulativen Berichterstattung über den geheimnisvollen Vollstrecker ist's geschuldet, versessen darauf, die Identität hinter der Maske zu lüften.Ohne weiteres wäre das ein Stoff, der, ästhetisch entsprechend aufbereitet, das Zeug zum würdigen Erbe des ersten Batman-Films von Tim Burton hätte. Doch dafür hätte es vielleicht etwas weniger Kalkül, etwas mehr Vision gebraucht. Dass erste Teile von Superhelden-Serials gerne etwas behäbig sind, weil man die traumatische Biografie des Charakters als Weichenstellung für das folgende darlegen muss, ist soweit bekanntes Handicap und somit ist die im Vergleich zur Filmlänge beinahe ungelenk lang ausgefallene Exposition auch schnell verziehen. Dass der innere Konflikt nur in den Raum gestellt wird, niemals aber fesselnd umgesetzt wurde, ist schon weit weniger hinnehmbar. Immer dann, wenn es nötig wäre, den eigentlich Antihelden noir zu zeichnen, lässt er ihn, wie eine abgepackte Kampfwurst eng eingeschnürt, zu NuRock-Klängen rumhopsen und rumprügeln. Wo es nötig wäre, verbittert und zynisch zu sein, wird man, selbst für Comic-Verhältnisse, unangenehm unrealistisch und bisweilen unfreiwillig komisch. Da hilft es auch nichts, dass man zwar in der Tat so bemerkensweit weit geht, das "Mädchen des Heldens" im Kampf mit dem eher nervigen und affektieren denn sardonisch-bösartigen Gegenspieler zu opfern, wenn dies auf der anderen Seite dadurch geschieht, dass Daredevil, verletzt darliegend, das Unglück nicht verhindern kann, nur um aber im nächsten Moment wieder, wie nach drei Dosen Red Bull, vital durch's Kirchturmgebälk zu springen, um den Tod der Geliebten zu rächen.
So geht es in einer Tour. Das Potential der Vorlage wird als solches offenbar noch nicht mal wahrgenommen, zumindest aber zugunsten zweifelhafter Absichten fahrlässig verschenkt. Statt verzweifelt und mehr oder weniger kläglich zu versuchen, auf den seinerzeit durch Matrix (USA 1999) losgetretenen NuRock-Cyber-Martial-Arts-Trend aufzuspringen, hätte man echten Pathos, echte Epik wagen müssen. So aber warf man sich selbst nur allzu willfährig dem freien Markt zum Fraß vor, flüchtete sich in die Profillosigkeit von vorne bis hinten durchkalkulierter Kulturindustriemanierismen. Und diese führen in diesme Falle noch nicht mal mehr zu charmantem Trash, wie das zum Beispiel Armageddon (USA 1997) gewesen ist.
Bitte kein Sequel, sondern umgehend ein Remake. Und zwar eins mit Eiern bitteschön, damit diese Gülle hier umgehend aus dem Gedächtnis streichbar ist.
imdb | mrqe | rottentomatoes | angelaufen.de
° ° °
Thema: Kinokultur
03. November 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Eine erste solche, die sich auch in der Tat auf eine Pressevorführung stützen kann, gibt es nun bei F.LM - Texte zum Film und zwar ziemlich genau hier.
Der etwas mißmutige Text von Patrick Baum nährt die gerade auch aufgrund der unsagbaren Enttäuschung von Matrix:Reloaded entstandene Einschätzung, dass auch vom finalen Teil der Trilogie wohl nicht wirklich viel zu erwarten ist. Sehr schade eigentlich.
Der etwas mißmutige Text von Patrick Baum nährt die gerade auch aufgrund der unsagbaren Enttäuschung von Matrix:Reloaded entstandene Einschätzung, dass auch vom finalen Teil der Trilogie wohl nicht wirklich viel zu erwarten ist. Sehr schade eigentlich.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
30. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
27.10.2003, Kino Arsenal
Was für ein exklusives Vergnügen, Tsui Harks kunterbunten wilden Genre-Mix auch mal im Kino sehen zu können. Das unterstreicht noch die Dame von der Arsenal-Belegschaft, die vor dem Film verkündet, wie mühselig es doch gewesen sei, eine Kinorolle des Films aufzutreiben. Man hatte eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben!
 Das China, das Hark in seinem gewiss nicht vordergründig politisch intendierten Film zeigt, ist ein Land des Chaos: Militärführer kommen und gehen, da braucht es gar nicht viel Hintergrundwissen. "Das ist ganz einfach", kommentiert ein Chinese das ganze gegen Ende, kurz bevor er, die Äußerung war wohl zu subversiv, eingebuchtet wird. Dieses soziale Chaos findet Entsprechung im hektischen Schnitt des Films: Kaum eine Einstellung, die eine Laufzeit von 5 Sekunden überdauert, Bewegungen werden nicht lange in Szene gesetzt, oft nur der letzte Abschnitt einer Bewegung wird überhaupt gezeigt. Die wunderbare Szene, in der die subversiv umtriebige Tochter ihren Vater, den General, durchs Fenster beobachtet, verdeutlicht dies sehr anschaulich. Es geht nicht um das Dazwischen, es geht nur ums Ergebnis. Ein Kino der Hast, der Eile tut sich da auf. Tsui Hark, ein Ökonom der Erzählung.
Das China, das Hark in seinem gewiss nicht vordergründig politisch intendierten Film zeigt, ist ein Land des Chaos: Militärführer kommen und gehen, da braucht es gar nicht viel Hintergrundwissen. "Das ist ganz einfach", kommentiert ein Chinese das ganze gegen Ende, kurz bevor er, die Äußerung war wohl zu subversiv, eingebuchtet wird. Dieses soziale Chaos findet Entsprechung im hektischen Schnitt des Films: Kaum eine Einstellung, die eine Laufzeit von 5 Sekunden überdauert, Bewegungen werden nicht lange in Szene gesetzt, oft nur der letzte Abschnitt einer Bewegung wird überhaupt gezeigt. Die wunderbare Szene, in der die subversiv umtriebige Tochter ihren Vater, den General, durchs Fenster beobachtet, verdeutlicht dies sehr anschaulich. Es geht nicht um das Dazwischen, es geht nur ums Ergebnis. Ein Kino der Hast, der Eile tut sich da auf. Tsui Hark, ein Ökonom der Erzählung.
Wie überhaupt Ökonomie das bestimmende Thema des Films zu sein scheint: Längst schon kanonisierte Schlüsselfilme der Postmoderne geben sich im direkten Vergleich direkt handzahm aus. Peking Opera Blues ist bald Actionfilm, bald Kostümdrama, bald Melodram, bald Gangsternfilm, bald Slapstick-Komödie, bald Crossdress-Burleske. Der Ton des Films ändert sich beinahe schon analog zu seiner Schnittfrequenz im atemberaubenden Tempo, ohne aber ins bloß Manieristische drögen kunstgewerblichen Filmemachens abzudriften.
Im Gegenteil, Peking Opera Blues ist ein durch und durch kommerziell ausgerichteter Film und verneint diese Intention in keiner Weise. Aber es ist eine bis zum gewissen Grad ehrliche Ausrichtung, vor allem eine aufrichtig um den Zuschauer bemühte. Im Zusammenspiel mit den hohen formalen Qualitäten ergibt das einen rundum-glücklich-Film, von dem man lange zehren kann.
imdb | rottentomatoes | mrqe
Was für ein exklusives Vergnügen, Tsui Harks kunterbunten wilden Genre-Mix auch mal im Kino sehen zu können. Das unterstreicht noch die Dame von der Arsenal-Belegschaft, die vor dem Film verkündet, wie mühselig es doch gewesen sei, eine Kinorolle des Films aufzutreiben. Man hatte eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben!
 Das China, das Hark in seinem gewiss nicht vordergründig politisch intendierten Film zeigt, ist ein Land des Chaos: Militärführer kommen und gehen, da braucht es gar nicht viel Hintergrundwissen. "Das ist ganz einfach", kommentiert ein Chinese das ganze gegen Ende, kurz bevor er, die Äußerung war wohl zu subversiv, eingebuchtet wird. Dieses soziale Chaos findet Entsprechung im hektischen Schnitt des Films: Kaum eine Einstellung, die eine Laufzeit von 5 Sekunden überdauert, Bewegungen werden nicht lange in Szene gesetzt, oft nur der letzte Abschnitt einer Bewegung wird überhaupt gezeigt. Die wunderbare Szene, in der die subversiv umtriebige Tochter ihren Vater, den General, durchs Fenster beobachtet, verdeutlicht dies sehr anschaulich. Es geht nicht um das Dazwischen, es geht nur ums Ergebnis. Ein Kino der Hast, der Eile tut sich da auf. Tsui Hark, ein Ökonom der Erzählung.
Das China, das Hark in seinem gewiss nicht vordergründig politisch intendierten Film zeigt, ist ein Land des Chaos: Militärführer kommen und gehen, da braucht es gar nicht viel Hintergrundwissen. "Das ist ganz einfach", kommentiert ein Chinese das ganze gegen Ende, kurz bevor er, die Äußerung war wohl zu subversiv, eingebuchtet wird. Dieses soziale Chaos findet Entsprechung im hektischen Schnitt des Films: Kaum eine Einstellung, die eine Laufzeit von 5 Sekunden überdauert, Bewegungen werden nicht lange in Szene gesetzt, oft nur der letzte Abschnitt einer Bewegung wird überhaupt gezeigt. Die wunderbare Szene, in der die subversiv umtriebige Tochter ihren Vater, den General, durchs Fenster beobachtet, verdeutlicht dies sehr anschaulich. Es geht nicht um das Dazwischen, es geht nur ums Ergebnis. Ein Kino der Hast, der Eile tut sich da auf. Tsui Hark, ein Ökonom der Erzählung.Wie überhaupt Ökonomie das bestimmende Thema des Films zu sein scheint: Längst schon kanonisierte Schlüsselfilme der Postmoderne geben sich im direkten Vergleich direkt handzahm aus. Peking Opera Blues ist bald Actionfilm, bald Kostümdrama, bald Melodram, bald Gangsternfilm, bald Slapstick-Komödie, bald Crossdress-Burleske. Der Ton des Films ändert sich beinahe schon analog zu seiner Schnittfrequenz im atemberaubenden Tempo, ohne aber ins bloß Manieristische drögen kunstgewerblichen Filmemachens abzudriften.
Im Gegenteil, Peking Opera Blues ist ein durch und durch kommerziell ausgerichteter Film und verneint diese Intention in keiner Weise. Aber es ist eine bis zum gewissen Grad ehrliche Ausrichtung, vor allem eine aufrichtig um den Zuschauer bemühte. Im Zusammenspiel mit den hohen formalen Qualitäten ergibt das einen rundum-glücklich-Film, von dem man lange zehren kann.
imdb | rottentomatoes | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
29. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
28.10.2003, UFA Palast Kosmos
Die Ehe genießt als Institution in den Filmen der Coens seit jeher einen denkbar schlechten Stand. Bereits im Debüt der beiden, Blood Simple (USA 1984), bildete eine schon vor Beginn des Film hoffnungslos in die Brüche gegangene Ehe die Kulisse für die gegenseitige brutale Zerfleischung der beiden Eheleute (und aller Beteiligten). In Fargo (USA 1996) ließ der Gatte seine Gattin entführen, die Suche nach dem benötigten Kitt zur Rettung einer ebenso in die Brüche gegangenen Ehe diente in O Brother Where Art Thou? (USA 2000) zum Anlass einer Odyssee quer durchs weite Land um den Mississippi und in The Man Who Wasn't There (USA 2001) macht sich Billy Bob Thornton die Seitensprünge seiner Gattin gefühlskalt zunutze. Die Ehe mit ihren zahlreichen gegenseitigen Verpflichtungen und den damit einhergehenden personellen Beziehungsgeflechten dient den beiden Feuilleton-Lieblingen im wesentlichen als Matrix für ihre Anordnungen mikrosozialer Kleinstmaschinen, die, einmal sorglos angelassen, kaum mehr noch zu stoppen sind, am wenigsten von den darin Gefangenen selbst. Romantik findet auf dieser Spielwiese des sophisticated humor a priori keinen Platz. So ist es nur als doppelt ironisch gebrochen zu bezeichnen, wenn George Clooney als Staranwalt Miles Massey im neuesten Film der Coen Brüder ausgerechnet als Eröffnungsredner eines Kongress von Eherechtsanwälten seinen Aufsatz zerreit und so geläutert wie mitreißend verkündet, seinen Zynismus beiseite gelegt zu haben und endlich, ja endlich die eine große wahre Liebe im Leben gefunden zu haben. Trotz andernweitiger Hinweise - Zaghafter Applaus, dann standing ovations, Schulterklopfen, Umarmungen folgen diesem euphorischen Plädoyer, als der zuvor so eitle Anwalt mit halb aus der Hose hängendem Hemd durch die Massen Richtung Ausgang schreitet - kann das nur nicht ernst gemeint sein: Selten haben die Coens so offensichtlich böse ihr Spiel mit der Liebe getrieben. Denn dass sich die nunmehr gefunden geglaubte Liebe nur wenig später als sorgfältig geplante Falle herausstellt, sollte jedem, vor allem eigentlich Massey selbst, bereits im Vorfeld klar sein: Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones), das Objekt der Begierde, stand nur kurz zuvor noch auf der juristisch gegnerischen Seite, als Gattin eines Mandanten von Massey, der diese in einer wahnwitzigen Gerichtsverhandlung um das bereits zum Greifen nahe Vermögen ihres Ex-Gatten brachte. Ein berechnendes Heiratsluder, wie es im Buche steht, eine fleischfressende Pflanze, deren klebrige Blätter sich lange schon um die Fliege Massey gelegt haben.
 Gewiss ein prächtiger Stoff für die beiden, zumal unter den Vorzeichen der eigenen Filmografie, doch so recht zu überzeugen vermag die Ausführung nicht. Gehörte das cinephil gewitzte Zitat zwar immer schon zum liebsten Werkzeug im Repertoire der beiden Brüder, scheint man diesmal zuvorderst daran interessiert zu sein, mehr oder weniger ungelenk auf sich selbst zu verweisen. Da ist dann eine beinahe schon klassische Eröffnungsszene, in der der Gehörnte seine Gattin in flagranti erwischt. Dann Auftritt Clooney, der in seinem affektiertem Spiel als eher schon nervige Übersteuerung seiner Rolle aus O Brother Where Art Thou?, auch diesmal wieder mit Schönheitstick, erscheint, später ein selten dämlicher Gorilla von einem Killer mit Asthma, dessen Auftrag, die Gattin um die Ecke zu bringen, in der Ausführung natürlich so gewohnt wie vorhersehbar grotesk in die Binsen geht, eine Gerichtsverhandlung, wie man sie ähnlich schon aus The Man Who Wasn't There kennt, ein verstecktes Hinterzimmer gibts obendrein, in dem ein wahrer Methusalem von Kanzleichef Clooney zum, hinsichtlich des eigenen Schicksals, mahnenden Damoklesschwert wird, das Hinterzimmer selbst freilich zur Hölle wie dereinst das gespenstische Hotel für Barton Fink (USA 1991).
Gewiss ein prächtiger Stoff für die beiden, zumal unter den Vorzeichen der eigenen Filmografie, doch so recht zu überzeugen vermag die Ausführung nicht. Gehörte das cinephil gewitzte Zitat zwar immer schon zum liebsten Werkzeug im Repertoire der beiden Brüder, scheint man diesmal zuvorderst daran interessiert zu sein, mehr oder weniger ungelenk auf sich selbst zu verweisen. Da ist dann eine beinahe schon klassische Eröffnungsszene, in der der Gehörnte seine Gattin in flagranti erwischt. Dann Auftritt Clooney, der in seinem affektiertem Spiel als eher schon nervige Übersteuerung seiner Rolle aus O Brother Where Art Thou?, auch diesmal wieder mit Schönheitstick, erscheint, später ein selten dämlicher Gorilla von einem Killer mit Asthma, dessen Auftrag, die Gattin um die Ecke zu bringen, in der Ausführung natürlich so gewohnt wie vorhersehbar grotesk in die Binsen geht, eine Gerichtsverhandlung, wie man sie ähnlich schon aus The Man Who Wasn't There kennt, ein verstecktes Hinterzimmer gibts obendrein, in dem ein wahrer Methusalem von Kanzleichef Clooney zum, hinsichtlich des eigenen Schicksals, mahnenden Damoklesschwert wird, das Hinterzimmer selbst freilich zur Hölle wie dereinst das gespenstische Hotel für Barton Fink (USA 1991).
 Aber, und das ist das Entscheidende, so recht ein Zentrum findet sich nicht. Zwar ist jede Szene für sich genommen unvergleichlich Coen, was wohl seitens des vom Verleih anvisierten Publikums, von einer selbst schon grotesk am Gegenstand vorbeigehenden Filmpromotion ins Kino gelockt, für Irritationen sorgen wird. Doch das bisweilen sogar recht amüsante Detail bleibt lediglich Episode in einem Flickwerk, heller Moment, der Film im Ganzen dann doch bloß nur ein groß angelegter Abruf bereits bekannter und kalkulierter Schlüsselreize. Das Genialische, wie man es aus früheren Filmen der Coens kennen und lieben gelernt hat, geht Ein (un)möglicher Härtefall über weite Strecken verlustig. Wie die Verfilmung eines Notizzettels wirkt das Ergebnis: Haufenweise Ideen, die die beiden vielleicht mal aus einer Laune heraus niedergeschrieben haben, aus welchem Grund auch immer aber nie aber zur Anwendung bringen konnten. Ein in seiner Darbietung als Spielfilm wenig durchdachtes Potpourri an grotesken Einfällen also, wie man es ähnlich bereits aus Ethan Coens Buch Falltür ins Paradies kennt, dort aber zumindest, aufgrund der gewählten Form der Kurzgeschichtensammlung, im Gesamten noch zu überzeugen wusste.
Aber, und das ist das Entscheidende, so recht ein Zentrum findet sich nicht. Zwar ist jede Szene für sich genommen unvergleichlich Coen, was wohl seitens des vom Verleih anvisierten Publikums, von einer selbst schon grotesk am Gegenstand vorbeigehenden Filmpromotion ins Kino gelockt, für Irritationen sorgen wird. Doch das bisweilen sogar recht amüsante Detail bleibt lediglich Episode in einem Flickwerk, heller Moment, der Film im Ganzen dann doch bloß nur ein groß angelegter Abruf bereits bekannter und kalkulierter Schlüsselreize. Das Genialische, wie man es aus früheren Filmen der Coens kennen und lieben gelernt hat, geht Ein (un)möglicher Härtefall über weite Strecken verlustig. Wie die Verfilmung eines Notizzettels wirkt das Ergebnis: Haufenweise Ideen, die die beiden vielleicht mal aus einer Laune heraus niedergeschrieben haben, aus welchem Grund auch immer aber nie aber zur Anwendung bringen konnten. Ein in seiner Darbietung als Spielfilm wenig durchdachtes Potpourri an grotesken Einfällen also, wie man es ähnlich bereits aus Ethan Coens Buch Falltür ins Paradies kennt, dort aber zumindest, aufgrund der gewählten Form der Kurzgeschichtensammlung, im Gesamten noch zu überzeugen wusste.
Er habe genügend Autoren an der Hand, die ihm das "Barton Fink Feeling" auf die Leinwand zaubern könnten, herrscht der Produzent Lipnick seinen jungen Autoren Barton Fink im gleichnamigen Film, einem der besten der Coens, an. Fink selbst bräuchte er hierfür ganz gewiss nicht. Das ist im wesentlichen die Crux des vorliegenden Films. Er fühlt sich an wie ein Coenfilm, ist gut abgekucktes Recycling sattsam bekannter Elemente und Motive, zugegeben stellenweise auch unterhaltsam, doch die Coens selbst hätte es für diesen Film nun ganz gewiss nicht gebraucht. Hier hat man sich weit unter Gebühr verkauft.
===
Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003)
Regie: Joel Coen; Drehbuch: Robert Ramsey, Matthew Stone, John Romano, Ethan Coen, Joel Coen; Kamera: Roger Deakins; Schnitt: Roderick Jaynes (= Joel & Ethan Coen); Musik: Carter Burwell
Darsteller: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Cedric the Entertainer, Edward Herrmann, Paul Adelstein, Richard Jenkins, u.a.
Länge: ca. 100 Min. Verleih: UIP
imdb | Offizielle Website | pressespiegel@angelaufen.de
Die Ehe genießt als Institution in den Filmen der Coens seit jeher einen denkbar schlechten Stand. Bereits im Debüt der beiden, Blood Simple (USA 1984), bildete eine schon vor Beginn des Film hoffnungslos in die Brüche gegangene Ehe die Kulisse für die gegenseitige brutale Zerfleischung der beiden Eheleute (und aller Beteiligten). In Fargo (USA 1996) ließ der Gatte seine Gattin entführen, die Suche nach dem benötigten Kitt zur Rettung einer ebenso in die Brüche gegangenen Ehe diente in O Brother Where Art Thou? (USA 2000) zum Anlass einer Odyssee quer durchs weite Land um den Mississippi und in The Man Who Wasn't There (USA 2001) macht sich Billy Bob Thornton die Seitensprünge seiner Gattin gefühlskalt zunutze. Die Ehe mit ihren zahlreichen gegenseitigen Verpflichtungen und den damit einhergehenden personellen Beziehungsgeflechten dient den beiden Feuilleton-Lieblingen im wesentlichen als Matrix für ihre Anordnungen mikrosozialer Kleinstmaschinen, die, einmal sorglos angelassen, kaum mehr noch zu stoppen sind, am wenigsten von den darin Gefangenen selbst. Romantik findet auf dieser Spielwiese des sophisticated humor a priori keinen Platz. So ist es nur als doppelt ironisch gebrochen zu bezeichnen, wenn George Clooney als Staranwalt Miles Massey im neuesten Film der Coen Brüder ausgerechnet als Eröffnungsredner eines Kongress von Eherechtsanwälten seinen Aufsatz zerreit und so geläutert wie mitreißend verkündet, seinen Zynismus beiseite gelegt zu haben und endlich, ja endlich die eine große wahre Liebe im Leben gefunden zu haben. Trotz andernweitiger Hinweise - Zaghafter Applaus, dann standing ovations, Schulterklopfen, Umarmungen folgen diesem euphorischen Plädoyer, als der zuvor so eitle Anwalt mit halb aus der Hose hängendem Hemd durch die Massen Richtung Ausgang schreitet - kann das nur nicht ernst gemeint sein: Selten haben die Coens so offensichtlich böse ihr Spiel mit der Liebe getrieben. Denn dass sich die nunmehr gefunden geglaubte Liebe nur wenig später als sorgfältig geplante Falle herausstellt, sollte jedem, vor allem eigentlich Massey selbst, bereits im Vorfeld klar sein: Marylin Rexroth (Catherine Zeta-Jones), das Objekt der Begierde, stand nur kurz zuvor noch auf der juristisch gegnerischen Seite, als Gattin eines Mandanten von Massey, der diese in einer wahnwitzigen Gerichtsverhandlung um das bereits zum Greifen nahe Vermögen ihres Ex-Gatten brachte. Ein berechnendes Heiratsluder, wie es im Buche steht, eine fleischfressende Pflanze, deren klebrige Blätter sich lange schon um die Fliege Massey gelegt haben.
 Gewiss ein prächtiger Stoff für die beiden, zumal unter den Vorzeichen der eigenen Filmografie, doch so recht zu überzeugen vermag die Ausführung nicht. Gehörte das cinephil gewitzte Zitat zwar immer schon zum liebsten Werkzeug im Repertoire der beiden Brüder, scheint man diesmal zuvorderst daran interessiert zu sein, mehr oder weniger ungelenk auf sich selbst zu verweisen. Da ist dann eine beinahe schon klassische Eröffnungsszene, in der der Gehörnte seine Gattin in flagranti erwischt. Dann Auftritt Clooney, der in seinem affektiertem Spiel als eher schon nervige Übersteuerung seiner Rolle aus O Brother Where Art Thou?, auch diesmal wieder mit Schönheitstick, erscheint, später ein selten dämlicher Gorilla von einem Killer mit Asthma, dessen Auftrag, die Gattin um die Ecke zu bringen, in der Ausführung natürlich so gewohnt wie vorhersehbar grotesk in die Binsen geht, eine Gerichtsverhandlung, wie man sie ähnlich schon aus The Man Who Wasn't There kennt, ein verstecktes Hinterzimmer gibts obendrein, in dem ein wahrer Methusalem von Kanzleichef Clooney zum, hinsichtlich des eigenen Schicksals, mahnenden Damoklesschwert wird, das Hinterzimmer selbst freilich zur Hölle wie dereinst das gespenstische Hotel für Barton Fink (USA 1991).
Gewiss ein prächtiger Stoff für die beiden, zumal unter den Vorzeichen der eigenen Filmografie, doch so recht zu überzeugen vermag die Ausführung nicht. Gehörte das cinephil gewitzte Zitat zwar immer schon zum liebsten Werkzeug im Repertoire der beiden Brüder, scheint man diesmal zuvorderst daran interessiert zu sein, mehr oder weniger ungelenk auf sich selbst zu verweisen. Da ist dann eine beinahe schon klassische Eröffnungsszene, in der der Gehörnte seine Gattin in flagranti erwischt. Dann Auftritt Clooney, der in seinem affektiertem Spiel als eher schon nervige Übersteuerung seiner Rolle aus O Brother Where Art Thou?, auch diesmal wieder mit Schönheitstick, erscheint, später ein selten dämlicher Gorilla von einem Killer mit Asthma, dessen Auftrag, die Gattin um die Ecke zu bringen, in der Ausführung natürlich so gewohnt wie vorhersehbar grotesk in die Binsen geht, eine Gerichtsverhandlung, wie man sie ähnlich schon aus The Man Who Wasn't There kennt, ein verstecktes Hinterzimmer gibts obendrein, in dem ein wahrer Methusalem von Kanzleichef Clooney zum, hinsichtlich des eigenen Schicksals, mahnenden Damoklesschwert wird, das Hinterzimmer selbst freilich zur Hölle wie dereinst das gespenstische Hotel für Barton Fink (USA 1991).  Aber, und das ist das Entscheidende, so recht ein Zentrum findet sich nicht. Zwar ist jede Szene für sich genommen unvergleichlich Coen, was wohl seitens des vom Verleih anvisierten Publikums, von einer selbst schon grotesk am Gegenstand vorbeigehenden Filmpromotion ins Kino gelockt, für Irritationen sorgen wird. Doch das bisweilen sogar recht amüsante Detail bleibt lediglich Episode in einem Flickwerk, heller Moment, der Film im Ganzen dann doch bloß nur ein groß angelegter Abruf bereits bekannter und kalkulierter Schlüsselreize. Das Genialische, wie man es aus früheren Filmen der Coens kennen und lieben gelernt hat, geht Ein (un)möglicher Härtefall über weite Strecken verlustig. Wie die Verfilmung eines Notizzettels wirkt das Ergebnis: Haufenweise Ideen, die die beiden vielleicht mal aus einer Laune heraus niedergeschrieben haben, aus welchem Grund auch immer aber nie aber zur Anwendung bringen konnten. Ein in seiner Darbietung als Spielfilm wenig durchdachtes Potpourri an grotesken Einfällen also, wie man es ähnlich bereits aus Ethan Coens Buch Falltür ins Paradies kennt, dort aber zumindest, aufgrund der gewählten Form der Kurzgeschichtensammlung, im Gesamten noch zu überzeugen wusste.
Aber, und das ist das Entscheidende, so recht ein Zentrum findet sich nicht. Zwar ist jede Szene für sich genommen unvergleichlich Coen, was wohl seitens des vom Verleih anvisierten Publikums, von einer selbst schon grotesk am Gegenstand vorbeigehenden Filmpromotion ins Kino gelockt, für Irritationen sorgen wird. Doch das bisweilen sogar recht amüsante Detail bleibt lediglich Episode in einem Flickwerk, heller Moment, der Film im Ganzen dann doch bloß nur ein groß angelegter Abruf bereits bekannter und kalkulierter Schlüsselreize. Das Genialische, wie man es aus früheren Filmen der Coens kennen und lieben gelernt hat, geht Ein (un)möglicher Härtefall über weite Strecken verlustig. Wie die Verfilmung eines Notizzettels wirkt das Ergebnis: Haufenweise Ideen, die die beiden vielleicht mal aus einer Laune heraus niedergeschrieben haben, aus welchem Grund auch immer aber nie aber zur Anwendung bringen konnten. Ein in seiner Darbietung als Spielfilm wenig durchdachtes Potpourri an grotesken Einfällen also, wie man es ähnlich bereits aus Ethan Coens Buch Falltür ins Paradies kennt, dort aber zumindest, aufgrund der gewählten Form der Kurzgeschichtensammlung, im Gesamten noch zu überzeugen wusste.Er habe genügend Autoren an der Hand, die ihm das "Barton Fink Feeling" auf die Leinwand zaubern könnten, herrscht der Produzent Lipnick seinen jungen Autoren Barton Fink im gleichnamigen Film, einem der besten der Coens, an. Fink selbst bräuchte er hierfür ganz gewiss nicht. Das ist im wesentlichen die Crux des vorliegenden Films. Er fühlt sich an wie ein Coenfilm, ist gut abgekucktes Recycling sattsam bekannter Elemente und Motive, zugegeben stellenweise auch unterhaltsam, doch die Coens selbst hätte es für diesen Film nun ganz gewiss nicht gebraucht. Hier hat man sich weit unter Gebühr verkauft.
===
Ein (un)möglicher Härtefall (Intolerable Cruelty, USA 2003)
Regie: Joel Coen; Drehbuch: Robert Ramsey, Matthew Stone, John Romano, Ethan Coen, Joel Coen; Kamera: Roger Deakins; Schnitt: Roderick Jaynes (= Joel & Ethan Coen); Musik: Carter Burwell
Darsteller: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Geoffrey Rush, Cedric the Entertainer, Edward Herrmann, Paul Adelstein, Richard Jenkins, u.a.
Länge: ca. 100 Min. Verleih: UIP
imdb | Offizielle Website | pressespiegel@angelaufen.de
° ° °
Thema: Kinokultur
Heute abend um 21 Uhr zeigt das Kino Arsenal am Potsdamer Platz mit einer Einführung des us-amerikanischen Filmwissenschaftler Marc Siegel Tsui Harks farbenprächtigen und gewitzt inszenierten Film Peking Opera Blues (HK 1986). In seinem hierzulande bis heute (leider) unerreichtem Standardwerk zum Hongkong-Film Film ohne Grenzen schreibt der Filmpublizist Ralph Umard (tip) zu diesem irrwitzigen Film: "Peking Opera Blues ist vor allem Kino, Kinomagie, Kino fürs Auge, Kinetik pur. Man spürt, dass hier ein Mann am Werk war, der sich mit Leib und Seele dem Kino verschrieben und die Filmgeschichte genau studiert hat." Es "verbinden sich chinesische Tradition und Artistik mit westlicher Filmtechnik auf ideale Weise." (Gesammelte Kritiken hier)
 Die Vorführung bildet den Auftakt einer öffentlichen seminarbegleitenden Filmreihe zu Siegels Lehrveranstaltung "New Wave of Hong Kong Cinema" am filmwissenschaftlichen Institut der Freien Universität Berlin. Immer montags um 21 Uhr werden ausgesuchte Filme aus der Ex-Kronkolonie mit kurzen Einführungen im Lichtspieltheater der Freunde der Deutschen Kinemathek präsentiert. Da das Programm für November leider noch nicht auf der Website eingepflegt wurde, darf man gespannt bleiben, mit welchen Filmen die Reihe in den kommenden Wochen noch aufwarten können wird.
Die Vorführung bildet den Auftakt einer öffentlichen seminarbegleitenden Filmreihe zu Siegels Lehrveranstaltung "New Wave of Hong Kong Cinema" am filmwissenschaftlichen Institut der Freien Universität Berlin. Immer montags um 21 Uhr werden ausgesuchte Filme aus der Ex-Kronkolonie mit kurzen Einführungen im Lichtspieltheater der Freunde der Deutschen Kinemathek präsentiert. Da das Programm für November leider noch nicht auf der Website eingepflegt wurde, darf man gespannt bleiben, mit welchen Filmen die Reihe in den kommenden Wochen noch aufwarten können wird.
Eine halbjährliche Mitgliedschaft bei den "Freunden" kostet 10 Euro und beinhaltet den Programmversand. Sie kann an der Abendkasse erworben werden und berechtigt zum vergünstigten Eintritt wie auch zum Erwerb einer 8er-Karte für 20 Euro (2,50?/Film !).
 Die Vorführung bildet den Auftakt einer öffentlichen seminarbegleitenden Filmreihe zu Siegels Lehrveranstaltung "New Wave of Hong Kong Cinema" am filmwissenschaftlichen Institut der Freien Universität Berlin. Immer montags um 21 Uhr werden ausgesuchte Filme aus der Ex-Kronkolonie mit kurzen Einführungen im Lichtspieltheater der Freunde der Deutschen Kinemathek präsentiert. Da das Programm für November leider noch nicht auf der Website eingepflegt wurde, darf man gespannt bleiben, mit welchen Filmen die Reihe in den kommenden Wochen noch aufwarten können wird.
Die Vorführung bildet den Auftakt einer öffentlichen seminarbegleitenden Filmreihe zu Siegels Lehrveranstaltung "New Wave of Hong Kong Cinema" am filmwissenschaftlichen Institut der Freien Universität Berlin. Immer montags um 21 Uhr werden ausgesuchte Filme aus der Ex-Kronkolonie mit kurzen Einführungen im Lichtspieltheater der Freunde der Deutschen Kinemathek präsentiert. Da das Programm für November leider noch nicht auf der Website eingepflegt wurde, darf man gespannt bleiben, mit welchen Filmen die Reihe in den kommenden Wochen noch aufwarten können wird.Eine halbjährliche Mitgliedschaft bei den "Freunden" kostet 10 Euro und beinhaltet den Programmversand. Sie kann an der Abendkasse erworben werden und berechtigt zum vergünstigten Eintritt wie auch zum Erwerb einer 8er-Karte für 20 Euro (2,50?/Film !).
° ° °
Thema: Filmtagebuch
26. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
24.10.2003, Heimkino
 Woran es gelegen haben mag, ist mir beinahe schleierhaft: Al Pacino, Johnny Depp, New Yorker Mafia, die klassische Geschichte vom Undercover-Cop, der sich zunehmend in eine Identitäts- und Loyalitätskrise verstrickt, das ganze vor mir sehr genehmer 70ies Kulisse. Beste Zutaten also, dennoch mag das fertige Gericht kaum munden.
Woran es gelegen haben mag, ist mir beinahe schleierhaft: Al Pacino, Johnny Depp, New Yorker Mafia, die klassische Geschichte vom Undercover-Cop, der sich zunehmend in eine Identitäts- und Loyalitätskrise verstrickt, das ganze vor mir sehr genehmer 70ies Kulisse. Beste Zutaten also, dennoch mag das fertige Gericht kaum munden.
Vielleicht ja auch deshalb, weil das Thema auch einfach narrativ weitgehend abgegrast ist (den sehr exzellenten Infernal Affairs aus Hongkong behalten wir mal als Ausnahme von der Regel im Hinterkopf), oder aber, weil alles irgendwie nur auf Sparflamme zubereitet wirkt: Die Story plätschert lange, zu lange, vor sich hin, ohne die einzelnen Episoden, im Sinne einer Klimax, so recht aneinander reihen zu können. Erst die letzte Viertelstunde entwickelt Spannung und Dramatik, diese steht aber kaum in dramaturgischer Relation zum Vorangegangenen.
Was hätte man aus den beiden bestimmenden Figuren nicht machen können? Johnny Depp als selbst schon sozial inkompetenter Ermittler, Al Pacino als der ewige Verlierer der "Familia", der kleine Straßengauner, der nie die Früchte der Macht auch nur antasten darf. Der eine, der seine Familie aufs Spiel setzt, seine Kinder grob vernachlässigt, der andere, der alles für die "Familia" tut, auch zuhause, beinahe schon spießbürgerlich, Familientyp ist und in Depp sich einen zweiten Sohn heranzieht, einen Judas natürlich. Doch nichts davon wird ausgereizt, alles nur in den Raum gestellt, als Indikatoren einer spannenden Geschichte, nicht aber als Manifestation derselben.
Das ist, gelinde gesagt, schade, gerade und besonders wegen den hohen Erwartungshaltungen im Vorfeld.
imdb | rottentomatoes | mrqe
 Woran es gelegen haben mag, ist mir beinahe schleierhaft: Al Pacino, Johnny Depp, New Yorker Mafia, die klassische Geschichte vom Undercover-Cop, der sich zunehmend in eine Identitäts- und Loyalitätskrise verstrickt, das ganze vor mir sehr genehmer 70ies Kulisse. Beste Zutaten also, dennoch mag das fertige Gericht kaum munden.
Woran es gelegen haben mag, ist mir beinahe schleierhaft: Al Pacino, Johnny Depp, New Yorker Mafia, die klassische Geschichte vom Undercover-Cop, der sich zunehmend in eine Identitäts- und Loyalitätskrise verstrickt, das ganze vor mir sehr genehmer 70ies Kulisse. Beste Zutaten also, dennoch mag das fertige Gericht kaum munden. Vielleicht ja auch deshalb, weil das Thema auch einfach narrativ weitgehend abgegrast ist (den sehr exzellenten Infernal Affairs aus Hongkong behalten wir mal als Ausnahme von der Regel im Hinterkopf), oder aber, weil alles irgendwie nur auf Sparflamme zubereitet wirkt: Die Story plätschert lange, zu lange, vor sich hin, ohne die einzelnen Episoden, im Sinne einer Klimax, so recht aneinander reihen zu können. Erst die letzte Viertelstunde entwickelt Spannung und Dramatik, diese steht aber kaum in dramaturgischer Relation zum Vorangegangenen.
Was hätte man aus den beiden bestimmenden Figuren nicht machen können? Johnny Depp als selbst schon sozial inkompetenter Ermittler, Al Pacino als der ewige Verlierer der "Familia", der kleine Straßengauner, der nie die Früchte der Macht auch nur antasten darf. Der eine, der seine Familie aufs Spiel setzt, seine Kinder grob vernachlässigt, der andere, der alles für die "Familia" tut, auch zuhause, beinahe schon spießbürgerlich, Familientyp ist und in Depp sich einen zweiten Sohn heranzieht, einen Judas natürlich. Doch nichts davon wird ausgereizt, alles nur in den Raum gestellt, als Indikatoren einer spannenden Geschichte, nicht aber als Manifestation derselben.
Das ist, gelinde gesagt, schade, gerade und besonders wegen den hohen Erwartungshaltungen im Vorfeld.
imdb | rottentomatoes | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch
23.10.2003, Zoo Palast
 Das traurige vorweg: Wer bereits Wochen im Vorfeld eine einmalige Sondervorführung "zu Ehren" eines Klassikers ankündigt, sollte meines Erachtens auch willens und fähig sein, den Film in würdevollen Umständen zu präsentieren. Zwar war mit dem Zoo Palast eines der altehrwürdigsten Kinos Berlins - auch wenn daran im Innern, der Multiplexisierung sei Dank, kaum noch was erinnert - als Spielstätte angekündigt, doch leider verbannte man dieses Juwel in den hintersten und kleinsten Saal. Dieser ist nun, rein von den Gegebenheiten her, bestenfalls eine einzige Hasstirade gegen die Kinokultur: Eine Leinwand, die kaum größer ist als die vom Friedrichshainer Intimes, ungewöhnlich hoch aufgehängt obendrein, und der Saal dafür elend lang. Wer ab Mitte hinten sitzt hat vermutlich auf seinem Fernseher zuhause, sofern der nicht ganz dem Briefmarken-Spektrum zuzurechnen ist, ein größeres Bild. Beinahe schon grotesk dann der Umstand, dass die Senkung im Saal nach etwa Dreiviertel einen Scheitelpunkt erreicht und die vorderen Sitze sich somit wieder durch eine Steigung auszeichnen. Wer es an der Kasse mit einem besonders ungnädigen Mitarbeiter zu tun hatte, findet sich unter Umständen also mitten im Graben wieder. Und die Leinwand selbst ließ bereits noch vor der Werbung erkennen, dass sie, sollte nicht noch zusätzlich kaschiert, das Bild also noch kleiner gemacht werden als es eh schon war, kaum in der Lage sein würde, Leones Breitbildepos im richtigen Format abzustrahlen. Allzu viel fehlte zwar nicht, doch hier und da - vor allem im Showdown - wurde einem die Beschneidung doch schmerzlich bewusst. Ein stetes Brummen in den Lautsprechern, dessen Ursprung ich aufgrund seiner Charakteristik nicht im Filmmaterial selbst verorten möchte, war ebenso wahrnehmbar. Kurz und knapp: Was UCI als Ehrdarbietung ankündigte, war bestenfalls lieblos, eigentlich schon eher eine Beleidigung.
Das traurige vorweg: Wer bereits Wochen im Vorfeld eine einmalige Sondervorführung "zu Ehren" eines Klassikers ankündigt, sollte meines Erachtens auch willens und fähig sein, den Film in würdevollen Umständen zu präsentieren. Zwar war mit dem Zoo Palast eines der altehrwürdigsten Kinos Berlins - auch wenn daran im Innern, der Multiplexisierung sei Dank, kaum noch was erinnert - als Spielstätte angekündigt, doch leider verbannte man dieses Juwel in den hintersten und kleinsten Saal. Dieser ist nun, rein von den Gegebenheiten her, bestenfalls eine einzige Hasstirade gegen die Kinokultur: Eine Leinwand, die kaum größer ist als die vom Friedrichshainer Intimes, ungewöhnlich hoch aufgehängt obendrein, und der Saal dafür elend lang. Wer ab Mitte hinten sitzt hat vermutlich auf seinem Fernseher zuhause, sofern der nicht ganz dem Briefmarken-Spektrum zuzurechnen ist, ein größeres Bild. Beinahe schon grotesk dann der Umstand, dass die Senkung im Saal nach etwa Dreiviertel einen Scheitelpunkt erreicht und die vorderen Sitze sich somit wieder durch eine Steigung auszeichnen. Wer es an der Kasse mit einem besonders ungnädigen Mitarbeiter zu tun hatte, findet sich unter Umständen also mitten im Graben wieder. Und die Leinwand selbst ließ bereits noch vor der Werbung erkennen, dass sie, sollte nicht noch zusätzlich kaschiert, das Bild also noch kleiner gemacht werden als es eh schon war, kaum in der Lage sein würde, Leones Breitbildepos im richtigen Format abzustrahlen. Allzu viel fehlte zwar nicht, doch hier und da - vor allem im Showdown - wurde einem die Beschneidung doch schmerzlich bewusst. Ein stetes Brummen in den Lautsprechern, dessen Ursprung ich aufgrund seiner Charakteristik nicht im Filmmaterial selbst verorten möchte, war ebenso wahrnehmbar. Kurz und knapp: Was UCI als Ehrdarbietung ankündigte, war bestenfalls lieblos, eigentlich schon eher eine Beleidigung.
 Auch die Filmrolle selbst war nicht von bester Qualität, doch das kann man wohl nachsehen, zumal ich der Auffassung bin, dass "digitally restored" zumindest im Kino alten Filmen nicht selten (aber auch: nicht immer) die Patina nimmt. Die spezifischen Charakteristika in Würde gealterten Filmmaterials vermag einer Sichtung durchaus zum Positiven zu gereichen, so auch, weitgehend, hier. Ein Stückwerk aus zwei Quellen war die Kopie wohl, zumindest tauchte ein Gelbstich immer mal wieder einige Sequenzen lang auf, auch der Ton variierte in Aussteuerung und Qualität, was, vor allem in den auditiv besonders drastischen Szenen, für einige schreckhaft zugehaltene Gehörgänge im Saal sorgte. Im wesentlichen aber unterstrich das alte Material den melancholischen und nostalgischen Charakter des Films und seiner Erzählung.
Auch die Filmrolle selbst war nicht von bester Qualität, doch das kann man wohl nachsehen, zumal ich der Auffassung bin, dass "digitally restored" zumindest im Kino alten Filmen nicht selten (aber auch: nicht immer) die Patina nimmt. Die spezifischen Charakteristika in Würde gealterten Filmmaterials vermag einer Sichtung durchaus zum Positiven zu gereichen, so auch, weitgehend, hier. Ein Stückwerk aus zwei Quellen war die Kopie wohl, zumindest tauchte ein Gelbstich immer mal wieder einige Sequenzen lang auf, auch der Ton variierte in Aussteuerung und Qualität, was, vor allem in den auditiv besonders drastischen Szenen, für einige schreckhaft zugehaltene Gehörgänge im Saal sorgte. Im wesentlichen aber unterstrich das alte Material den melancholischen und nostalgischen Charakter des Films und seiner Erzählung.
 Und dennoch, trotz aller Widrigkeiten, die uns den Abend versauen wollten (dazu zählt auch unser angewiesene Platz in der letzten Reihe trotz Reservierung tags zuvor, den wir aber todesmutig ignorierten, um uns in die dritte Reihe zu setzen, sowie ein stellenweise beinahe schon arg geschwätziges Publikum), war es gut, diesen Film endlich auch auf einer Leinwand gesehen zu haben. Diese benötigt der Film wie der Mensch die Luft zum Atmen, wie's mir scheint. Die schier unglaubliche Dynamik, die Leone seinen Bildern durch die stete Verquickung von Bewegungsabläufen in der Bildhorizontalen und in die Tiefe des Raums verleiht, ist auf Konserve bestenfalls konstatierbar, kaum aber emphatisch nachvollziehbar. Großartig ist es, wenn der Zug über einen hinwegrollt, wenn Cheyenne Harmonica in der Bar weit draußen in der Ödnis, trifft, wenn Frank in Harmonicas Erinnerung, im Unschärfebereich der Kamera grotesk verfremdet, nach vorne tritt, sich langsam aber sicher manifestiert. Wenn ein Augenpaar die Leinwand zur Gänze ausfüllt und Morricone die verzweifeltsten Töne seines gesamten Werks erklingen lässt.
Und dennoch, trotz aller Widrigkeiten, die uns den Abend versauen wollten (dazu zählt auch unser angewiesene Platz in der letzten Reihe trotz Reservierung tags zuvor, den wir aber todesmutig ignorierten, um uns in die dritte Reihe zu setzen, sowie ein stellenweise beinahe schon arg geschwätziges Publikum), war es gut, diesen Film endlich auch auf einer Leinwand gesehen zu haben. Diese benötigt der Film wie der Mensch die Luft zum Atmen, wie's mir scheint. Die schier unglaubliche Dynamik, die Leone seinen Bildern durch die stete Verquickung von Bewegungsabläufen in der Bildhorizontalen und in die Tiefe des Raums verleiht, ist auf Konserve bestenfalls konstatierbar, kaum aber emphatisch nachvollziehbar. Großartig ist es, wenn der Zug über einen hinwegrollt, wenn Cheyenne Harmonica in der Bar weit draußen in der Ödnis, trifft, wenn Frank in Harmonicas Erinnerung, im Unschärfebereich der Kamera grotesk verfremdet, nach vorne tritt, sich langsam aber sicher manifestiert. Wenn ein Augenpaar die Leinwand zur Gänze ausfüllt und Morricone die verzweifeltsten Töne seines gesamten Werks erklingen lässt.
Gänsehaut ist gar kein Ausdruck. Selten in meinem Leben hatte ich meinen eigenen Körper im Kino so vergessen wie hier, lediglich meine erste Kinosichtung von Kubricks 2001 übertraf dies noch. In diesen Bildern für einen kurzem Moment lang leben zu können, dafür muss man Leone, diesem idealistischen, visionären Cineasten, auf ewig dankbar sein. Bedauernswert, dass es nicht die ganz große Leinwand für dieses Epos sein durfte. Die letzte Kinosichtung bleibt dies aber unter Garantie nicht - ich hoffe auf die Freunde am Potsdamer Platz (Nachtrag aus dem Jahr 2006: Der Wunsch wurde mittlerweile erhört; wie wundervoll ist es doch, diesen Film in einer Stätte der Filmkunst sehen zu können und obendrein von einer qualitativ vernünftigen Kopie).
imdb | rottentomatoes | mrqe
 Das traurige vorweg: Wer bereits Wochen im Vorfeld eine einmalige Sondervorführung "zu Ehren" eines Klassikers ankündigt, sollte meines Erachtens auch willens und fähig sein, den Film in würdevollen Umständen zu präsentieren. Zwar war mit dem Zoo Palast eines der altehrwürdigsten Kinos Berlins - auch wenn daran im Innern, der Multiplexisierung sei Dank, kaum noch was erinnert - als Spielstätte angekündigt, doch leider verbannte man dieses Juwel in den hintersten und kleinsten Saal. Dieser ist nun, rein von den Gegebenheiten her, bestenfalls eine einzige Hasstirade gegen die Kinokultur: Eine Leinwand, die kaum größer ist als die vom Friedrichshainer Intimes, ungewöhnlich hoch aufgehängt obendrein, und der Saal dafür elend lang. Wer ab Mitte hinten sitzt hat vermutlich auf seinem Fernseher zuhause, sofern der nicht ganz dem Briefmarken-Spektrum zuzurechnen ist, ein größeres Bild. Beinahe schon grotesk dann der Umstand, dass die Senkung im Saal nach etwa Dreiviertel einen Scheitelpunkt erreicht und die vorderen Sitze sich somit wieder durch eine Steigung auszeichnen. Wer es an der Kasse mit einem besonders ungnädigen Mitarbeiter zu tun hatte, findet sich unter Umständen also mitten im Graben wieder. Und die Leinwand selbst ließ bereits noch vor der Werbung erkennen, dass sie, sollte nicht noch zusätzlich kaschiert, das Bild also noch kleiner gemacht werden als es eh schon war, kaum in der Lage sein würde, Leones Breitbildepos im richtigen Format abzustrahlen. Allzu viel fehlte zwar nicht, doch hier und da - vor allem im Showdown - wurde einem die Beschneidung doch schmerzlich bewusst. Ein stetes Brummen in den Lautsprechern, dessen Ursprung ich aufgrund seiner Charakteristik nicht im Filmmaterial selbst verorten möchte, war ebenso wahrnehmbar. Kurz und knapp: Was UCI als Ehrdarbietung ankündigte, war bestenfalls lieblos, eigentlich schon eher eine Beleidigung.
Das traurige vorweg: Wer bereits Wochen im Vorfeld eine einmalige Sondervorführung "zu Ehren" eines Klassikers ankündigt, sollte meines Erachtens auch willens und fähig sein, den Film in würdevollen Umständen zu präsentieren. Zwar war mit dem Zoo Palast eines der altehrwürdigsten Kinos Berlins - auch wenn daran im Innern, der Multiplexisierung sei Dank, kaum noch was erinnert - als Spielstätte angekündigt, doch leider verbannte man dieses Juwel in den hintersten und kleinsten Saal. Dieser ist nun, rein von den Gegebenheiten her, bestenfalls eine einzige Hasstirade gegen die Kinokultur: Eine Leinwand, die kaum größer ist als die vom Friedrichshainer Intimes, ungewöhnlich hoch aufgehängt obendrein, und der Saal dafür elend lang. Wer ab Mitte hinten sitzt hat vermutlich auf seinem Fernseher zuhause, sofern der nicht ganz dem Briefmarken-Spektrum zuzurechnen ist, ein größeres Bild. Beinahe schon grotesk dann der Umstand, dass die Senkung im Saal nach etwa Dreiviertel einen Scheitelpunkt erreicht und die vorderen Sitze sich somit wieder durch eine Steigung auszeichnen. Wer es an der Kasse mit einem besonders ungnädigen Mitarbeiter zu tun hatte, findet sich unter Umständen also mitten im Graben wieder. Und die Leinwand selbst ließ bereits noch vor der Werbung erkennen, dass sie, sollte nicht noch zusätzlich kaschiert, das Bild also noch kleiner gemacht werden als es eh schon war, kaum in der Lage sein würde, Leones Breitbildepos im richtigen Format abzustrahlen. Allzu viel fehlte zwar nicht, doch hier und da - vor allem im Showdown - wurde einem die Beschneidung doch schmerzlich bewusst. Ein stetes Brummen in den Lautsprechern, dessen Ursprung ich aufgrund seiner Charakteristik nicht im Filmmaterial selbst verorten möchte, war ebenso wahrnehmbar. Kurz und knapp: Was UCI als Ehrdarbietung ankündigte, war bestenfalls lieblos, eigentlich schon eher eine Beleidigung. Auch die Filmrolle selbst war nicht von bester Qualität, doch das kann man wohl nachsehen, zumal ich der Auffassung bin, dass "digitally restored" zumindest im Kino alten Filmen nicht selten (aber auch: nicht immer) die Patina nimmt. Die spezifischen Charakteristika in Würde gealterten Filmmaterials vermag einer Sichtung durchaus zum Positiven zu gereichen, so auch, weitgehend, hier. Ein Stückwerk aus zwei Quellen war die Kopie wohl, zumindest tauchte ein Gelbstich immer mal wieder einige Sequenzen lang auf, auch der Ton variierte in Aussteuerung und Qualität, was, vor allem in den auditiv besonders drastischen Szenen, für einige schreckhaft zugehaltene Gehörgänge im Saal sorgte. Im wesentlichen aber unterstrich das alte Material den melancholischen und nostalgischen Charakter des Films und seiner Erzählung.
Auch die Filmrolle selbst war nicht von bester Qualität, doch das kann man wohl nachsehen, zumal ich der Auffassung bin, dass "digitally restored" zumindest im Kino alten Filmen nicht selten (aber auch: nicht immer) die Patina nimmt. Die spezifischen Charakteristika in Würde gealterten Filmmaterials vermag einer Sichtung durchaus zum Positiven zu gereichen, so auch, weitgehend, hier. Ein Stückwerk aus zwei Quellen war die Kopie wohl, zumindest tauchte ein Gelbstich immer mal wieder einige Sequenzen lang auf, auch der Ton variierte in Aussteuerung und Qualität, was, vor allem in den auditiv besonders drastischen Szenen, für einige schreckhaft zugehaltene Gehörgänge im Saal sorgte. Im wesentlichen aber unterstrich das alte Material den melancholischen und nostalgischen Charakter des Films und seiner Erzählung. Und dennoch, trotz aller Widrigkeiten, die uns den Abend versauen wollten (dazu zählt auch unser angewiesene Platz in der letzten Reihe trotz Reservierung tags zuvor, den wir aber todesmutig ignorierten, um uns in die dritte Reihe zu setzen, sowie ein stellenweise beinahe schon arg geschwätziges Publikum), war es gut, diesen Film endlich auch auf einer Leinwand gesehen zu haben. Diese benötigt der Film wie der Mensch die Luft zum Atmen, wie's mir scheint. Die schier unglaubliche Dynamik, die Leone seinen Bildern durch die stete Verquickung von Bewegungsabläufen in der Bildhorizontalen und in die Tiefe des Raums verleiht, ist auf Konserve bestenfalls konstatierbar, kaum aber emphatisch nachvollziehbar. Großartig ist es, wenn der Zug über einen hinwegrollt, wenn Cheyenne Harmonica in der Bar weit draußen in der Ödnis, trifft, wenn Frank in Harmonicas Erinnerung, im Unschärfebereich der Kamera grotesk verfremdet, nach vorne tritt, sich langsam aber sicher manifestiert. Wenn ein Augenpaar die Leinwand zur Gänze ausfüllt und Morricone die verzweifeltsten Töne seines gesamten Werks erklingen lässt.
Und dennoch, trotz aller Widrigkeiten, die uns den Abend versauen wollten (dazu zählt auch unser angewiesene Platz in der letzten Reihe trotz Reservierung tags zuvor, den wir aber todesmutig ignorierten, um uns in die dritte Reihe zu setzen, sowie ein stellenweise beinahe schon arg geschwätziges Publikum), war es gut, diesen Film endlich auch auf einer Leinwand gesehen zu haben. Diese benötigt der Film wie der Mensch die Luft zum Atmen, wie's mir scheint. Die schier unglaubliche Dynamik, die Leone seinen Bildern durch die stete Verquickung von Bewegungsabläufen in der Bildhorizontalen und in die Tiefe des Raums verleiht, ist auf Konserve bestenfalls konstatierbar, kaum aber emphatisch nachvollziehbar. Großartig ist es, wenn der Zug über einen hinwegrollt, wenn Cheyenne Harmonica in der Bar weit draußen in der Ödnis, trifft, wenn Frank in Harmonicas Erinnerung, im Unschärfebereich der Kamera grotesk verfremdet, nach vorne tritt, sich langsam aber sicher manifestiert. Wenn ein Augenpaar die Leinwand zur Gänze ausfüllt und Morricone die verzweifeltsten Töne seines gesamten Werks erklingen lässt.Gänsehaut ist gar kein Ausdruck. Selten in meinem Leben hatte ich meinen eigenen Körper im Kino so vergessen wie hier, lediglich meine erste Kinosichtung von Kubricks 2001 übertraf dies noch. In diesen Bildern für einen kurzem Moment lang leben zu können, dafür muss man Leone, diesem idealistischen, visionären Cineasten, auf ewig dankbar sein. Bedauernswert, dass es nicht die ganz große Leinwand für dieses Epos sein durfte. Die letzte Kinosichtung bleibt dies aber unter Garantie nicht - ich hoffe auf die Freunde am Potsdamer Platz (Nachtrag aus dem Jahr 2006: Der Wunsch wurde mittlerweile erhört; wie wundervoll ist es doch, diesen Film in einer Stätte der Filmkunst sehen zu können und obendrein von einer qualitativ vernünftigen Kopie).
imdb | rottentomatoes | mrqe
° ° °
Thema: Alltag, medial gedoppelt
24. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Alleine durch den Volkspark Friedrichshain getappt, strahlender Sonnenschein, buntes Laub - das will genutzt sein! Ein Buch hatte ich mir mitgenommen, den Arnheim aus dem Suhrkamp, irgendwo wollte ich mich niederlassen.
Ob's nun an den wehmütigen Erinnerungen an die unglaubliche Sanft- und Schönheit des Central Parks im Juni lag oder an etwas völlig anderem, aufgefallen ist mir jedenfalls, wie sehr der Park doch ein "Durchgeh"-Park ist, wie wenig - ganz im Gegensatz zur New Yorker Grünanlage, die ich am liebsten am Boden sitzend durchquert hätte - Park der Muse und verträumten Zeit. Kaum eine Ecke jedenfalls, die mich zum Verbleib eingeladen hätte, keine Parkbank, die "wie für mich bestimmt" schien (ich bin bei sowas gern romantisch).
Gewiss, von den mir bekannten ist der Friedrichshainer sicher einer der schönsten Parks Berlins. Und ich will ihn auch gar nicht schlecht reden. Ich lief so vor mich hin, führte - wie ich bei Arnheim später noch lesen sollte - "zweckfreie Betrachtungen" durch, erklomm die verschiedenen Gipfel der Anlage, von denen ich nicht weiß, wieviele es gibt und ob ich bereits alle entdeckt habe. Nur eben hinsetzen wollte ich mich, zunächst, nirgends.
Später dann aber doch, unweit der schönsten Ecke des Parks, an einem kleinen, angelegten See, der, bezeichnend eigentlich, hässlich umzäunt war, ein Schild: "Vorsicht Baustelle", die freilich nirgends zu erblicken war. Einen Moment lang überlegte ich, ob die Umzäunung einfach umgehen und mich ganz patzig in diese sinnfrei weggesperrte Ecke setzen sollte - es wäre ein Leichtes gewesen, da die Umzäung bereits wenige Meter abseits des Weges endete, einfach so.
Ein so sanfter Tag ist indes keiner der jugendlichen Renitenz, deswegen ließ ich es auf sich beruhen, setzte mich ein paar Schritte weiter endlich auf eine Parkbank und begann zu schmökern, lediglich abgelenkt von einem eher weniger nett anzuschauenden, jungen Pärchen eine Bank weiter, das sich gegenseitig mit dem Handy knipste, welches, ungelogen, jeden Schuss mit dem gesampelten "Klick" eines Fotoapparates quittierte. Bald dann also weiter, durch's Laub, ein bis dahin noch unbekanntes ganz bezauberndes Fleckchen aufgetan, mit Bank sogar, das ich in Zukunft direkt als Örtchen für die ungestörte Lektüre ansteuern werde. Ein paar Sorgen vergessen, für kurze Zeit zumindest. Manchmal tut das allein schon gut. Gedanken gedacht, auf dem Heimweg dann Marzipankartoffeln.
Ob's nun an den wehmütigen Erinnerungen an die unglaubliche Sanft- und Schönheit des Central Parks im Juni lag oder an etwas völlig anderem, aufgefallen ist mir jedenfalls, wie sehr der Park doch ein "Durchgeh"-Park ist, wie wenig - ganz im Gegensatz zur New Yorker Grünanlage, die ich am liebsten am Boden sitzend durchquert hätte - Park der Muse und verträumten Zeit. Kaum eine Ecke jedenfalls, die mich zum Verbleib eingeladen hätte, keine Parkbank, die "wie für mich bestimmt" schien (ich bin bei sowas gern romantisch).
Gewiss, von den mir bekannten ist der Friedrichshainer sicher einer der schönsten Parks Berlins. Und ich will ihn auch gar nicht schlecht reden. Ich lief so vor mich hin, führte - wie ich bei Arnheim später noch lesen sollte - "zweckfreie Betrachtungen" durch, erklomm die verschiedenen Gipfel der Anlage, von denen ich nicht weiß, wieviele es gibt und ob ich bereits alle entdeckt habe. Nur eben hinsetzen wollte ich mich, zunächst, nirgends.
Später dann aber doch, unweit der schönsten Ecke des Parks, an einem kleinen, angelegten See, der, bezeichnend eigentlich, hässlich umzäunt war, ein Schild: "Vorsicht Baustelle", die freilich nirgends zu erblicken war. Einen Moment lang überlegte ich, ob die Umzäunung einfach umgehen und mich ganz patzig in diese sinnfrei weggesperrte Ecke setzen sollte - es wäre ein Leichtes gewesen, da die Umzäung bereits wenige Meter abseits des Weges endete, einfach so.
Ein so sanfter Tag ist indes keiner der jugendlichen Renitenz, deswegen ließ ich es auf sich beruhen, setzte mich ein paar Schritte weiter endlich auf eine Parkbank und begann zu schmökern, lediglich abgelenkt von einem eher weniger nett anzuschauenden, jungen Pärchen eine Bank weiter, das sich gegenseitig mit dem Handy knipste, welches, ungelogen, jeden Schuss mit dem gesampelten "Klick" eines Fotoapparates quittierte. Bald dann also weiter, durch's Laub, ein bis dahin noch unbekanntes ganz bezauberndes Fleckchen aufgetan, mit Bank sogar, das ich in Zukunft direkt als Örtchen für die ungestörte Lektüre ansteuern werde. Ein paar Sorgen vergessen, für kurze Zeit zumindest. Manchmal tut das allein schon gut. Gedanken gedacht, auf dem Heimweg dann Marzipankartoffeln.
° ° °
Thema: Alltag, medial gedoppelt
Wenn man sich mal den dreisten Luxus der Perspektive eines äußeren Beobachters leisten mag, dann ist der Kapitalismus eigentlich wohl nicht mehr ernst zu nehmen. Trash-Entertainment, bestenfalls.
Ein Beispiel: Seit September gibt's im Edeka nebenan wieder allerlei Weihnachtsgebäck, natürlich auch Marzipankartoffeln. Den abgehangenen Spruch von wegen "wird auch jedes Jahr früher" spar' ich mir einfach, das ist was für Leute, die sich, meist ohne Erfolg, gerne als smart verkaufen (und vermutlich sind die eh mit denen identisch, die im Kino nach der Werbung, wenn nochmal das Licht vor dem Film angeht, lautstark feixen, dass das echt ein prima Film gewesen sei). Ich mag Marzipankartoffeln sehr gerne, die darf es ruhig das ganze Jahr geben.
Kommen wir zum Punkt: Die Marzipankartoffeln gibt's nämlich in verschiedenen Stückzahleinheiten, wie ja fast eigentlich alles. Die kleinstmögliche Einheit besteht aus 125 Gramm zu 49 Cent und diese soll im weiteren als Bezugsgröße dienen. Die nächstmögliche Einheit schlägt bereits mit 50 Cent mehr zu Buche, für - aufgemerkt! - 75 Gramm mehr Inhalt. Na hoppla, denkt man sich da vielleicht, dann käme ja zweimal die kleinste Einheit nicht nur einen Cent billiger, nein, man hätte auch noch 50 Gramm mehr Naturalien im Wanst! Linienbewusste Völlerer mögen für sich diesen Umstand vielleicht noch damit aus der Welt schaffen, dass 1 Cent nun wirklich keinen arm mache, und man vielleicht auch gar nicht gleich den Drang nach einem Viertel Kilo Marzipan verspüre, sondern auch gerne mal mit etwas weniger Vorlieb nähme. Grotesk aber wird's, wendet man sich, eh schon verwundert, dem dritten Konsummodell zu: 500 Gramm Marzipan in einer wabbeligen Plastikdose für 2,99 Euro! Man muss noch nicht einmal den Taschenrechner bemühen, um festzustellen, dass dem 4 mal die kleinste Einheit im Inhalt zwar gleichkommt, dem Geldbeutel aber mehr als 1 Euro Ersparnis einbringt.
Was will uns good ol' Märchenonkel Kapitalismus nun damit also erzählen? Dass Geld ausgegeben nicht nur geil ist, sondern auch irre sexy, das ist ja nun gewissermaßen eine der konstituierenden Grunderzählungen, das kann's also nun nicht sein. Was also dann? Dass das in Zeiten der Krise und der Rezession für arme Schweine ungemein beruhigende Gefühl, auch einmal der zu sein, der zur größten Packung gegriffen hat, bereits für schlanke 50 Prozent Aufpreis zu haben ist? Oder aber, dass sich Zielgruppe und Kapitalismus mittlerweile derart selbst gegenseitig degeneriert haben, dass einfach nur noch alles scheißegal, "Angebot und Nachfrage" eh nur noch ein Ammenmärchen und "Pisa" nicht nur Symptom, sondern eigentlich schon Zustand ist?
Ich sach ja: Trash eben! Und ich gebe gerne zu: Beim ersten Mal hatte ich auch beherzt zur großen Dose gegriffen (nur um mich nach dem nächsten Besuch einen Tag lang nicht mehr im Spiegel ansehen zu können): Die äußere Perspektive ist eben doch nur Illusion.
Ein Beispiel: Seit September gibt's im Edeka nebenan wieder allerlei Weihnachtsgebäck, natürlich auch Marzipankartoffeln. Den abgehangenen Spruch von wegen "wird auch jedes Jahr früher" spar' ich mir einfach, das ist was für Leute, die sich, meist ohne Erfolg, gerne als smart verkaufen (und vermutlich sind die eh mit denen identisch, die im Kino nach der Werbung, wenn nochmal das Licht vor dem Film angeht, lautstark feixen, dass das echt ein prima Film gewesen sei). Ich mag Marzipankartoffeln sehr gerne, die darf es ruhig das ganze Jahr geben.
Kommen wir zum Punkt: Die Marzipankartoffeln gibt's nämlich in verschiedenen Stückzahleinheiten, wie ja fast eigentlich alles. Die kleinstmögliche Einheit besteht aus 125 Gramm zu 49 Cent und diese soll im weiteren als Bezugsgröße dienen. Die nächstmögliche Einheit schlägt bereits mit 50 Cent mehr zu Buche, für - aufgemerkt! - 75 Gramm mehr Inhalt. Na hoppla, denkt man sich da vielleicht, dann käme ja zweimal die kleinste Einheit nicht nur einen Cent billiger, nein, man hätte auch noch 50 Gramm mehr Naturalien im Wanst! Linienbewusste Völlerer mögen für sich diesen Umstand vielleicht noch damit aus der Welt schaffen, dass 1 Cent nun wirklich keinen arm mache, und man vielleicht auch gar nicht gleich den Drang nach einem Viertel Kilo Marzipan verspüre, sondern auch gerne mal mit etwas weniger Vorlieb nähme. Grotesk aber wird's, wendet man sich, eh schon verwundert, dem dritten Konsummodell zu: 500 Gramm Marzipan in einer wabbeligen Plastikdose für 2,99 Euro! Man muss noch nicht einmal den Taschenrechner bemühen, um festzustellen, dass dem 4 mal die kleinste Einheit im Inhalt zwar gleichkommt, dem Geldbeutel aber mehr als 1 Euro Ersparnis einbringt.
Was will uns good ol' Märchenonkel Kapitalismus nun damit also erzählen? Dass Geld ausgegeben nicht nur geil ist, sondern auch irre sexy, das ist ja nun gewissermaßen eine der konstituierenden Grunderzählungen, das kann's also nun nicht sein. Was also dann? Dass das in Zeiten der Krise und der Rezession für arme Schweine ungemein beruhigende Gefühl, auch einmal der zu sein, der zur größten Packung gegriffen hat, bereits für schlanke 50 Prozent Aufpreis zu haben ist? Oder aber, dass sich Zielgruppe und Kapitalismus mittlerweile derart selbst gegenseitig degeneriert haben, dass einfach nur noch alles scheißegal, "Angebot und Nachfrage" eh nur noch ein Ammenmärchen und "Pisa" nicht nur Symptom, sondern eigentlich schon Zustand ist?
Ich sach ja: Trash eben! Und ich gebe gerne zu: Beim ersten Mal hatte ich auch beherzt zur großen Dose gegriffen (nur um mich nach dem nächsten Besuch einen Tag lang nicht mehr im Spiegel ansehen zu können): Die äußere Perspektive ist eben doch nur Illusion.
° ° °
Thema: ad personam
24. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Filmtagebuch
23. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
22.10., Heimkino
Verwirrender Film. Irgendwo zwischen "Geht ja wohl gar nicht!", "Was für ein fader Affenzirkus!" und "So unbekümmert bescheuert, dass es prächtig unterhält!".
 Die Handlung ist natürlich bestenfalls hanebüchen und orientiert sich strukturell an den Vorgaben klassischer Serials: Zu Beginn ist's vollkommen anders als am Ende des vorangegangenen Teils, mit ein paar wenig erklärenden Worten wird das so als Faktum verkauft. Katastrophal wird's, wenn sich das Drehbuch selbst ad absurdum führt und sich vollkommen willkürlich entwickelt: Das blutdurchtränkte Hemd wird nicht weggeschmissen, der Eco-Aktivist klaut - warum auch immer - in recht prekären Situationen lebensrettende Kugeln aus einem Gewehr (was so brutal suggestiv angedeutet wird, dass nur verwundern würde, wenn er die Kugeln dann doch nicht entwendet hätte), nur um wenig später die Dinos selbst "Mistviecher" zu nennen, ein T-Rex-Baby wird einfach so mitgenommen, um es zu verarzten, obwohl man eigentlich weiß, dass das saudämlich ist, wenn die Eltern nicht allzu weit weg sein können, eine Tochter taucht plötzlich auf, die Tyrannosauri (heißt das so?) sind ebenso plötzlich wieder da, obwohl sie doch schon wieder weg waren, warum also, ja warum eigentlich usw. usf.
Die Handlung ist natürlich bestenfalls hanebüchen und orientiert sich strukturell an den Vorgaben klassischer Serials: Zu Beginn ist's vollkommen anders als am Ende des vorangegangenen Teils, mit ein paar wenig erklärenden Worten wird das so als Faktum verkauft. Katastrophal wird's, wenn sich das Drehbuch selbst ad absurdum führt und sich vollkommen willkürlich entwickelt: Das blutdurchtränkte Hemd wird nicht weggeschmissen, der Eco-Aktivist klaut - warum auch immer - in recht prekären Situationen lebensrettende Kugeln aus einem Gewehr (was so brutal suggestiv angedeutet wird, dass nur verwundern würde, wenn er die Kugeln dann doch nicht entwendet hätte), nur um wenig später die Dinos selbst "Mistviecher" zu nennen, ein T-Rex-Baby wird einfach so mitgenommen, um es zu verarzten, obwohl man eigentlich weiß, dass das saudämlich ist, wenn die Eltern nicht allzu weit weg sein können, eine Tochter taucht plötzlich auf, die Tyrannosauri (heißt das so?) sind ebenso plötzlich wieder da, obwohl sie doch schon wieder weg waren, warum also, ja warum eigentlich usw. usf.
Nicht zu vergessen natürlich: die Dialoge! Diese werden noch zusätzlich durch eine kräftig in die Binsen gegangene Synchronisation kompromittiert. Wenn Jeff Goldblum sich den Fuß verknackst und dabei unheimlich affektiert: "Aua, Aua!" statt "AAAARGH!" schreit, wenn das kleine Mädchen naiv in größter Panik feststellt: "Ich bin ja so dumm!" oder Goldblum, den Tod in Form eines Abgrunds unmittelbar vor Augen, seinen Kollegen anfleht, doch bitte an "das Satellitentelefon" ("Ach, Schatz, reich mir doch bitte mal die Fernbedienung für das Widescreen-Tv-Gerät!") zu denken, dann ist das alles eigentlich nur noch Realsatire und in der Tat das unterhaltsamste am Film. Es gäbe natürlich noch so einiges mehr aufzuzählen, allein die Erinnerung, sie schwindet bereits.
Mag natürlich am Alter liegen, aber wirklich überzeugen wollen die Special-Effects und die Karambolagen-Szenen nicht. Und, wenn man schon keine künstlerischen Ansprüche stellt, dann sollten die doch das eigentliche Spectaculum eines solchen Films ausmachen. Es ist aber vielleicht auch die Crux digitaler Phantasmagorien, dass sie, im Gegensatz zum analogen Handwerk, eine unheimlich schnelle Halbwertszeit aufweisen und jenseits dessen kaum nostalgischen Charme entwickeln. Da ist mir etwa Caprona, der narrativ ähnlich unbeholfene "Lost-World"-Klassiker der britischen Amicus-Studios aus den Siebzigern, auf dieser Ebene noch immer weitaus willkommener. Jedenfalls schaue ich mir lieber verkorkste Styropor- und Pappmaché-Dinos an als zwar detailreich und professionell animierte Digi-Dinos, denen, trotz allen offensichtlichen Rechneraufwands, doch irgendwie noch immer das Stigma der digitalen Frühzeitigkeit anhaftet. Aber dahingehend konnte mich bislang eh bloß Jacksons Ringe-Trilogie überzeugen.
imdb | rottentomatoes | mrqe
Verwirrender Film. Irgendwo zwischen "Geht ja wohl gar nicht!", "Was für ein fader Affenzirkus!" und "So unbekümmert bescheuert, dass es prächtig unterhält!".
 Die Handlung ist natürlich bestenfalls hanebüchen und orientiert sich strukturell an den Vorgaben klassischer Serials: Zu Beginn ist's vollkommen anders als am Ende des vorangegangenen Teils, mit ein paar wenig erklärenden Worten wird das so als Faktum verkauft. Katastrophal wird's, wenn sich das Drehbuch selbst ad absurdum führt und sich vollkommen willkürlich entwickelt: Das blutdurchtränkte Hemd wird nicht weggeschmissen, der Eco-Aktivist klaut - warum auch immer - in recht prekären Situationen lebensrettende Kugeln aus einem Gewehr (was so brutal suggestiv angedeutet wird, dass nur verwundern würde, wenn er die Kugeln dann doch nicht entwendet hätte), nur um wenig später die Dinos selbst "Mistviecher" zu nennen, ein T-Rex-Baby wird einfach so mitgenommen, um es zu verarzten, obwohl man eigentlich weiß, dass das saudämlich ist, wenn die Eltern nicht allzu weit weg sein können, eine Tochter taucht plötzlich auf, die Tyrannosauri (heißt das so?) sind ebenso plötzlich wieder da, obwohl sie doch schon wieder weg waren, warum also, ja warum eigentlich usw. usf.
Die Handlung ist natürlich bestenfalls hanebüchen und orientiert sich strukturell an den Vorgaben klassischer Serials: Zu Beginn ist's vollkommen anders als am Ende des vorangegangenen Teils, mit ein paar wenig erklärenden Worten wird das so als Faktum verkauft. Katastrophal wird's, wenn sich das Drehbuch selbst ad absurdum führt und sich vollkommen willkürlich entwickelt: Das blutdurchtränkte Hemd wird nicht weggeschmissen, der Eco-Aktivist klaut - warum auch immer - in recht prekären Situationen lebensrettende Kugeln aus einem Gewehr (was so brutal suggestiv angedeutet wird, dass nur verwundern würde, wenn er die Kugeln dann doch nicht entwendet hätte), nur um wenig später die Dinos selbst "Mistviecher" zu nennen, ein T-Rex-Baby wird einfach so mitgenommen, um es zu verarzten, obwohl man eigentlich weiß, dass das saudämlich ist, wenn die Eltern nicht allzu weit weg sein können, eine Tochter taucht plötzlich auf, die Tyrannosauri (heißt das so?) sind ebenso plötzlich wieder da, obwohl sie doch schon wieder weg waren, warum also, ja warum eigentlich usw. usf.Nicht zu vergessen natürlich: die Dialoge! Diese werden noch zusätzlich durch eine kräftig in die Binsen gegangene Synchronisation kompromittiert. Wenn Jeff Goldblum sich den Fuß verknackst und dabei unheimlich affektiert: "Aua, Aua!" statt "AAAARGH!" schreit, wenn das kleine Mädchen naiv in größter Panik feststellt: "Ich bin ja so dumm!" oder Goldblum, den Tod in Form eines Abgrunds unmittelbar vor Augen, seinen Kollegen anfleht, doch bitte an "das Satellitentelefon" ("Ach, Schatz, reich mir doch bitte mal die Fernbedienung für das Widescreen-Tv-Gerät!") zu denken, dann ist das alles eigentlich nur noch Realsatire und in der Tat das unterhaltsamste am Film. Es gäbe natürlich noch so einiges mehr aufzuzählen, allein die Erinnerung, sie schwindet bereits.
Mag natürlich am Alter liegen, aber wirklich überzeugen wollen die Special-Effects und die Karambolagen-Szenen nicht. Und, wenn man schon keine künstlerischen Ansprüche stellt, dann sollten die doch das eigentliche Spectaculum eines solchen Films ausmachen. Es ist aber vielleicht auch die Crux digitaler Phantasmagorien, dass sie, im Gegensatz zum analogen Handwerk, eine unheimlich schnelle Halbwertszeit aufweisen und jenseits dessen kaum nostalgischen Charme entwickeln. Da ist mir etwa Caprona, der narrativ ähnlich unbeholfene "Lost-World"-Klassiker der britischen Amicus-Studios aus den Siebzigern, auf dieser Ebene noch immer weitaus willkommener. Jedenfalls schaue ich mir lieber verkorkste Styropor- und Pappmaché-Dinos an als zwar detailreich und professionell animierte Digi-Dinos, denen, trotz allen offensichtlichen Rechneraufwands, doch irgendwie noch immer das Stigma der digitalen Frühzeitigkeit anhaftet. Aber dahingehend konnte mich bislang eh bloß Jacksons Ringe-Trilogie überzeugen.
imdb | rottentomatoes | mrqe
° ° °
Thema: ad personam
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
23. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
"Der Umsatz der christlichen Unterhaltungsindustrie hat inzwischen - beinahe unbemerkt - ein Jahresvolumen von rund 3 Milliarden Dollar erreicht und in einigen Bereichen die säkulare Konkurrenz bereits weit hinter sich gelassen. So verkauft sich beispielsweise die sogenannte CCM (Christian Contemporary Music) in den USA inzwischen etwa doppelt so gut wie die enorm populäre Latino-Musik - und erzielt einen grösseren Umsatz als Klassik und Jazz zusammen. Christliche Musiker wie die Ska-Band OC Supertones, der Rapper T-Bone oder der Hardcore- Rocker P.O.D. füllen ganze Stadien mit Jugendlichen, die T-Shirts tragen, auf denen «Kickin' It 4 Jesus» oder «Apostle Paul's Casual Wear» zu lesen ist. Ihr Superheld ist «Bibleman», welcher in der gleichnamigen Videofilmserie in Superman-ähnlichem Actionkostüm mit frommen Sprüchen gegen das Böse ficht. Kleinere Kinder lieben die «VeggieTales»-Videos, in denen ihnen tugendhaft daherredendes Gemüse christliche Moral schmackhaft machen soll. Diese haben sich millionenfach verkauft."
Gott möchte, dass sie reich werden.
Gott möchte, dass sie reich werden.
° ° °
Thema: Alltag, medial gedoppelt
23. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
Woher kommt das eigentlich? Ich mein, ich müsste wirklich einfach nur dort hin, zum Amt, und einen Antrag abgeben. Ganz einfach eigentlich, und dann noch "Tschüss" oder "Schönen Tag noch" sagen. Trotzdem verschlepp' ich das von einem Tag zum nächsten, immer wieder neue Ausreden, warum das heute eigentlich noch nicht Not tut, ich habe ja noch Zeit. So geht das schon seit Wochen. Letzte Nacht habe ich mich, in diesem Dämmerzustand kurz vor dem Einschlafen, sogar im Geiste dort gesehen - Mensch, was bin ich da aufgeschreckt, an Schlaf war zunächst nicht mehr zu denken! Ist das schon eine ausgewachsene Paranoia oder lediglich begründete Abneigung?
Heute oder morgen ist Stichtag, mittlerweile gilt's! Ich plädiere für heute, das Leben ist schlecht.
Heute oder morgen ist Stichtag, mittlerweile gilt's! Ich plädiere für heute, das Leben ist schlecht.
° ° °
Thema: Lesezeichen
Warum das Internet eine der großartigsten Erfindungen aller Zeiten ist, kann man hier nachvollziehen. Hunderte von Filmen, hauptsächlich aus dem "ephemeral" Bereich, können in diesem Archiv kostenfrei gestreamt oder auch in verschiedenen Formaten gedownloadet werden.
Danke an Inès vom Wohnzimmer für diesen prima Link. Mal schauen, inwiefern mir Charles Keating gleich darlegen kann, warum Pornografie mit der kommunistischen Verschwörung zusammen hängt - der Download läuft.
Danke an Inès vom Wohnzimmer für diesen prima Link. Mal schauen, inwiefern mir Charles Keating gleich darlegen kann, warum Pornografie mit der kommunistischen Verschwörung zusammen hängt - der Download läuft.
° ° °
Thema: Kinokultur
Der Ankündigung folgen Taten.
il est plus facile pour un chameau... bietet "wenig Platz zum emotionalen Andocken". allemagne neuf zéro benötigt "ein unglaubliches allgemeinwissen, vor allem aus den bereichen philosophie und geschichte", hat aber auch "einige türen aufgemacht". Das Kurzfilmprogramm 'reminiscences rückt "vergangenes und vergessenes (im historischen und privaten sinn) wieder in die sichtbarkeit" und aus dem Doku-Essay das wirst du nie verstehen kommt man " sehr nachdenklich wieder heraus" und führte Diskussionen mit "freunden am tag darauf, die [...] schnell ins weite feld von dokumentarfilmtheorien, den begriffen objektivität udn inszenierung, realität und fiktion" führten.
Weitere Rezensionen scheinen noch zu folgen, hier freut man sich auch weiterhin.
il est plus facile pour un chameau... bietet "wenig Platz zum emotionalen Andocken". allemagne neuf zéro benötigt "ein unglaubliches allgemeinwissen, vor allem aus den bereichen philosophie und geschichte", hat aber auch "einige türen aufgemacht". Das Kurzfilmprogramm 'reminiscences rückt "vergangenes und vergessenes (im historischen und privaten sinn) wieder in die sichtbarkeit" und aus dem Doku-Essay das wirst du nie verstehen kommt man " sehr nachdenklich wieder heraus" und führte Diskussionen mit "freunden am tag darauf, die [...] schnell ins weite feld von dokumentarfilmtheorien, den begriffen objektivität udn inszenierung, realität und fiktion" führten.
Weitere Rezensionen scheinen noch zu folgen, hier freut man sich auch weiterhin.
° ° °
Thema: ad personam
22. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
Einen Film wie Lars von Triers "Dogville" hat es in Europa noch nicht gegeben. Andreas Kilb in der FAZ (via Perlentaucher). Noch heute lesen, morgen vielleicht schon weg.
Auch eine sehr schöne Besprechung, allerdings schon was älter: Christoph Egger in der NZZ.
Auch eine sehr schöne Besprechung, allerdings schon was älter: Christoph Egger in der NZZ.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
22. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
18.10., Heimkino
Ich mag sowas ja: Letzte Filme großer Meister. Man kann die letzten Bilder immer so schön auf die Biografien anwenden und sich allerlei Feuilletonismen draus ableiten. Wie zB der schöne Satz in Chris Markers Film über Tarkowskij (eine kleine Kritik meinerseits hier), dass dessen Filmografie die einzige sei, die Platz zwischen zwei Bäumen fände. Und ist der letzte ausgesprochene Satz im Werk Kubricks nicht ganz bezeichnend?
 Der Traum des Professors, des Sensei, am Ende zeigt ihn als Jungen, der kindisch verschmitzt Versteck mit seinen Freunden spielt. Fasziniert blickt er dann in den Sonneuntergang, den wir nur erahnen können, denn er spinnt sich weiter zu einem prächtigen, psychedelischen Farbenspiel, in dem immer neue Formen und Kompositionen entstehen. Dass dies auch als Tod des sichtlich vom Alter gezeichneten Intellektuellen zu verstehen ist, bleibt zwar unausgesprochen, wird aber dennoch nahegelegt. Eine Liebeserklärung an Freundschaft, die Schönheit des Geistes, die Kultur und - nicht zuletzt, viel eher als logische Folge aus allem schon - die Fantasie.
Der Traum des Professors, des Sensei, am Ende zeigt ihn als Jungen, der kindisch verschmitzt Versteck mit seinen Freunden spielt. Fasziniert blickt er dann in den Sonneuntergang, den wir nur erahnen können, denn er spinnt sich weiter zu einem prächtigen, psychedelischen Farbenspiel, in dem immer neue Formen und Kompositionen entstehen. Dass dies auch als Tod des sichtlich vom Alter gezeichneten Intellektuellen zu verstehen ist, bleibt zwar unausgesprochen, wird aber dennoch nahegelegt. Eine Liebeserklärung an Freundschaft, die Schönheit des Geistes, die Kultur und - nicht zuletzt, viel eher als logische Folge aus allem schon - die Fantasie.
Kurosawa selbst starb fünf Jahre später. Das letzte Bild seines letztes Films hätte nicht treffender gewählt sein können.
imdb | rottentomatoes | mrqe
Ich mag sowas ja: Letzte Filme großer Meister. Man kann die letzten Bilder immer so schön auf die Biografien anwenden und sich allerlei Feuilletonismen draus ableiten. Wie zB der schöne Satz in Chris Markers Film über Tarkowskij (eine kleine Kritik meinerseits hier), dass dessen Filmografie die einzige sei, die Platz zwischen zwei Bäumen fände. Und ist der letzte ausgesprochene Satz im Werk Kubricks nicht ganz bezeichnend?
 Der Traum des Professors, des Sensei, am Ende zeigt ihn als Jungen, der kindisch verschmitzt Versteck mit seinen Freunden spielt. Fasziniert blickt er dann in den Sonneuntergang, den wir nur erahnen können, denn er spinnt sich weiter zu einem prächtigen, psychedelischen Farbenspiel, in dem immer neue Formen und Kompositionen entstehen. Dass dies auch als Tod des sichtlich vom Alter gezeichneten Intellektuellen zu verstehen ist, bleibt zwar unausgesprochen, wird aber dennoch nahegelegt. Eine Liebeserklärung an Freundschaft, die Schönheit des Geistes, die Kultur und - nicht zuletzt, viel eher als logische Folge aus allem schon - die Fantasie.
Der Traum des Professors, des Sensei, am Ende zeigt ihn als Jungen, der kindisch verschmitzt Versteck mit seinen Freunden spielt. Fasziniert blickt er dann in den Sonneuntergang, den wir nur erahnen können, denn er spinnt sich weiter zu einem prächtigen, psychedelischen Farbenspiel, in dem immer neue Formen und Kompositionen entstehen. Dass dies auch als Tod des sichtlich vom Alter gezeichneten Intellektuellen zu verstehen ist, bleibt zwar unausgesprochen, wird aber dennoch nahegelegt. Eine Liebeserklärung an Freundschaft, die Schönheit des Geistes, die Kultur und - nicht zuletzt, viel eher als logische Folge aus allem schon - die Fantasie.Kurosawa selbst starb fünf Jahre später. Das letzte Bild seines letztes Films hätte nicht treffender gewählt sein können.
imdb | rottentomatoes | mrqe
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
22. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
"Immer wieder wird klar, dass das Experiment Kino mit dem fertigen Film nicht beendet ist, dass das Schauen, Reflektieren, Erinnern ein wesentlicher Teil der Filmproduktion ist.", schreibt Fritz Göttler heute in der SZ, der auf der Viennale neue Filme und alte Bekannte gesehen hat. Dazu passt: Gestern selbst nochmals Kill Bill Vol.1 gesehen - daran könnte man sich gewöhnen.
° ° °
Thema: Hoerkino
21. Oktober 03 | Autor: immo | 0 Kommentare | Kommentieren
... und ganz legal von c:/. Was zum Hörgenießen zu vorgerückter Stunde. Empfohlen wird Track 1.
° ° °
