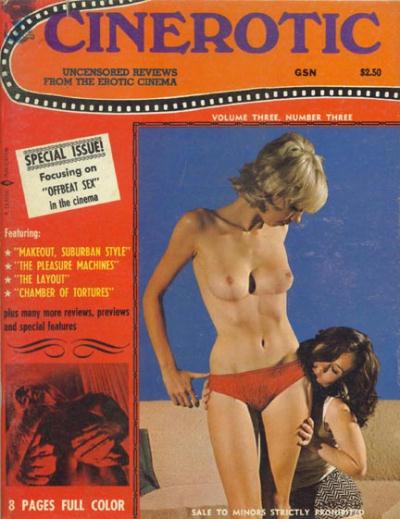Thema: Kinokultur
03. August 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Bereits begonnen, noch bis 18. August: Das Far-East-Festival im kleinen Filmkunst 66, unweit des Savignyplatzes. 44 Filme der letzten Jahre aus dem asiatischen Raum, darunter auch selten zu Sehendes wie etwa Tsui Harks grandioser Peking Opera Blues.
Im Tagesspiegel findet sich ein Artikel dazu.
Im Tagesspiegel findet sich ein Artikel dazu.
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
Artikel im Guardian über unvollendete Filme, darunter auch eine kleine Skizzierung von Orson Welles' Don-Quijote-Projekt, das Exploitationregisseur Jess Franco 1992 editierte, ergänzte und damals in Cannes uraufführte (mit eher mißbilligender Resonanz, aber das kann gut und gerne auch an Vorbehalten der Kulturschickeria gegenüber Francos Person und Werk liegen, ich selber kenne diese Fassung nicht).
° ° °
Thema: ad personam
02. August 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Am vergangenen Samstag wäre der italienische Genreregisseur Mario Bava 90 Jahre alt geworden. Als "italienischen Hitchcock" bezeichnet Bodo Traber den "Maestro of the Macabre" in seinem Artikel für die "Berliner Morgenpost", viel zu kurz natürlich um diesen von mir innig geliebten, und - wie Traber richtig schreibt - bis heute der breiten Masse kaum bekannten Regisseur vorzustellen oder gar zu würdigen. Aber immerhin.
 Bis heute ist die Filmografie Bavas eine kleine, zu ergründende Schatztruhe an liebevoll gemachten, formal vor allem auch aufgrund des Produktionshintergrunds oft ausgeklügelt inszenierten Genrefilmen. Noch lange nicht ist seine Filmografie auf Konserve erschlossen: Das macht die Suche spannend und es ist immer wieder eine Freude von einer neuen Veröffentlichung irgendwo auf der Welt zu hören. Wie ein Puzzlespiel, das nach und nach ein Bild zu erkennen gibt.
Bis heute ist die Filmografie Bavas eine kleine, zu ergründende Schatztruhe an liebevoll gemachten, formal vor allem auch aufgrund des Produktionshintergrunds oft ausgeklügelt inszenierten Genrefilmen. Noch lange nicht ist seine Filmografie auf Konserve erschlossen: Das macht die Suche spannend und es ist immer wieder eine Freude von einer neuen Veröffentlichung irgendwo auf der Welt zu hören. Wie ein Puzzlespiel, das nach und nach ein Bild zu erkennen gibt.
Bavas Filme sind vor allem optisch interessant. Wer mit der Lupe auf die Suche nach der narrativen Plausibilität geht, hat sich den Zugang schon versperrt. Bava, der aus der Malerei stammt, seine Arbeit in Cinecitta als Kameramann begann und eigentlich nur durch Zufall auf den Stuhl des Regisseurs bugsiert wurde, malte seine Filme in erster Linie und den kombinierten Möglichkeiten aus Dekors, Ausleuchtung und Kamera entlockte er manche aufregende Sequenz. Er drehte Filme nicht wegen einer Message, auch nicht in erster Linie um eine Geschichte zu erzählen. Film nahm er als eigenständige Kunstform wahr und lotete ihre formalen Möglichkeiten aus. Als Bühne diente ihm die reiche Bandbreite an Genrefilmen, die er als hermetisch-filmisches Universum begriff, vor allem aber schien er schon zu wissen, dass längst nicht mehr die Geschichte es ist, was zählt. Sondern die Art ihrer Erzählung, ihrer Inszenierung. Nicht alles ist gelungen, gewiss, vieles erzählt auf zweiter Ebene von mangelnden Budgets. Aber immer ist da dieser Wille zum Besonderen, zur filmischen Schönheit, zum sinnlichen Genuss.
Bava mag kommerzielle Filme gedreht haben. Aber er hatte dabei den Zuschauer im Sinn, den Zuschauer als bewussten Genießer ästhetischer Schauspiele. Ein Glücklicher ist, der das Blau, das Rot und das Grün aus Bavas Filmen kennen- und schätzen lernen konnte, der sich - dank qualitativ hervorragender DVDs - bis heute an der Kraft dieser Farben erfreuen kann. Eine Kraft, wie sie nur Bava diesen Farben zu entlocken vermochte.
Dafür Danke. Und alles Gute, caro Mario.
Ars Incubi - Das Mario Bava Archiv (Achtung, sehr "detaillierte" Inhaltsangaben bei den Filmkritiken!)
backlinks: Mario Bava
 Bis heute ist die Filmografie Bavas eine kleine, zu ergründende Schatztruhe an liebevoll gemachten, formal vor allem auch aufgrund des Produktionshintergrunds oft ausgeklügelt inszenierten Genrefilmen. Noch lange nicht ist seine Filmografie auf Konserve erschlossen: Das macht die Suche spannend und es ist immer wieder eine Freude von einer neuen Veröffentlichung irgendwo auf der Welt zu hören. Wie ein Puzzlespiel, das nach und nach ein Bild zu erkennen gibt.
Bis heute ist die Filmografie Bavas eine kleine, zu ergründende Schatztruhe an liebevoll gemachten, formal vor allem auch aufgrund des Produktionshintergrunds oft ausgeklügelt inszenierten Genrefilmen. Noch lange nicht ist seine Filmografie auf Konserve erschlossen: Das macht die Suche spannend und es ist immer wieder eine Freude von einer neuen Veröffentlichung irgendwo auf der Welt zu hören. Wie ein Puzzlespiel, das nach und nach ein Bild zu erkennen gibt.Bavas Filme sind vor allem optisch interessant. Wer mit der Lupe auf die Suche nach der narrativen Plausibilität geht, hat sich den Zugang schon versperrt. Bava, der aus der Malerei stammt, seine Arbeit in Cinecitta als Kameramann begann und eigentlich nur durch Zufall auf den Stuhl des Regisseurs bugsiert wurde, malte seine Filme in erster Linie und den kombinierten Möglichkeiten aus Dekors, Ausleuchtung und Kamera entlockte er manche aufregende Sequenz. Er drehte Filme nicht wegen einer Message, auch nicht in erster Linie um eine Geschichte zu erzählen. Film nahm er als eigenständige Kunstform wahr und lotete ihre formalen Möglichkeiten aus. Als Bühne diente ihm die reiche Bandbreite an Genrefilmen, die er als hermetisch-filmisches Universum begriff, vor allem aber schien er schon zu wissen, dass längst nicht mehr die Geschichte es ist, was zählt. Sondern die Art ihrer Erzählung, ihrer Inszenierung. Nicht alles ist gelungen, gewiss, vieles erzählt auf zweiter Ebene von mangelnden Budgets. Aber immer ist da dieser Wille zum Besonderen, zur filmischen Schönheit, zum sinnlichen Genuss.
Bava mag kommerzielle Filme gedreht haben. Aber er hatte dabei den Zuschauer im Sinn, den Zuschauer als bewussten Genießer ästhetischer Schauspiele. Ein Glücklicher ist, der das Blau, das Rot und das Grün aus Bavas Filmen kennen- und schätzen lernen konnte, der sich - dank qualitativ hervorragender DVDs - bis heute an der Kraft dieser Farben erfreuen kann. Eine Kraft, wie sie nur Bava diesen Farben zu entlocken vermochte.
Dafür Danke. Und alles Gute, caro Mario.
Ars Incubi - Das Mario Bava Archiv (Achtung, sehr "detaillierte" Inhaltsangaben bei den Filmkritiken!)
backlinks: Mario Bava
° ° °
Thema: FilmKulturMedienwissenschaft
philosophus stellt in seinem leider Gottes viel zu selten aktualisierten Weblog die Powerpoint-Folien seines einführenden Vortrags zu David Cronenbergs Fast Company (Kanada 1979) zur Verfügung (leider nur Topic-Link, bin ich zu doof dort die Perma-Links zu finden?). In einer Auffanggeste gliedert er den im Gesamtwerk Cronenbergs gemeinhin "etwas randständig" angesiedelten Film wieder voll in das Oeuvre ein:
"Es gibt dutzende Arten Rennwagen zu filmen, aber Cronenberg tut dies in spezifischer Weise: Aus der Mensch-Maschine-Interaktion wird ein Verschmelzen von Fahrer und Fahrzeug."
backlinks: david cronenberg
"Es gibt dutzende Arten Rennwagen zu filmen, aber Cronenberg tut dies in spezifischer Weise: Aus der Mensch-Maschine-Interaktion wird ein Verschmelzen von Fahrer und Fahrzeug."
backlinks: david cronenberg
° ° °
Thema: Alltag, medial gedoppelt
29. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Auf dem Rückweg von der Kiezbibliothek und der Wohnung von S., die ich gerade in deren Absenz hüte, gesehen, dass im Intimes für ab Donnerstag Tim Burtons Big Fish angekündigt ist. Erstaunlich, wie schnell sich mein Gemüt darüber aufhellte. Nicht, dass ich gerade Trübsal blase, und der wunderschöne Sonnenschein tat sicher sein übriges, aber dass ich den Film demnächst wieder - ich sah ihn bereits zweimal im Kino, im nur unwesentlich weiter entfernt, aber noch immer in Laufnähe liegenden Kosmos - sehen kann, ließ mein Herz glatt eine Oktave höher schlagen. Die ganze Zeit danach nur an die Bilder gedacht, die Tränen, die ich Hasenherz vergnügt bei beiden Sichtungen vergoß. Dieser wunderschöne Film, wie ich ihn zum ersten Mal sah und danach S.' Wohnung mit Osterglocken füllte. Bin schon ganz aufgeregt. Letzten Endes auch, weil das Intimes eigentlich auch der Ort ist, diesen Film zu sehen. Dieser verträumte Kino am Eck, dieser verträumte Film. Danke, Tim.
° ° °
Thema: Weblogflaneur
28. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Filmtagebuch
Ein Coenstoff par excellence sollte man meinen: 1955 inszenierte Alexander Mackendrick mit Ladykillers (filmtagebuch) einen ewigen Weihnachtsklassiker, in dem sich eine Schar skurriler Krimineller, angeführt von einem um Leib und Seele spielenden Sir Alec Guiness, bei einer naiven, britischen Teeoma einquartieren, um sich dort, wie sie sagen, in der hohen Kunst der Kammermusik zu üben. In Wahrheit nutzt man die Wohnung natürlich als Versteck, um dort aus einen pfundschweren Coup zu landen. Das Vorhaben gelingt zunächst, doch steht die Oma mit ihrer beschaulichen Gutmütigkeit dem erfolgreichen Beschluss schließlich im Wege. Das gutmütige Tantchen muss aus dem Weg geschafft werden, darin sind sich alle einig, doch bringt es keiner der Ganoven übers Herz, die Tat zu vollstrecken. Misstrauen und Gier richten schließlich das Verbrechen gegen die Verbrecher selbst, bis keiner mehr am Leben ist. Bis heute gilt der atmosphärisch fotografierte, witzige Film als Meilenstein der Komödienkunst und genießt vollkommen zurecht seinen überwältigenden Ruf, den der Film alljährlich in der besinnlichsten Zeit des Jahres auf irgendeinem dritten Kanal unter Beweis zu stellen vermag.
 Verbrecher, die über ihr eigenes Verbrechen stolpern und am Ende selbst denkbar gelackmeiert dastehen. Die Filmografie der Coens ist voll von solchen Typen, man denke etwa an Blood Simple (USA 1984) oder Fargo (USA 1996). Und in der Tat findet sich schon in erstgenanntem Film, ihrem Spielfilmdebüt, im Dialog ein offen wörtliches Zitat aus Mackendricks schwarzer Komödie. Da habe sich nun ein Kreis geschlossen, kommentiert Ethan Coen dann auch den neuesten Film der beiden Filmkritikerlieblinge im Presseheft.
Verbrecher, die über ihr eigenes Verbrechen stolpern und am Ende selbst denkbar gelackmeiert dastehen. Die Filmografie der Coens ist voll von solchen Typen, man denke etwa an Blood Simple (USA 1984) oder Fargo (USA 1996). Und in der Tat findet sich schon in erstgenanntem Film, ihrem Spielfilmdebüt, im Dialog ein offen wörtliches Zitat aus Mackendricks schwarzer Komödie. Da habe sich nun ein Kreis geschlossen, kommentiert Ethan Coen dann auch den neuesten Film der beiden Filmkritikerlieblinge im Presseheft.
Die Coens wären nicht die Coens, wenn sie dem Film lediglich eine technisch zeitgemäße Neuauflage auf den Leib schneidern würden. In der Tat wird der Stoff unter Beibehaltung der wesentlichen narrativen Grundpfeiler nahtlos der eigenen Filmografie einverleibt. Dazu gehört natürlich das Spiel mit regionalen, aber auch sozialen Identitäten und deren klischeehaften Verzerrungen aus dem weiten Raum der USA. Nahezu alle Filme der Coens tragen die Region ihrer Spielhandlung als deutliches Signum mit sich. In diesem Falle ist es die Gegend um den Mississippi, den Ol’ Man River, der sich gemächlich durch die Landschaft, die Geschichte der USA und natürlich durch diesen Film zieht. Die Handlung wurde in die schwarze Baptistengemeinde verlegt, entsprechend atmet der wie stets mit Sorgfalt zusammengestellte Soundtrack den Spirit alter Gospelstücke und lädt zu einer Geschichtsstunde über frühe afro-amerikanische Musikkultur ein. Die später zu tötende Lady ist die alte Marva Munson (Irma P. Hall), eine verwitwete, schon leicht wunderliche, aber treue Seele, die fleißig in den Gottesdienst geht und eine Baptistenschule, ganz nach ihren eigenen Verhältnissen, mit einer Kleinigkeit monatlich unterstützt. Alec Guinnes’ Part übernimmt Tom Hanks, der hier auf den Namen Professor Dr. phil. Goldthwaite H. Dorr hört, ein sich bis zur Unnachvollziehbarkeit gespreizt ausdrückender Altphilologe, der nicht erst mit seinen steten Poe-Rezitationen deutlich als Mann des 19. Jahrhunderts ausgewiesen wird, sondern schon durch sein Äußeres aus den Gepflogenheiten einer zeitgemäßen Bekleidung hervorsticht. Der wiederum versammelt nun eine ganze Horde an Typen und verzerrten Abziehbildern im Keller der Dame, vom Ex-Vietcong mit Hitlerbärtchen über einen Klischee-HipHoper und einen kernig-älteren Herrn, Typ Wandervogel deutscher Provenienz, der hingegen mit seinem Reizdarm zu kämpfen hat. Es folgt eine im Detail zwar variierte, im wesentlichen aber werkgetreue Reprise der filmischen Vorlage.
 Soweit, so gut. Der Film beginnt wie ein waschechter Coen-Film und für einen Moment lang ist man bereit, nicht nur den missglückten Ein (Un)Möglicher Härtefall (USA 2003, Kritik), mit dem die Coens im letzten Jahr ihre Fans brüskierten, zu verzeihen, sondern auch diesen Film zu lieben: Alter Bluesgesang ertönt, ein wehmütiger Blick in den Himmel, von der Ferne ein paar Möwenschreie. Eine leicht groteske Statue rückt ins Bild, es folgt der Blick hinab zum Ol’ Man River, den wir aus der steilen Vogelperspektive sehen. Ein Dampfer kommt unter der Brücke hervor. Als Kenner des Films, aber auch des spezifischen Humors der beiden Coen-Brüder weiß man natürlich schon, dass auf diese Brücke, diesen Dampfer – ein Mülltransporter, der Tonnen von Kehricht auf eine Müllinsel, die sich beinahe malerisch am Horizont auftut, transportiert – unbedingt zu achten ist. Es folgen wunderbare Bilder aus der us-amerikanischen Provinz rund um den Mississippi. Bilder, die zwischen trübselig stimmender Rezession und fotografischer Schönheit gekonnt changieren. Es ist entspannend, dem zuzusehen. Die Coens, so scheint’s, sind nach dem allenfalls peinlichen Ehekomödienreinfall mit George Clooney wieder ganz bei sich.
Soweit, so gut. Der Film beginnt wie ein waschechter Coen-Film und für einen Moment lang ist man bereit, nicht nur den missglückten Ein (Un)Möglicher Härtefall (USA 2003, Kritik), mit dem die Coens im letzten Jahr ihre Fans brüskierten, zu verzeihen, sondern auch diesen Film zu lieben: Alter Bluesgesang ertönt, ein wehmütiger Blick in den Himmel, von der Ferne ein paar Möwenschreie. Eine leicht groteske Statue rückt ins Bild, es folgt der Blick hinab zum Ol’ Man River, den wir aus der steilen Vogelperspektive sehen. Ein Dampfer kommt unter der Brücke hervor. Als Kenner des Films, aber auch des spezifischen Humors der beiden Coen-Brüder weiß man natürlich schon, dass auf diese Brücke, diesen Dampfer – ein Mülltransporter, der Tonnen von Kehricht auf eine Müllinsel, die sich beinahe malerisch am Horizont auftut, transportiert – unbedingt zu achten ist. Es folgen wunderbare Bilder aus der us-amerikanischen Provinz rund um den Mississippi. Bilder, die zwischen trübselig stimmender Rezession und fotografischer Schönheit gekonnt changieren. Es ist entspannend, dem zuzusehen. Die Coens, so scheint’s, sind nach dem allenfalls peinlichen Ehekomödienreinfall mit George Clooney wieder ganz bei sich.
Doch denkste. Zwar gelingt es dem Film ohne weiteres, sein Programm abzuspulen und der Versuch, den Zuschauer mit Versatzstücken der Coen-Stilografie und mit hoher Gagdichte bei Laune zu halten, ist offensichtlich. Doch kommt Ladykillers dabei über bloße Mimesis eigener Werkspezifika nicht hinaus, ganz im Gegenteil ist es, gerade für den Freund und Kenner der Coenfilme, bisweilen erschreckend zuzusehen, wie ungelenk die Coens mit ihren eigenen Stilmitteln, die oft genug in der Rede von anderen Filmen als Coen-Style zusammengefasst wurden, hantieren und sich dabei geradewegs in ihrer eigenen Filmografie verlaufen. Die Idee mit dem Baptistenumfeld ist gerade mal für ein paar in der Tat sehr schöne Gospelmesseaufnahmen gut, wird aber kaum weitergesponnen. In Form der Tante und des jungen HipHopers gewissermaßen zwei unterschiedliche Entwürfe afro-amerikanischer Identität gegenüberzustellen, bleibt als Idee geradewegs ungenützt: Es reicht für drei, vier deftige Ohrfeigen, die der Junge einstecken muss, weil die resolute Tante in ihrem Haus keine „HippityHop-Sprache“, wie sie sie unsouverän bezeichnet, duldet. Als Idee geradewegs verfeuert. Im Falle von Tom Hanks scheint man die sprichwörtliche Coen-Skurrilität mit bloßem Grimassieren verwechselt zu haben: Hanks zieht ein Gesicht nach dem nächsten, rezitiert mal Poe und kichert dann mal wieder albern aufdringlich ohne dass sich daraus humoristischer Mehrwert ergebe. Die anderen Figuren: Lieblos runtergerissene Klischeebilder mit eigentlich viel Potential, denen das der ganzen Situation nicht gewachsene Drehbuch, das über Klamauk und skatologische Rektalwitze den ganzen feinen Coenhumor, wie man ihn so schätzt, vergessen zu haben scheint, allein undankbare Witzchen und einfallslosen Slapstick zuwirft. Über eine maue Komödie könnte man ja noch ohne viel Federlesens hinwegsehen - im Coenkontext betrachtet geriert sich Ladykillers jedoch zur handfesten Enttäuschung.
Ein Film wie eine blasse Kopie eigener, früherer Filme. Die gewitzte Souveränität vergangener Tage, scheint’s, ist dahin. Das dem nicht so ist, steht zu hoffen. Der Knacks, den eine bis dahin fast schon unanständig makellose Filmografie mit Ein (Un)Möglicher Härtefall erlitten hat, hat sich zum handfesten Riss ausgeweitet.
 Verbrecher, die über ihr eigenes Verbrechen stolpern und am Ende selbst denkbar gelackmeiert dastehen. Die Filmografie der Coens ist voll von solchen Typen, man denke etwa an Blood Simple (USA 1984) oder Fargo (USA 1996). Und in der Tat findet sich schon in erstgenanntem Film, ihrem Spielfilmdebüt, im Dialog ein offen wörtliches Zitat aus Mackendricks schwarzer Komödie. Da habe sich nun ein Kreis geschlossen, kommentiert Ethan Coen dann auch den neuesten Film der beiden Filmkritikerlieblinge im Presseheft.
Verbrecher, die über ihr eigenes Verbrechen stolpern und am Ende selbst denkbar gelackmeiert dastehen. Die Filmografie der Coens ist voll von solchen Typen, man denke etwa an Blood Simple (USA 1984) oder Fargo (USA 1996). Und in der Tat findet sich schon in erstgenanntem Film, ihrem Spielfilmdebüt, im Dialog ein offen wörtliches Zitat aus Mackendricks schwarzer Komödie. Da habe sich nun ein Kreis geschlossen, kommentiert Ethan Coen dann auch den neuesten Film der beiden Filmkritikerlieblinge im Presseheft.Die Coens wären nicht die Coens, wenn sie dem Film lediglich eine technisch zeitgemäße Neuauflage auf den Leib schneidern würden. In der Tat wird der Stoff unter Beibehaltung der wesentlichen narrativen Grundpfeiler nahtlos der eigenen Filmografie einverleibt. Dazu gehört natürlich das Spiel mit regionalen, aber auch sozialen Identitäten und deren klischeehaften Verzerrungen aus dem weiten Raum der USA. Nahezu alle Filme der Coens tragen die Region ihrer Spielhandlung als deutliches Signum mit sich. In diesem Falle ist es die Gegend um den Mississippi, den Ol’ Man River, der sich gemächlich durch die Landschaft, die Geschichte der USA und natürlich durch diesen Film zieht. Die Handlung wurde in die schwarze Baptistengemeinde verlegt, entsprechend atmet der wie stets mit Sorgfalt zusammengestellte Soundtrack den Spirit alter Gospelstücke und lädt zu einer Geschichtsstunde über frühe afro-amerikanische Musikkultur ein. Die später zu tötende Lady ist die alte Marva Munson (Irma P. Hall), eine verwitwete, schon leicht wunderliche, aber treue Seele, die fleißig in den Gottesdienst geht und eine Baptistenschule, ganz nach ihren eigenen Verhältnissen, mit einer Kleinigkeit monatlich unterstützt. Alec Guinnes’ Part übernimmt Tom Hanks, der hier auf den Namen Professor Dr. phil. Goldthwaite H. Dorr hört, ein sich bis zur Unnachvollziehbarkeit gespreizt ausdrückender Altphilologe, der nicht erst mit seinen steten Poe-Rezitationen deutlich als Mann des 19. Jahrhunderts ausgewiesen wird, sondern schon durch sein Äußeres aus den Gepflogenheiten einer zeitgemäßen Bekleidung hervorsticht. Der wiederum versammelt nun eine ganze Horde an Typen und verzerrten Abziehbildern im Keller der Dame, vom Ex-Vietcong mit Hitlerbärtchen über einen Klischee-HipHoper und einen kernig-älteren Herrn, Typ Wandervogel deutscher Provenienz, der hingegen mit seinem Reizdarm zu kämpfen hat. Es folgt eine im Detail zwar variierte, im wesentlichen aber werkgetreue Reprise der filmischen Vorlage.
 Soweit, so gut. Der Film beginnt wie ein waschechter Coen-Film und für einen Moment lang ist man bereit, nicht nur den missglückten Ein (Un)Möglicher Härtefall (USA 2003, Kritik), mit dem die Coens im letzten Jahr ihre Fans brüskierten, zu verzeihen, sondern auch diesen Film zu lieben: Alter Bluesgesang ertönt, ein wehmütiger Blick in den Himmel, von der Ferne ein paar Möwenschreie. Eine leicht groteske Statue rückt ins Bild, es folgt der Blick hinab zum Ol’ Man River, den wir aus der steilen Vogelperspektive sehen. Ein Dampfer kommt unter der Brücke hervor. Als Kenner des Films, aber auch des spezifischen Humors der beiden Coen-Brüder weiß man natürlich schon, dass auf diese Brücke, diesen Dampfer – ein Mülltransporter, der Tonnen von Kehricht auf eine Müllinsel, die sich beinahe malerisch am Horizont auftut, transportiert – unbedingt zu achten ist. Es folgen wunderbare Bilder aus der us-amerikanischen Provinz rund um den Mississippi. Bilder, die zwischen trübselig stimmender Rezession und fotografischer Schönheit gekonnt changieren. Es ist entspannend, dem zuzusehen. Die Coens, so scheint’s, sind nach dem allenfalls peinlichen Ehekomödienreinfall mit George Clooney wieder ganz bei sich.
Soweit, so gut. Der Film beginnt wie ein waschechter Coen-Film und für einen Moment lang ist man bereit, nicht nur den missglückten Ein (Un)Möglicher Härtefall (USA 2003, Kritik), mit dem die Coens im letzten Jahr ihre Fans brüskierten, zu verzeihen, sondern auch diesen Film zu lieben: Alter Bluesgesang ertönt, ein wehmütiger Blick in den Himmel, von der Ferne ein paar Möwenschreie. Eine leicht groteske Statue rückt ins Bild, es folgt der Blick hinab zum Ol’ Man River, den wir aus der steilen Vogelperspektive sehen. Ein Dampfer kommt unter der Brücke hervor. Als Kenner des Films, aber auch des spezifischen Humors der beiden Coen-Brüder weiß man natürlich schon, dass auf diese Brücke, diesen Dampfer – ein Mülltransporter, der Tonnen von Kehricht auf eine Müllinsel, die sich beinahe malerisch am Horizont auftut, transportiert – unbedingt zu achten ist. Es folgen wunderbare Bilder aus der us-amerikanischen Provinz rund um den Mississippi. Bilder, die zwischen trübselig stimmender Rezession und fotografischer Schönheit gekonnt changieren. Es ist entspannend, dem zuzusehen. Die Coens, so scheint’s, sind nach dem allenfalls peinlichen Ehekomödienreinfall mit George Clooney wieder ganz bei sich.Doch denkste. Zwar gelingt es dem Film ohne weiteres, sein Programm abzuspulen und der Versuch, den Zuschauer mit Versatzstücken der Coen-Stilografie und mit hoher Gagdichte bei Laune zu halten, ist offensichtlich. Doch kommt Ladykillers dabei über bloße Mimesis eigener Werkspezifika nicht hinaus, ganz im Gegenteil ist es, gerade für den Freund und Kenner der Coenfilme, bisweilen erschreckend zuzusehen, wie ungelenk die Coens mit ihren eigenen Stilmitteln, die oft genug in der Rede von anderen Filmen als Coen-Style zusammengefasst wurden, hantieren und sich dabei geradewegs in ihrer eigenen Filmografie verlaufen. Die Idee mit dem Baptistenumfeld ist gerade mal für ein paar in der Tat sehr schöne Gospelmesseaufnahmen gut, wird aber kaum weitergesponnen. In Form der Tante und des jungen HipHopers gewissermaßen zwei unterschiedliche Entwürfe afro-amerikanischer Identität gegenüberzustellen, bleibt als Idee geradewegs ungenützt: Es reicht für drei, vier deftige Ohrfeigen, die der Junge einstecken muss, weil die resolute Tante in ihrem Haus keine „HippityHop-Sprache“, wie sie sie unsouverän bezeichnet, duldet. Als Idee geradewegs verfeuert. Im Falle von Tom Hanks scheint man die sprichwörtliche Coen-Skurrilität mit bloßem Grimassieren verwechselt zu haben: Hanks zieht ein Gesicht nach dem nächsten, rezitiert mal Poe und kichert dann mal wieder albern aufdringlich ohne dass sich daraus humoristischer Mehrwert ergebe. Die anderen Figuren: Lieblos runtergerissene Klischeebilder mit eigentlich viel Potential, denen das der ganzen Situation nicht gewachsene Drehbuch, das über Klamauk und skatologische Rektalwitze den ganzen feinen Coenhumor, wie man ihn so schätzt, vergessen zu haben scheint, allein undankbare Witzchen und einfallslosen Slapstick zuwirft. Über eine maue Komödie könnte man ja noch ohne viel Federlesens hinwegsehen - im Coenkontext betrachtet geriert sich Ladykillers jedoch zur handfesten Enttäuschung.
Ein Film wie eine blasse Kopie eigener, früherer Filme. Die gewitzte Souveränität vergangener Tage, scheint’s, ist dahin. Das dem nicht so ist, steht zu hoffen. Der Knacks, den eine bis dahin fast schon unanständig makellose Filmografie mit Ein (Un)Möglicher Härtefall erlitten hat, hat sich zum handfesten Riss ausgeweitet.
Ladykillers (USA 2004)
Regie: Joel Coen; Drehbuch: Ethan Coen n. d. Vorlage v. William Rose;
Kamera: Roger Deakins; Schnitt: Roderick Jaynes (= Joel & Ethan Coen);
Darsteller: Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans, J.K. Simmons, Tzi Ma,
Ryan Hurst, Diane Delano, George Wallace, John McConnell, Jason Weaver, u.a.
Länge: ca. 104 Minuten; Verleih: Buena Vista
offizielle Website | weitere Links bei filmz.de | mrqe
Regie: Joel Coen; Drehbuch: Ethan Coen n. d. Vorlage v. William Rose;
Kamera: Roger Deakins; Schnitt: Roderick Jaynes (= Joel & Ethan Coen);
Darsteller: Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans, J.K. Simmons, Tzi Ma,
Ryan Hurst, Diane Delano, George Wallace, John McConnell, Jason Weaver, u.a.
Länge: ca. 104 Minuten; Verleih: Buena Vista
offizielle Website | weitere Links bei filmz.de | mrqe
° ° °
Thema: Hoerkino
28. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren

Kleine Kuriösität am Rande: Der Soundtrack zu us-amerikanischen Schnittfassung von George A. Romeros Dawn of the Dead (US 1978). Bekannterweise haben die ProgRock-Discopopper Goblin ihren dramatischen Score ja nur für die von Dario Argento montierte europäische Fassung des Films, die sich durch eine etwas straffere Handlung und einen generell eher düsteren Duktus auszeichnet, eingespielt. Für seine etwas ironischere und relaxtere US-Fassung hat Romero auf so genannte Library Music zurückgegriffen, lizenzfreie Klimpermusik, wie man sie auch aus Kaufhäusern kennt. Diese Musik wurde nun auf der hier gezeigten CD gesammelt und, soweit ich das überblicke, erstmals in Form eines Soundtracks veröffentlicht (dahingehend mag ich mich irren, zugegeben). Hier weitere Details.
° ° °
28. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Das ohnehin bereits indizierte Computerspiel Manhunt ist mit Beschluss vom 19.Juli des Amtsgerichts München beschlagnahmt worden. Seit dem 1994 beschlagnahmten Spiel Mortal Kombat ist dies das erste Spiel, das von der Polizei per Gerichtsbeschluss aus den Läden entfernt wird. Muss man sich mal vorstellen: Eine ohnehin nicht öffentlich verkaufbares Spiel wird per bundesweitem Polizeieinsatz eingezogen. Saugen sich's die Kids halt aus den Tauschbörsen oder sie importieren es aus den anderen EU-Ländern. Eigentlich nurmehr zum Lachen, so ein hilfloses Draufschlagen und Reinstechen.
Meldungen: golem.de | gamezone.de
Beschlagnahmebeschluss: pdf, 528 KB.
Meldungen: golem.de | gamezone.de
Beschlagnahmebeschluss: pdf, 528 KB.
° ° °
Thema: DVDs
27. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
 Fast geschenkt: Kathryn Bigelows gewitzte Vampirfilmvariation Near Dark gibt's hier für 6,98 kanadische Dollar als schickes 2er-Set von Anchor Bay. Umgerechnet sind das etwa 4,30 Euro, bei auch international portofreiem Versand.
Fast geschenkt: Kathryn Bigelows gewitzte Vampirfilmvariation Near Dark gibt's hier für 6,98 kanadische Dollar als schickes 2er-Set von Anchor Bay. Umgerechnet sind das etwa 4,30 Euro, bei auch international portofreiem Versand.Kritiken zum Film hier bei mrqe.com.
° ° °
Thema: FilmKulturMedienwissenschaft
27. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Enrico Wolf bespricht für F.LM das von Linda Williams (University of California - Berkeley, hier die dortige Filmwissenschaft) herausgegebene Buch Porn Studies, eine Sammlung von Schlüsseltexten dieser leider noch immer recht unterrepräsentierten Forschungsrichtung. Dass es ihm gefallen hat, lässt hoffen. Williams hat sich ja schon mit dem Buch Hardcore auf dem Gebiet profilieren können und der Pornografie den Status eines legitimen Forschungsgegenstands verliehen. Das besprochene Buch steht jedenfalls auf meiner Liste.
° ° °
Thema: good news
27. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Wer hätte es gedacht? Die FSK hat vor wenigen Tagen den um 9 Minuten längeren Director's Cut von Znack Synders Dawn of the Dead (USA 2003) mit dem Siegel "keine Jugendfreigabe" versehen. Das entspricht, trotz des harschen Titels, der früheren "Freigabe ab 18 Jahren". Damit steht er einer ungekürzten Veröffentlichung des Films auf DVD, die der Intention seines Regisseurs entspricht, auch in Deutschland nichts mehr im Wege. Angekündigt ist sie für Ende August.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
27. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
vor einigen Tagen, Kino International
 So ein bißchen korrespondiert das mit Sie haben Knut (Deutschland 2003). Nicht nur inhaltlich. Dieser Drang, das man eben tun müsse, was die Zeit einem gebietet. Auch die Rezeption. Was habe ich mich von dem Knutfilm nicht angeekelt gefühlt. Nur um ihn dann, bei näherer Betrachtung, doch schätzen zu lernen. Gleicher Fall bei Muxmäuschenstill, diesem jüngsten Wunderfilm des Perspektivenkinos, wie ich es mal in Anlehnung an die Berlinale-Sektion - wo beide Filme und auch etwa Science Fiction (D 2002), ebenfalls mit Jan Henrik Stahlberg in der Hauptrolle, zu sehen gewesen sind - nennen will. Was hatte ich mich vor diesem Film geekelt, der mir nur vermeintlich klug daherkam, sicher Wahres über Sicherheits- und Ordnungsfanatiker und den Zustand Deutschlands gegenwärtig aussagte, dann aber doch immer wieder in Fahrwasser geriet, wo mir nur zu sagen blieb: Leider daneben geschossen. Seine Lakonie schien mir nur Anlehnung an eine eher verhasste deutsche Kinotradition des beschaulich Witzigen, ganz fürchterlich vor allem die Leute im Saal ringsum, in der Tat eher so einem, ich sag mal, proletenhaften Umfeld entsprungen, die sich vor allem lang und breit über Muxens Rachefeldzüge im Namen (oder: eigentlich ja gerade nicht) des kategorischen Imperativs amüsierten. Mit dem Gesicht in die Scheiße. Hahaha. Wie der eine kotzt. Huhu. Immer druff. Wie da Sozialsadismen für sich verwertbare Bilder fanden und darob erfreut die Bierflaschen hoben.
So ein bißchen korrespondiert das mit Sie haben Knut (Deutschland 2003). Nicht nur inhaltlich. Dieser Drang, das man eben tun müsse, was die Zeit einem gebietet. Auch die Rezeption. Was habe ich mich von dem Knutfilm nicht angeekelt gefühlt. Nur um ihn dann, bei näherer Betrachtung, doch schätzen zu lernen. Gleicher Fall bei Muxmäuschenstill, diesem jüngsten Wunderfilm des Perspektivenkinos, wie ich es mal in Anlehnung an die Berlinale-Sektion - wo beide Filme und auch etwa Science Fiction (D 2002), ebenfalls mit Jan Henrik Stahlberg in der Hauptrolle, zu sehen gewesen sind - nennen will. Was hatte ich mich vor diesem Film geekelt, der mir nur vermeintlich klug daherkam, sicher Wahres über Sicherheits- und Ordnungsfanatiker und den Zustand Deutschlands gegenwärtig aussagte, dann aber doch immer wieder in Fahrwasser geriet, wo mir nur zu sagen blieb: Leider daneben geschossen. Seine Lakonie schien mir nur Anlehnung an eine eher verhasste deutsche Kinotradition des beschaulich Witzigen, ganz fürchterlich vor allem die Leute im Saal ringsum, in der Tat eher so einem, ich sag mal, proletenhaften Umfeld entsprungen, die sich vor allem lang und breit über Muxens Rachefeldzüge im Namen (oder: eigentlich ja gerade nicht) des kategorischen Imperativs amüsierten. Mit dem Gesicht in die Scheiße. Hahaha. Wie der eine kotzt. Huhu. Immer druff. Wie da Sozialsadismen für sich verwertbare Bilder fanden und darob erfreut die Bierflaschen hoben.
Doch dann kriegt der Film die Kurve. Die Lacher werden leiser. Verstummen irgendwann. Ähnlich beschreibt's Kuhlbrodt in seiner formidablen Kritik. Mux, das ist natürlich der deutsche Michel, so irgendwie. Gefangen in und mit sich selbst. Etwas Sturm und Drang, deutscher Idealismus, Kant im Motel, Goethe auf Reisen. Peinliche Auswüchse der Romantik im Hier und Jetzt, dadurch als nurmehr alberner Anachronismus gezeigt. Und natürlich: narzistisch, eitel, seinen eigenen Idealen nicht gemäß. Wie geschaffen dafür aufzugehen, im bundesdeutschen Mediendschungel. Letzten Endes ein Mörder, ja. Zu feige sich selbst zu richten auch. Und natürlich kann das nur in Italien enden, dort, wo sich die deutsche Wirtschaftswunderseele hinrettete, la dolce vita, dieser Kram. Urlaubsvideostimmung, Mux endlich entspannt. Melone am Straßenrand. Aber auch hier: Schnelle Autos. Unverantwortlich. Melone? Schnelle Autos. Auf die Straße, Autos anhalten! In Italien, die deutsche Fight-Club-Kolonie errichten. Es geht nicht gut.
Da bewegt sich was, in dem Film. Vielleicht ist das das Beste, was der deutschen Heimatfilmer-Tradition in den letzten Jahren geschehen konnte. Vielleicht. Zu einer wirklichen Positionierung fühle ich mich nicht in der Lage. Vielleicht ist dieser Film großartig.
imdb | mrqe | offizielle website | filmz.de
 So ein bißchen korrespondiert das mit Sie haben Knut (Deutschland 2003). Nicht nur inhaltlich. Dieser Drang, das man eben tun müsse, was die Zeit einem gebietet. Auch die Rezeption. Was habe ich mich von dem Knutfilm nicht angeekelt gefühlt. Nur um ihn dann, bei näherer Betrachtung, doch schätzen zu lernen. Gleicher Fall bei Muxmäuschenstill, diesem jüngsten Wunderfilm des Perspektivenkinos, wie ich es mal in Anlehnung an die Berlinale-Sektion - wo beide Filme und auch etwa Science Fiction (D 2002), ebenfalls mit Jan Henrik Stahlberg in der Hauptrolle, zu sehen gewesen sind - nennen will. Was hatte ich mich vor diesem Film geekelt, der mir nur vermeintlich klug daherkam, sicher Wahres über Sicherheits- und Ordnungsfanatiker und den Zustand Deutschlands gegenwärtig aussagte, dann aber doch immer wieder in Fahrwasser geriet, wo mir nur zu sagen blieb: Leider daneben geschossen. Seine Lakonie schien mir nur Anlehnung an eine eher verhasste deutsche Kinotradition des beschaulich Witzigen, ganz fürchterlich vor allem die Leute im Saal ringsum, in der Tat eher so einem, ich sag mal, proletenhaften Umfeld entsprungen, die sich vor allem lang und breit über Muxens Rachefeldzüge im Namen (oder: eigentlich ja gerade nicht) des kategorischen Imperativs amüsierten. Mit dem Gesicht in die Scheiße. Hahaha. Wie der eine kotzt. Huhu. Immer druff. Wie da Sozialsadismen für sich verwertbare Bilder fanden und darob erfreut die Bierflaschen hoben.
So ein bißchen korrespondiert das mit Sie haben Knut (Deutschland 2003). Nicht nur inhaltlich. Dieser Drang, das man eben tun müsse, was die Zeit einem gebietet. Auch die Rezeption. Was habe ich mich von dem Knutfilm nicht angeekelt gefühlt. Nur um ihn dann, bei näherer Betrachtung, doch schätzen zu lernen. Gleicher Fall bei Muxmäuschenstill, diesem jüngsten Wunderfilm des Perspektivenkinos, wie ich es mal in Anlehnung an die Berlinale-Sektion - wo beide Filme und auch etwa Science Fiction (D 2002), ebenfalls mit Jan Henrik Stahlberg in der Hauptrolle, zu sehen gewesen sind - nennen will. Was hatte ich mich vor diesem Film geekelt, der mir nur vermeintlich klug daherkam, sicher Wahres über Sicherheits- und Ordnungsfanatiker und den Zustand Deutschlands gegenwärtig aussagte, dann aber doch immer wieder in Fahrwasser geriet, wo mir nur zu sagen blieb: Leider daneben geschossen. Seine Lakonie schien mir nur Anlehnung an eine eher verhasste deutsche Kinotradition des beschaulich Witzigen, ganz fürchterlich vor allem die Leute im Saal ringsum, in der Tat eher so einem, ich sag mal, proletenhaften Umfeld entsprungen, die sich vor allem lang und breit über Muxens Rachefeldzüge im Namen (oder: eigentlich ja gerade nicht) des kategorischen Imperativs amüsierten. Mit dem Gesicht in die Scheiße. Hahaha. Wie der eine kotzt. Huhu. Immer druff. Wie da Sozialsadismen für sich verwertbare Bilder fanden und darob erfreut die Bierflaschen hoben.Doch dann kriegt der Film die Kurve. Die Lacher werden leiser. Verstummen irgendwann. Ähnlich beschreibt's Kuhlbrodt in seiner formidablen Kritik. Mux, das ist natürlich der deutsche Michel, so irgendwie. Gefangen in und mit sich selbst. Etwas Sturm und Drang, deutscher Idealismus, Kant im Motel, Goethe auf Reisen. Peinliche Auswüchse der Romantik im Hier und Jetzt, dadurch als nurmehr alberner Anachronismus gezeigt. Und natürlich: narzistisch, eitel, seinen eigenen Idealen nicht gemäß. Wie geschaffen dafür aufzugehen, im bundesdeutschen Mediendschungel. Letzten Endes ein Mörder, ja. Zu feige sich selbst zu richten auch. Und natürlich kann das nur in Italien enden, dort, wo sich die deutsche Wirtschaftswunderseele hinrettete, la dolce vita, dieser Kram. Urlaubsvideostimmung, Mux endlich entspannt. Melone am Straßenrand. Aber auch hier: Schnelle Autos. Unverantwortlich. Melone? Schnelle Autos. Auf die Straße, Autos anhalten! In Italien, die deutsche Fight-Club-Kolonie errichten. Es geht nicht gut.
Da bewegt sich was, in dem Film. Vielleicht ist das das Beste, was der deutschen Heimatfilmer-Tradition in den letzten Jahren geschehen konnte. Vielleicht. Zu einer wirklichen Positionierung fühle ich mich nicht in der Lage. Vielleicht ist dieser Film großartig.
imdb | mrqe | offizielle website | filmz.de
° ° °
Thema: Filmtagebuch
27. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
26.07.2004, Heimkino
Der Titel legt's schon nahe: Eine Geisterhausgeschichte. Dann aber wieder ganz und gar nicht. Zumindest aber arbeitet der Film damit, um davon ausgehend sein ganz eigenes, besonderes Programm zu entwickeln: Dr. Norman Boyle zieht mit Gattin und dem kleinen Sohn von New York in das abgelegene Landhaus von Prof. Dr. Freudstein (!), um dort nach den Arbeiten des Wissenschaftlers zu forschen. Das Unternehmen steht unter keinem guten Stern: Schon im Vorfeld der Reise trägt sich gar Mysteriöses zu, die unheimlichen Ereignisse verdichten sich bei Ankunft in dem gruseligen Anwesen. Was weiß das enigmatische Kindermädchen Ann? Was hat es mit dem Mädchen auf sich, dass dem kleinen Bob immer wieder erscheint? Welchen Ursprungs sind die mysteriösen Geräusche, die aus dem Keller in das Haus dringen? Und was hat Dr. Freudstein hier erforscht?
 Ähnlich wie in Fulcis flirrendem Meisterwerk The Beyond (Italien 1981), der ganz wunderbar mit Friedhofsmauer korrespondiert - man meint gar Nahtstellen zu entdecken, an denen ohne weiteres nun der andere Film sich in diesem fortsetzen könnte -, sind Plausibilität und Kohärenz, ja überhaupt das Gefüge der Kausalität untergeordnet. Fulci gelingt es meisterlich, sich von Narration und Plot zu emanzipieren und arbeitet eine Methode aus, die Grusel gothischer Provenienz und Splatter der Neuzeit miteinander verbindet, vor allem aber den Gruselfilm selbst zu untersuchen scheint. Meine persönliche Theorie vom Horrorfilm ist, dass in diesem Genre der Film selbst auf formalistischer Ebene ganz bei sich ist. Um effektiv zu sein - der Zuschauer soll sich, nach Möglichkeit, fürchten - muss er einen Spagat wagen: Zum einen muss das etablierte Weltgefüge hinreichend mit dem des Zuschauers korrespondieren, um diesen zu involvieren, was dem Film dessen Grusel garantiert, wenn er dann in diese Welt das Unheimliche und Phantastische dringen lässt. Er muss das Verständnis von Welt zum einen simulieren, zum anderen torpedieren. Und dies gelingt ihm in seinen besten Momenten durch eine Verzerrung des Raums und somit der Welt durch grundlegend filmische, eben formale Mittel. Seit jeher lassen sich im Horrorfilm vortrefflich technischer Fortschritt und Gespür für formale Aspekte der Filmsprache ablesen: Wo sie im Drama oder Autorenfilm meist "nur" der Etablierung des perslnlichen Anliegens dienen, letztendlich also untergeordnet sind, sind sie im Horrorfilm ganz primärer Gegenstand.
Ähnlich wie in Fulcis flirrendem Meisterwerk The Beyond (Italien 1981), der ganz wunderbar mit Friedhofsmauer korrespondiert - man meint gar Nahtstellen zu entdecken, an denen ohne weiteres nun der andere Film sich in diesem fortsetzen könnte -, sind Plausibilität und Kohärenz, ja überhaupt das Gefüge der Kausalität untergeordnet. Fulci gelingt es meisterlich, sich von Narration und Plot zu emanzipieren und arbeitet eine Methode aus, die Grusel gothischer Provenienz und Splatter der Neuzeit miteinander verbindet, vor allem aber den Gruselfilm selbst zu untersuchen scheint. Meine persönliche Theorie vom Horrorfilm ist, dass in diesem Genre der Film selbst auf formalistischer Ebene ganz bei sich ist. Um effektiv zu sein - der Zuschauer soll sich, nach Möglichkeit, fürchten - muss er einen Spagat wagen: Zum einen muss das etablierte Weltgefüge hinreichend mit dem des Zuschauers korrespondieren, um diesen zu involvieren, was dem Film dessen Grusel garantiert, wenn er dann in diese Welt das Unheimliche und Phantastische dringen lässt. Er muss das Verständnis von Welt zum einen simulieren, zum anderen torpedieren. Und dies gelingt ihm in seinen besten Momenten durch eine Verzerrung des Raums und somit der Welt durch grundlegend filmische, eben formale Mittel. Seit jeher lassen sich im Horrorfilm vortrefflich technischer Fortschritt und Gespür für formale Aspekte der Filmsprache ablesen: Wo sie im Drama oder Autorenfilm meist "nur" der Etablierung des perslnlichen Anliegens dienen, letztendlich also untergeordnet sind, sind sie im Horrorfilm ganz primärer Gegenstand.
Das Haus an der Friedhofsmauer ist hierfür das beste Beispiel. Es gibt wohl kein Bild in diesem Film, das nicht genau durchkomponiert und bis ins Detail sanft und sacht ausgeleuchtet wäre. Keine Aktion der Kamera, die nicht hochkonzentriert und besonnen geplant wäre. Immer das Bild und seine Wirkungskraft im Sinn, in jedem Moment. Die Rede von Fulci als vielleicht ja visionären, letztendlich aber seiner Manie wegen krudem Inszenator, der nur plump auf die Sehgewohnheiten des Zuschauers mittels bloßer Bilddrastik schlägt, ist mit diesem Film als Lüge, zumindest aber als voreingenommene Einschätzung enttarnt. Und die Wirkung des Film ist grandios: Sein traumwandlerischer Charakter hindert ihn nicht, in seinen besten Momenten das Herz des Zuschauers zum Rasen zu bringen. Selbst noch die abstrakte, rein aufs formale sich konzentrierende Beobachtung löst shock aus. Dabei ist der Film, von einigen gewiss drastischen Spitzen abgesehen, nicht so blutig wie sein Ruf. Atmosphäre ist ihm letztendlich dann doch alles, wie auch der unerwartete, allerdings nur konsequente Schluß, in dem sich Zeit und Raum aufgelöst sehen, unterstreicht.
Ein Lehrstück in Sachen formaler Filmsprache. Ein kleines, großes, gemeinhin unbekanntes Meisterwerk des Horrorfilms. Wie so viele andere: In Deutschland institutionell unterschlagen. Bezeichnend!
imdb | mrqe
Der Titel legt's schon nahe: Eine Geisterhausgeschichte. Dann aber wieder ganz und gar nicht. Zumindest aber arbeitet der Film damit, um davon ausgehend sein ganz eigenes, besonderes Programm zu entwickeln: Dr. Norman Boyle zieht mit Gattin und dem kleinen Sohn von New York in das abgelegene Landhaus von Prof. Dr. Freudstein (!), um dort nach den Arbeiten des Wissenschaftlers zu forschen. Das Unternehmen steht unter keinem guten Stern: Schon im Vorfeld der Reise trägt sich gar Mysteriöses zu, die unheimlichen Ereignisse verdichten sich bei Ankunft in dem gruseligen Anwesen. Was weiß das enigmatische Kindermädchen Ann? Was hat es mit dem Mädchen auf sich, dass dem kleinen Bob immer wieder erscheint? Welchen Ursprungs sind die mysteriösen Geräusche, die aus dem Keller in das Haus dringen? Und was hat Dr. Freudstein hier erforscht?
 Ähnlich wie in Fulcis flirrendem Meisterwerk The Beyond (Italien 1981), der ganz wunderbar mit Friedhofsmauer korrespondiert - man meint gar Nahtstellen zu entdecken, an denen ohne weiteres nun der andere Film sich in diesem fortsetzen könnte -, sind Plausibilität und Kohärenz, ja überhaupt das Gefüge der Kausalität untergeordnet. Fulci gelingt es meisterlich, sich von Narration und Plot zu emanzipieren und arbeitet eine Methode aus, die Grusel gothischer Provenienz und Splatter der Neuzeit miteinander verbindet, vor allem aber den Gruselfilm selbst zu untersuchen scheint. Meine persönliche Theorie vom Horrorfilm ist, dass in diesem Genre der Film selbst auf formalistischer Ebene ganz bei sich ist. Um effektiv zu sein - der Zuschauer soll sich, nach Möglichkeit, fürchten - muss er einen Spagat wagen: Zum einen muss das etablierte Weltgefüge hinreichend mit dem des Zuschauers korrespondieren, um diesen zu involvieren, was dem Film dessen Grusel garantiert, wenn er dann in diese Welt das Unheimliche und Phantastische dringen lässt. Er muss das Verständnis von Welt zum einen simulieren, zum anderen torpedieren. Und dies gelingt ihm in seinen besten Momenten durch eine Verzerrung des Raums und somit der Welt durch grundlegend filmische, eben formale Mittel. Seit jeher lassen sich im Horrorfilm vortrefflich technischer Fortschritt und Gespür für formale Aspekte der Filmsprache ablesen: Wo sie im Drama oder Autorenfilm meist "nur" der Etablierung des perslnlichen Anliegens dienen, letztendlich also untergeordnet sind, sind sie im Horrorfilm ganz primärer Gegenstand.
Ähnlich wie in Fulcis flirrendem Meisterwerk The Beyond (Italien 1981), der ganz wunderbar mit Friedhofsmauer korrespondiert - man meint gar Nahtstellen zu entdecken, an denen ohne weiteres nun der andere Film sich in diesem fortsetzen könnte -, sind Plausibilität und Kohärenz, ja überhaupt das Gefüge der Kausalität untergeordnet. Fulci gelingt es meisterlich, sich von Narration und Plot zu emanzipieren und arbeitet eine Methode aus, die Grusel gothischer Provenienz und Splatter der Neuzeit miteinander verbindet, vor allem aber den Gruselfilm selbst zu untersuchen scheint. Meine persönliche Theorie vom Horrorfilm ist, dass in diesem Genre der Film selbst auf formalistischer Ebene ganz bei sich ist. Um effektiv zu sein - der Zuschauer soll sich, nach Möglichkeit, fürchten - muss er einen Spagat wagen: Zum einen muss das etablierte Weltgefüge hinreichend mit dem des Zuschauers korrespondieren, um diesen zu involvieren, was dem Film dessen Grusel garantiert, wenn er dann in diese Welt das Unheimliche und Phantastische dringen lässt. Er muss das Verständnis von Welt zum einen simulieren, zum anderen torpedieren. Und dies gelingt ihm in seinen besten Momenten durch eine Verzerrung des Raums und somit der Welt durch grundlegend filmische, eben formale Mittel. Seit jeher lassen sich im Horrorfilm vortrefflich technischer Fortschritt und Gespür für formale Aspekte der Filmsprache ablesen: Wo sie im Drama oder Autorenfilm meist "nur" der Etablierung des perslnlichen Anliegens dienen, letztendlich also untergeordnet sind, sind sie im Horrorfilm ganz primärer Gegenstand.Das Haus an der Friedhofsmauer ist hierfür das beste Beispiel. Es gibt wohl kein Bild in diesem Film, das nicht genau durchkomponiert und bis ins Detail sanft und sacht ausgeleuchtet wäre. Keine Aktion der Kamera, die nicht hochkonzentriert und besonnen geplant wäre. Immer das Bild und seine Wirkungskraft im Sinn, in jedem Moment. Die Rede von Fulci als vielleicht ja visionären, letztendlich aber seiner Manie wegen krudem Inszenator, der nur plump auf die Sehgewohnheiten des Zuschauers mittels bloßer Bilddrastik schlägt, ist mit diesem Film als Lüge, zumindest aber als voreingenommene Einschätzung enttarnt. Und die Wirkung des Film ist grandios: Sein traumwandlerischer Charakter hindert ihn nicht, in seinen besten Momenten das Herz des Zuschauers zum Rasen zu bringen. Selbst noch die abstrakte, rein aufs formale sich konzentrierende Beobachtung löst shock aus. Dabei ist der Film, von einigen gewiss drastischen Spitzen abgesehen, nicht so blutig wie sein Ruf. Atmosphäre ist ihm letztendlich dann doch alles, wie auch der unerwartete, allerdings nur konsequente Schluß, in dem sich Zeit und Raum aufgelöst sehen, unterstreicht.
Ein Lehrstück in Sachen formaler Filmsprache. Ein kleines, großes, gemeinhin unbekanntes Meisterwerk des Horrorfilms. Wie so viele andere: In Deutschland institutionell unterschlagen. Bezeichnend!
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Weblogflaneur
26. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Visuelles
26. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
25. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Filmtagebuch
24.07.2004, Heimkino
"I meant it metaphorically!"
- Albert Spica, dem Namen nach und auch sonst ein Mann des gesprochenen Wortes
Wenngleich ich einräumen muss, dass dieser Film im Vergleich zu seiner ersten Sichtung bei der zweiten ein wenig verblasst - was ich in erster Linie darauf zurückführe, dass die erste im Kino, die zweite zuhause stattfand -, so ist es doch, gerade vor diesem Hintergrund, bemerkenswert, wie er mich auch diesmal meine Außenwelt nahezu komplett vergessen ließ. Greenaways Filme sind in ihren besten Momenten so reich wie die Banketts, Küchen und Installationen, die er abfilmt. Es formuliert sich ein Archiv aus, das Archive filmt. Das allein ist nun nichts Neues, es ist ein allgemeiner Standpunkt der gängigen Greenaway-Rezeption. Hinreichender Ausdruck dafür, dass ich mich erneut - auf höchst lustvolle Art - erschlagen fühle. Von der Opulenz, der Kreatürlichkeit, aber auch von der Artifzialität dieser Bilder. Dem Verfall, den sie dokumentieren, von ihrem Dahinter.

Und weil es passt, weil ich es heute, einen Tag nach der Sichtung dieses faszinierenden Films, entdeckt habe und es im wesentlichen meine Gedanken während der Sichtung zusammenfasst, ein Auszug aus einem Interview mit Alan Moore, ebenfalls ein Visionär auf seinem Gebiet:
Q: Is there a kind of cultural disconnection between the image and fleshly reality? You interrogate the idea of the body in your work, especially in "Promethea," "Watchmen" and "From Hell," where Jack the Ripper's dissection of prostitutes' flesh gives him epiphanies as well as the power to transcend his own body, time and space.
A: Well, the body is one of our first sources of metaphor. One of the ways in which we create our language is to talk about things that are unfamiliar to us in terms of things that are familiar to us. Most of the metaphors that we use come from our own bodies. Of course, in magic, such as that I'm interested in, every part of the body has its own symbolic significance. We were talking earlier about the cult of the head. Various parts of the body, such as the sexual organs, have profound meanings in most systems and cultures. The eyes, the hands -- these are all very rich in symbolism because they are so immediate to us. We all know our bodies intimately; it's all we have and all we are. It tends to provide the easiest sort of metaphor. We talk about the face of a clock, or the foot of the stairs. The limbs of a corporation.
In diesem Sinne lässt Greenaway gesprochene und geschriebene Sprachkultur vor dem Hintergrund der Malerei gegeneinander antreten, bezeichnenderweise im Kampf um eine Frau. Adaption durch Verschlingung und Ausscheidung. Sex und Essen. Anus und Vagina sind nicht weit voneinander entfernt und Spica wird, so er im Furor, seinen Konkurrenten verschlingen, nur um dann, wenn es gilt, angeekelt zurückzuschrecken. Draußen verrottete der Schweinskopf, das Gemüse zerfließt, verflüssigt sich, und dieser ungeheure Gestank treibt Menschen Tränen in die Augen, hüllt die sich Liebenden, respektive ihre nackten Leiber, dennoch schützend in sich ein. Anus und Vagina. Schwanz und Schrift. Saftige Erotik, skatologische Obszönität. Peter Greenaway.
imdb | mrqe | greenaway guide
"I meant it metaphorically!"
- Albert Spica, dem Namen nach und auch sonst ein Mann des gesprochenen Wortes
Wenngleich ich einräumen muss, dass dieser Film im Vergleich zu seiner ersten Sichtung bei der zweiten ein wenig verblasst - was ich in erster Linie darauf zurückführe, dass die erste im Kino, die zweite zuhause stattfand -, so ist es doch, gerade vor diesem Hintergrund, bemerkenswert, wie er mich auch diesmal meine Außenwelt nahezu komplett vergessen ließ. Greenaways Filme sind in ihren besten Momenten so reich wie die Banketts, Küchen und Installationen, die er abfilmt. Es formuliert sich ein Archiv aus, das Archive filmt. Das allein ist nun nichts Neues, es ist ein allgemeiner Standpunkt der gängigen Greenaway-Rezeption. Hinreichender Ausdruck dafür, dass ich mich erneut - auf höchst lustvolle Art - erschlagen fühle. Von der Opulenz, der Kreatürlichkeit, aber auch von der Artifzialität dieser Bilder. Dem Verfall, den sie dokumentieren, von ihrem Dahinter.

Und weil es passt, weil ich es heute, einen Tag nach der Sichtung dieses faszinierenden Films, entdeckt habe und es im wesentlichen meine Gedanken während der Sichtung zusammenfasst, ein Auszug aus einem Interview mit Alan Moore, ebenfalls ein Visionär auf seinem Gebiet:
Q: Is there a kind of cultural disconnection between the image and fleshly reality? You interrogate the idea of the body in your work, especially in "Promethea," "Watchmen" and "From Hell," where Jack the Ripper's dissection of prostitutes' flesh gives him epiphanies as well as the power to transcend his own body, time and space.
A: Well, the body is one of our first sources of metaphor. One of the ways in which we create our language is to talk about things that are unfamiliar to us in terms of things that are familiar to us. Most of the metaphors that we use come from our own bodies. Of course, in magic, such as that I'm interested in, every part of the body has its own symbolic significance. We were talking earlier about the cult of the head. Various parts of the body, such as the sexual organs, have profound meanings in most systems and cultures. The eyes, the hands -- these are all very rich in symbolism because they are so immediate to us. We all know our bodies intimately; it's all we have and all we are. It tends to provide the easiest sort of metaphor. We talk about the face of a clock, or the foot of the stairs. The limbs of a corporation.
In diesem Sinne lässt Greenaway gesprochene und geschriebene Sprachkultur vor dem Hintergrund der Malerei gegeneinander antreten, bezeichnenderweise im Kampf um eine Frau. Adaption durch Verschlingung und Ausscheidung. Sex und Essen. Anus und Vagina sind nicht weit voneinander entfernt und Spica wird, so er im Furor, seinen Konkurrenten verschlingen, nur um dann, wenn es gilt, angeekelt zurückzuschrecken. Draußen verrottete der Schweinskopf, das Gemüse zerfließt, verflüssigt sich, und dieser ungeheure Gestank treibt Menschen Tränen in die Augen, hüllt die sich Liebenden, respektive ihre nackten Leiber, dennoch schützend in sich ein. Anus und Vagina. Schwanz und Schrift. Saftige Erotik, skatologische Obszönität. Peter Greenaway.
imdb | mrqe | greenaway guide
° ° °
Thema: good news
25. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Bent Hamer, Regisseur des tollen Kitchen Stories (Norwegen 2002; filmz.de), hat gerade in den USA eine Adaption von Charles Bukowskis Roman Faktotum abgedreht. Matt Dillon in der Hauptrolle irritiert mich zwar etwas, aber mit dem Regisseur sollte eigentlich ein Mann gefunden sein, der die Lakonie und den Weltverdruss der Vorlage adäquat auf Film zu bannen versteht. Ich bin gespannt und hoffe auf einen deutschen Kinostart.
° ° °
Thema: comics
25. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Bei salon.com, leider nur nach einer free-ads-Prozedur gratis und in voller Länge zu lesen, ein ausführliches und lesenswertes Interview mit Comicvisionär Alan Moore.
The lesson there, as Moore explains it, is that to understand the world one lives in, one has to give "coherence to ... complexity, to say that it is possible to think about politics, history, mythology, architecture, murder and the rest of it all at the same time to see how it connects."

The lesson there, as Moore explains it, is that to understand the world one lives in, one has to give "coherence to ... complexity, to say that it is possible to think about politics, history, mythology, architecture, murder and the rest of it all at the same time to see how it connects."

° ° °
Thema: Lesezeichen
» Bad Mags
22. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
° ° °
Thema: Blaetterrauschen
» Gelaber
Demnach bestimmten nicht nur der Verstand, sondern auch die Hormone, warum Menschen unterschiedliche Arten von Filmen bevorzugten, kommentiert Studienleiter Schultheiss: "Menschen mit einem starken Anlehnungsbedürfnis mögen romantische Filme. Sehr energische Menschen bevorzugen dagegen Filme mit mehr Action und Gewalt."
Und Menschen, die gerne lachen, schauen gerne Komödien? Mach Sachen, SpOn!
Und Menschen, die gerne lachen, schauen gerne Komödien? Mach Sachen, SpOn!
° ° °
Thema: Filmtagebuch
17.07.2004, Heimkino
Glückselige Tage des frühen Universal-Horrorfilms! Sie brachten uns Karloff und Lugosi in ihren besten Rollen! Manchmal vereinten sie beide sogar und entfachten einen Wettstreit der Darsteller, sehr zur Freude des Publikums natürlich: The Raven ist bereits die dritte Zusammenarbeit der beiden Helden des klassischen Gruselfilms (die ersten beiden sind im übrigen Gift of Gab und The Black Cat, beide aus dem Jahr 1934, wobei sich in erstgenanntem allerdings nur Cameos der beiden finden). Und natürlich ist es eine wahre Lust, den beiden bei ihrem Spiel zuzusehen, vor allem Lugosi schöpft hier aus vollen Kräften und legt eine Performance hin, die nur er so abliefern darf, ohne als over-acted abgetan zu werden.
 Was The Raven mir darüber hinaus als bemerkenswert erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass es sich dabei mitnichten, wie man vielleicht meinen könnte, um eine bloße Poe-Adaption handelt, sondern dass hier bereits ein wesentlicher Aspekt des (späteren) Horror- und Gruselfilms vorweg genommen wird: Den der Transponierung der eigenen kulturgeschichtlichen Traditionen als tragendes Element der Erzählung selbst nämlich. Angesiedelt im (damaligen) Hier und Jetzt, spielt Lugosi den Arzt Richard Vollin, der sich ganz der Forschung verschrieben hat. Vor allem aber ist er ein in der Seele dunkler Poe-Verehrer, dessen Leidenschaft ihn gar soweit getrieben hat, in einem geheimen Gewölbe seines Anwesens eine Folterkammer einzurichten, die originalgetreue Anfertigungen aller bei Poe beschriebenen Folterinstrumente ausstellt. Als die Tochter von Richter Thatcher, Jean, infolge eines Autounfalls - die erste Szene des Films, eine ganz wunderbare Miniatur der Miniaturfilmkunst - für ewig entstellt zu sein droht, kehrt der zunächst unwillige Vollin in die Praxis zurück, nachdem Thatcher dem offensichtlichen Narziss genügend Honig um den Mund geschmiert hat. Das Werk gelingt, die Schönheit wird gerettet, doch der düster sinnierende Doktor verliebt sich in Jean und sie in ihn. Das wiederum sieht der Vater gar nicht gern, ersehnt den Arzt, von seiner Liebe zu lassen.
Was The Raven mir darüber hinaus als bemerkenswert erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass es sich dabei mitnichten, wie man vielleicht meinen könnte, um eine bloße Poe-Adaption handelt, sondern dass hier bereits ein wesentlicher Aspekt des (späteren) Horror- und Gruselfilms vorweg genommen wird: Den der Transponierung der eigenen kulturgeschichtlichen Traditionen als tragendes Element der Erzählung selbst nämlich. Angesiedelt im (damaligen) Hier und Jetzt, spielt Lugosi den Arzt Richard Vollin, der sich ganz der Forschung verschrieben hat. Vor allem aber ist er ein in der Seele dunkler Poe-Verehrer, dessen Leidenschaft ihn gar soweit getrieben hat, in einem geheimen Gewölbe seines Anwesens eine Folterkammer einzurichten, die originalgetreue Anfertigungen aller bei Poe beschriebenen Folterinstrumente ausstellt. Als die Tochter von Richter Thatcher, Jean, infolge eines Autounfalls - die erste Szene des Films, eine ganz wunderbare Miniatur der Miniaturfilmkunst - für ewig entstellt zu sein droht, kehrt der zunächst unwillige Vollin in die Praxis zurück, nachdem Thatcher dem offensichtlichen Narziss genügend Honig um den Mund geschmiert hat. Das Werk gelingt, die Schönheit wird gerettet, doch der düster sinnierende Doktor verliebt sich in Jean und sie in ihn. Das wiederum sieht der Vater gar nicht gern, ersehnt den Arzt, von seiner Liebe zu lassen.
Ein Instrument zur Rache findet der Gekränkte schließlich in dem entflohenen Zuchthausinsassen Bateman (Karloff), der den Medicus in einer stürmischen Nacht ebenfalls um eine Korrektur seines Gesichts bittet, aus offen praktischen, wie weltanschaulichen Gründen: Ein hässlicher Mensch, so habe man ihm gesagt, vollbringe auch hässliche Taten. Von einem angenehmeren Äußeren verspreche er sich endlich eine Abkehr vom Pfad der Mörder und Verbrecher. Dieser achtlose Ausspruch ruft den diabolisch-morbiden Arzt auf den Plan: Er entstellt Bateman auf groteske Weise und macht ihn sich, mit Aussicht auf Besserung seiner äußerlichen Erscheinung, gefügig. Während einer Wochenendgesellschaft, zu der der Arzt auch den Richter, seine Tochter und deren Verlobten lädt, soll Bateman ihm mörderische Dienste in der Folterkammer erweisen, dann, so Vollin, erlöse er den Entstellten auch von seinem Antlitz ...
 Natürlich ist ein Gruselfilm jener Tage heutzutage meist nur noch vermindert im Sinne seiner primären Intention erfolgreich. Auch The Raven macht da keinen Unterschied und begeistert weniger als schaurige Mär, sondern vor allem als historisches Dokument seiner Gattung: Der Gedanke des Archivs, der den Horrorfilm schon bald trägt, die möglichst dichte Einschreibung der eigenen Kultur- und Literaturgeschichte in seine je jüngsten Elaborate findet sich hier bereits in Ansätzen implementiert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit ist dieser Umstand schon mehr als bemerkenswert, nicht zuletzt deshalb erscheint mir der Film deshalb als für die Geschichte seines Genres immanent wichtig, seine bislang wenig beachtete Rolle daher als Fauxpas der Geschichtsschreibung.
Natürlich ist ein Gruselfilm jener Tage heutzutage meist nur noch vermindert im Sinne seiner primären Intention erfolgreich. Auch The Raven macht da keinen Unterschied und begeistert weniger als schaurige Mär, sondern vor allem als historisches Dokument seiner Gattung: Der Gedanke des Archivs, der den Horrorfilm schon bald trägt, die möglichst dichte Einschreibung der eigenen Kultur- und Literaturgeschichte in seine je jüngsten Elaborate findet sich hier bereits in Ansätzen implementiert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit ist dieser Umstand schon mehr als bemerkenswert, nicht zuletzt deshalb erscheint mir der Film deshalb als für die Geschichte seines Genres immanent wichtig, seine bislang wenig beachtete Rolle daher als Fauxpas der Geschichtsschreibung.
Aber auch jenseits dessen ist The Raven ein kleines, elegantes Fest für die Sinne. Nicht nur die darstellerischen Leistungen der beiden prominenten Hauptdarsteller gereichen ihm zum Gewinn (auch wenn sie - natürlich – nicht unter dem gängigen Begriff „große Schauspielkunst“ einzusortieren wären, aber beide spielen ohnehin in einer sehr eigenen Liga), es finden sich auch zahlreiche kleine schöne Einfälle in der Inszenierung, die das Herz höher schlagen lassen. Der erste Auftritt Lugosis etwa, wenn zu Beginn nur ein übergroßer Schatten eines ausgestopften Rabens zu sehen ist, während Lugosi im Off einige Zeilen aus Poes gleichnamigem Text rezitiert. Die Kamera fährt langsam nach hinten, erschließt das Zimmer, den Raben selbst, schließlich den Tisch, auf dem er steht, und komplettiert den Raum schlussendlich, wenn sie uns zeigt, dass Lugosi keineswegs allein im Raume sitzt. Auch die Szene, in der Lugosi düster sinnierend Klavier spielt, seine Liebe Jean sich im Raum befindet, doch beide voneinander getrennt sind. Lugosi wird durch ein zierendes Geländer gefilmt, wie ein Raubtier in einem Käfig erscheint er dadurch, als er auf sein Instrument einhämmert. Jean indes wird aus dem Kamin heraus gefilmt, so dass das Feuer ihrer Erscheinung als grundierendes Fundament dient. Das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen: Das Feuer als Symbol für Leidenschaft, die der Liebsten entgegen schmachtet, aber auch das Feuer als Symbol für die Hölle, für den Schmerz, der wegen dieser Frau durchlitten wird und die Katastrophe des Films einleitet. Natürlich sind diese beiden Bespiele nur kleine Bonbons (von vielen anderen), nichts wirklich Großartiges oder Visionäres, aber eben doch Details, auf die sich zu achten lohnt, die die Atmosphäre des Films entschieden tragen und schlussendlich auch zu seinem Gelingen beitragen. Ein schöner Film.
imdb | mrqe
Glückselige Tage des frühen Universal-Horrorfilms! Sie brachten uns Karloff und Lugosi in ihren besten Rollen! Manchmal vereinten sie beide sogar und entfachten einen Wettstreit der Darsteller, sehr zur Freude des Publikums natürlich: The Raven ist bereits die dritte Zusammenarbeit der beiden Helden des klassischen Gruselfilms (die ersten beiden sind im übrigen Gift of Gab und The Black Cat, beide aus dem Jahr 1934, wobei sich in erstgenanntem allerdings nur Cameos der beiden finden). Und natürlich ist es eine wahre Lust, den beiden bei ihrem Spiel zuzusehen, vor allem Lugosi schöpft hier aus vollen Kräften und legt eine Performance hin, die nur er so abliefern darf, ohne als over-acted abgetan zu werden.
 Was The Raven mir darüber hinaus als bemerkenswert erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass es sich dabei mitnichten, wie man vielleicht meinen könnte, um eine bloße Poe-Adaption handelt, sondern dass hier bereits ein wesentlicher Aspekt des (späteren) Horror- und Gruselfilms vorweg genommen wird: Den der Transponierung der eigenen kulturgeschichtlichen Traditionen als tragendes Element der Erzählung selbst nämlich. Angesiedelt im (damaligen) Hier und Jetzt, spielt Lugosi den Arzt Richard Vollin, der sich ganz der Forschung verschrieben hat. Vor allem aber ist er ein in der Seele dunkler Poe-Verehrer, dessen Leidenschaft ihn gar soweit getrieben hat, in einem geheimen Gewölbe seines Anwesens eine Folterkammer einzurichten, die originalgetreue Anfertigungen aller bei Poe beschriebenen Folterinstrumente ausstellt. Als die Tochter von Richter Thatcher, Jean, infolge eines Autounfalls - die erste Szene des Films, eine ganz wunderbare Miniatur der Miniaturfilmkunst - für ewig entstellt zu sein droht, kehrt der zunächst unwillige Vollin in die Praxis zurück, nachdem Thatcher dem offensichtlichen Narziss genügend Honig um den Mund geschmiert hat. Das Werk gelingt, die Schönheit wird gerettet, doch der düster sinnierende Doktor verliebt sich in Jean und sie in ihn. Das wiederum sieht der Vater gar nicht gern, ersehnt den Arzt, von seiner Liebe zu lassen.
Was The Raven mir darüber hinaus als bemerkenswert erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass es sich dabei mitnichten, wie man vielleicht meinen könnte, um eine bloße Poe-Adaption handelt, sondern dass hier bereits ein wesentlicher Aspekt des (späteren) Horror- und Gruselfilms vorweg genommen wird: Den der Transponierung der eigenen kulturgeschichtlichen Traditionen als tragendes Element der Erzählung selbst nämlich. Angesiedelt im (damaligen) Hier und Jetzt, spielt Lugosi den Arzt Richard Vollin, der sich ganz der Forschung verschrieben hat. Vor allem aber ist er ein in der Seele dunkler Poe-Verehrer, dessen Leidenschaft ihn gar soweit getrieben hat, in einem geheimen Gewölbe seines Anwesens eine Folterkammer einzurichten, die originalgetreue Anfertigungen aller bei Poe beschriebenen Folterinstrumente ausstellt. Als die Tochter von Richter Thatcher, Jean, infolge eines Autounfalls - die erste Szene des Films, eine ganz wunderbare Miniatur der Miniaturfilmkunst - für ewig entstellt zu sein droht, kehrt der zunächst unwillige Vollin in die Praxis zurück, nachdem Thatcher dem offensichtlichen Narziss genügend Honig um den Mund geschmiert hat. Das Werk gelingt, die Schönheit wird gerettet, doch der düster sinnierende Doktor verliebt sich in Jean und sie in ihn. Das wiederum sieht der Vater gar nicht gern, ersehnt den Arzt, von seiner Liebe zu lassen.Ein Instrument zur Rache findet der Gekränkte schließlich in dem entflohenen Zuchthausinsassen Bateman (Karloff), der den Medicus in einer stürmischen Nacht ebenfalls um eine Korrektur seines Gesichts bittet, aus offen praktischen, wie weltanschaulichen Gründen: Ein hässlicher Mensch, so habe man ihm gesagt, vollbringe auch hässliche Taten. Von einem angenehmeren Äußeren verspreche er sich endlich eine Abkehr vom Pfad der Mörder und Verbrecher. Dieser achtlose Ausspruch ruft den diabolisch-morbiden Arzt auf den Plan: Er entstellt Bateman auf groteske Weise und macht ihn sich, mit Aussicht auf Besserung seiner äußerlichen Erscheinung, gefügig. Während einer Wochenendgesellschaft, zu der der Arzt auch den Richter, seine Tochter und deren Verlobten lädt, soll Bateman ihm mörderische Dienste in der Folterkammer erweisen, dann, so Vollin, erlöse er den Entstellten auch von seinem Antlitz ...
 Natürlich ist ein Gruselfilm jener Tage heutzutage meist nur noch vermindert im Sinne seiner primären Intention erfolgreich. Auch The Raven macht da keinen Unterschied und begeistert weniger als schaurige Mär, sondern vor allem als historisches Dokument seiner Gattung: Der Gedanke des Archivs, der den Horrorfilm schon bald trägt, die möglichst dichte Einschreibung der eigenen Kultur- und Literaturgeschichte in seine je jüngsten Elaborate findet sich hier bereits in Ansätzen implementiert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit ist dieser Umstand schon mehr als bemerkenswert, nicht zuletzt deshalb erscheint mir der Film deshalb als für die Geschichte seines Genres immanent wichtig, seine bislang wenig beachtete Rolle daher als Fauxpas der Geschichtsschreibung.
Natürlich ist ein Gruselfilm jener Tage heutzutage meist nur noch vermindert im Sinne seiner primären Intention erfolgreich. Auch The Raven macht da keinen Unterschied und begeistert weniger als schaurige Mär, sondern vor allem als historisches Dokument seiner Gattung: Der Gedanke des Archivs, der den Horrorfilm schon bald trägt, die möglichst dichte Einschreibung der eigenen Kultur- und Literaturgeschichte in seine je jüngsten Elaborate findet sich hier bereits in Ansätzen implementiert. Vor dem Hintergrund der Entstehungszeit ist dieser Umstand schon mehr als bemerkenswert, nicht zuletzt deshalb erscheint mir der Film deshalb als für die Geschichte seines Genres immanent wichtig, seine bislang wenig beachtete Rolle daher als Fauxpas der Geschichtsschreibung.Aber auch jenseits dessen ist The Raven ein kleines, elegantes Fest für die Sinne. Nicht nur die darstellerischen Leistungen der beiden prominenten Hauptdarsteller gereichen ihm zum Gewinn (auch wenn sie - natürlich – nicht unter dem gängigen Begriff „große Schauspielkunst“ einzusortieren wären, aber beide spielen ohnehin in einer sehr eigenen Liga), es finden sich auch zahlreiche kleine schöne Einfälle in der Inszenierung, die das Herz höher schlagen lassen. Der erste Auftritt Lugosis etwa, wenn zu Beginn nur ein übergroßer Schatten eines ausgestopften Rabens zu sehen ist, während Lugosi im Off einige Zeilen aus Poes gleichnamigem Text rezitiert. Die Kamera fährt langsam nach hinten, erschließt das Zimmer, den Raben selbst, schließlich den Tisch, auf dem er steht, und komplettiert den Raum schlussendlich, wenn sie uns zeigt, dass Lugosi keineswegs allein im Raume sitzt. Auch die Szene, in der Lugosi düster sinnierend Klavier spielt, seine Liebe Jean sich im Raum befindet, doch beide voneinander getrennt sind. Lugosi wird durch ein zierendes Geländer gefilmt, wie ein Raubtier in einem Käfig erscheint er dadurch, als er auf sein Instrument einhämmert. Jean indes wird aus dem Kamin heraus gefilmt, so dass das Feuer ihrer Erscheinung als grundierendes Fundament dient. Das ist in zweierlei Hinsicht zu verstehen: Das Feuer als Symbol für Leidenschaft, die der Liebsten entgegen schmachtet, aber auch das Feuer als Symbol für die Hölle, für den Schmerz, der wegen dieser Frau durchlitten wird und die Katastrophe des Films einleitet. Natürlich sind diese beiden Bespiele nur kleine Bonbons (von vielen anderen), nichts wirklich Großartiges oder Visionäres, aber eben doch Details, auf die sich zu achten lohnt, die die Atmosphäre des Films entschieden tragen und schlussendlich auch zu seinem Gelingen beitragen. Ein schöner Film.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: ad personam
22. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Soundtrack-Komponist Jerry Goldsmith>, verantwortlich für die Soundtracks von Star Trek, Planet der Affen, Chinatown und vielen anderen, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Offenbar erlag er im Schlaf seinem Krebsleiden. Alles Weitere siehe google-news.
imdb
imdb
° ° °
Thema: Filmtagebuch: e.f.
21. Juli 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren
gesehen auf DVD
Don Potenzo oder Die Rache der Enthemmten. Und die Welt versinkt in Laich...
 Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...
Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...
Wer? Erraten! Kaum am Tatort des Verbrechens aufgetaucht, hat Küchenpsychologe Kessler dann auch gleich eine profunde Theorie in petto:
"Bei so einem ersetzt das Messer den Penis!" Angesichts dieser Offenbarung dürfte der mittlerweile auf Wolke 7 beheimatete Sigmund Freud wahrscheinlich wie ein großer Napfkuchen gegrinst haben. Andererseits wird diese Theorie tatsächlich dadurch gestützt, dass Stacey seine Morde stets völlig entblößt - im Adamskostüm sozusagen - begeht. Und auch sonst werden natürlich alle hinlänglich bekannten Klischees durchdekliniert, die man gemeinhin einem solchen sexual-pathologischen Tunichtgut zuschreibt:
- schon als Kind Tiere und Mädchen verletzt
- schüchtern-verklemmt
- ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe
- zwanghafter Onanist
- generell unausgeglichen
Grundgütiger, so was kann ja nicht gut gehen! Übrigens recht putzig anzusehen, wie der Film seine holzschnittartigen Theorien auch noch verabsolutiert. Sollten alle Verklemmten eines Tages zu solch rabiaten Mitteln greifen, dann Gnade uns Gott! Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Onanisten auf die Erde zurück! Na, dann wäre aber wirklich das große Schleudertrauma angesagt und zwar dreimal täglich. Abenteuerlich...
 Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.
Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.
Ansonsten werden wieder die üblichen Bronson Topoi verhandelt. Hier insbesondere die vermeintliche Diskrepanz zwischen Rechtsstaat und "Gerechtigkeit". Und für Gerechtigkeit hat Bronson bekanntlich eine Jahreskarte. Sein Gegenspieler Stacey nutzt hingegen jede Lücke des Rechtsstaats aus, um sich aus der Affäre zu ziehen. Und filthy Scumbags wie er, werden bei diesen Versuchen auch noch von den staatlichen Organen nach Leibeskräften unterstützt. Zum Schluß fällt dann aber der verdiente Selbstjustiz-Gnadenhammer und das Gleichgewicht des Universums ist wieder ins Lot gebracht. Fein.
Das ist die unmissverständliche Aussage des Films. Ärgerlich? Nein. So etwas denunziert sich von selbst und kann den Filmgenuss nicht weiter trüben...
Einer der besseren Cop-Filme Bronsons, der teilweise wirklich spannend ist. Mit Action wird daher entsprechend gespart, stattdessen ist gediegener Thrill angesagt. Ich finde es ja immer sehr beklemmend, wenn man in Filmen Serienmördern und ähnlichen Gestalten bei ihrem tristen Alltag beiwohnen muss. Daher schaudert es mich schon ziemlich, Stacey bei seinen glücklosen Anbandelungsversuchen zu beobachten. Leider wird dieses wirkungsvolle Konzept im Laufe der Handlung aufgegeben. Trotzdem ein überaus anständiger Film, der im Ganzen sehr stimmig ist.
imdb
Don Potenzo oder Die Rache der Enthemmten. Und die Welt versinkt in Laich...
 Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...
Mit Kessler fährt man nicht Schlitten, denn Kessler ist ein abgebrühter Bulle von echtem Schrot und Korn. Dem spuckt man nicht ungestraft in die Suppe. Warren Stacey hingegen ist ein impotenter Irrer, dem trotz guten Aussehens und schnieker Kleidung die Damenwelt nicht gerade zu Füßen liegt. Demütigungen und Zurückweisungen sind sein täglich Brot. Nein, ihm fällt wirklich nichts in den Schoß. Sein Zorn ist furchtbar und er beschließt sich an seinem Schicksal zu rächen. Mit einem Messer bewaffnet, macht er sich daran neue Körperöffnungen zu schaffen. Und nur einer kann seinem blutigen Treiben Einhalt gebieten...Wer? Erraten! Kaum am Tatort des Verbrechens aufgetaucht, hat Küchenpsychologe Kessler dann auch gleich eine profunde Theorie in petto:
"Bei so einem ersetzt das Messer den Penis!" Angesichts dieser Offenbarung dürfte der mittlerweile auf Wolke 7 beheimatete Sigmund Freud wahrscheinlich wie ein großer Napfkuchen gegrinst haben. Andererseits wird diese Theorie tatsächlich dadurch gestützt, dass Stacey seine Morde stets völlig entblößt - im Adamskostüm sozusagen - begeht. Und auch sonst werden natürlich alle hinlänglich bekannten Klischees durchdekliniert, die man gemeinhin einem solchen sexual-pathologischen Tunichtgut zuschreibt:
- schon als Kind Tiere und Mädchen verletzt
- schüchtern-verklemmt
- ausgeprägte Minderwertigkeitskomplexe
- zwanghafter Onanist
- generell unausgeglichen
Grundgütiger, so was kann ja nicht gut gehen! Übrigens recht putzig anzusehen, wie der Film seine holzschnittartigen Theorien auch noch verabsolutiert. Sollten alle Verklemmten eines Tages zu solch rabiaten Mitteln greifen, dann Gnade uns Gott! Wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Onanisten auf die Erde zurück! Na, dann wäre aber wirklich das große Schleudertrauma angesagt und zwar dreimal täglich. Abenteuerlich...
 Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.
Stacey muss indes seinem Ruf als zu allem bereiten Vollzeit-Perversen gerecht werden und vertreibt sich daher die sündige Zeit, in dem er hübsche Frauen durch obszöne Telefonanrufe belästigt - bizarrerweise mit spanischem Akzent! Das bringt dann geradezu surrealen Spaß mit sich, bei dem Sprachwissenschaftler und Hobby-Spanier voll auf ihre Kosten kommen. Als der geile Schmutzfink eines Abends des Kesslers schöne Tochter belästigt, spricht er nämlich den famosen Satz: "Ich bin Pedro, das heißt Peter. Ich habe den größten Schwanz, den du je gesehen hast!" Diese Pedro-Peter Erläuterung kann man sich wahrlich in Gold aufwiegen lassen. Das gibt's nur einmal, das kommt nie wieder! Ich habe jetzt noch Lachmuskelkater.Ansonsten werden wieder die üblichen Bronson Topoi verhandelt. Hier insbesondere die vermeintliche Diskrepanz zwischen Rechtsstaat und "Gerechtigkeit". Und für Gerechtigkeit hat Bronson bekanntlich eine Jahreskarte. Sein Gegenspieler Stacey nutzt hingegen jede Lücke des Rechtsstaats aus, um sich aus der Affäre zu ziehen. Und filthy Scumbags wie er, werden bei diesen Versuchen auch noch von den staatlichen Organen nach Leibeskräften unterstützt. Zum Schluß fällt dann aber der verdiente Selbstjustiz-Gnadenhammer und das Gleichgewicht des Universums ist wieder ins Lot gebracht. Fein.
Das ist die unmissverständliche Aussage des Films. Ärgerlich? Nein. So etwas denunziert sich von selbst und kann den Filmgenuss nicht weiter trüben...
Einer der besseren Cop-Filme Bronsons, der teilweise wirklich spannend ist. Mit Action wird daher entsprechend gespart, stattdessen ist gediegener Thrill angesagt. Ich finde es ja immer sehr beklemmend, wenn man in Filmen Serienmördern und ähnlichen Gestalten bei ihrem tristen Alltag beiwohnen muss. Daher schaudert es mich schon ziemlich, Stacey bei seinen glücklosen Anbandelungsversuchen zu beobachten. Leider wird dieses wirkungsvolle Konzept im Laufe der Handlung aufgegeben. Trotzdem ein überaus anständiger Film, der im Ganzen sehr stimmig ist.
imdb
° ° °
Thema: comics
Comics rocken derzeit mein Leben, Film leider nur recht wenig. Allgemein verdanke ich das zum einen diesem kleinen Comicforum bei filmforen.de, das mich auf einige Schmankerl aufmerksam machte, zum anderen meiner glücklicherweise was Comics betrifft recht gut sortierten Kiezbibliothek ein paar Straßen weiter.
 Absolut begeistert hat mich ja Akira, jener Manga, den immer irgendwie jeder kennt und von jedem auch immer als "der beste" ausgewiesen wird. Vermutlich weil keiner Plan von Mangas hat und das eben der ist, den man kennt, den alle kennen. Ob's nun "der beste" ist, kann und will ich nicht beurteilen. Ist auch egal. Dass ich die sechs telefonbuchdicken Schwarten binnen 24 Stunden verschlungen habe, bzw. sie mich verschlungen haben, will ich hingegen nicht verschweigen. Knapp 2200 Seiten - und keine einzige langweilig. Wann habe ich sowas zum letzten Mal gemacht? Diese Begeisterung, dieses Mitfiebern. Mich wieder wie ein Junge gefühlt, der einen Schritt in eine große Welt unternommen hat, die ihm noch unbekannt ist, von der er aber überzeugt ist, dass sie wunderbar ist. Keine Theorien im Kopf gehabt, beim Lesen, keinen Text im Geiste mitgeschrieben, nichts eingeordnet, keine Bezüge ausfindig zu machen versucht. Nichts dergleichen. Einfach nur lesen, lieben. Wie rundum entspannend. Wie absolut vergnüglich.
Absolut begeistert hat mich ja Akira, jener Manga, den immer irgendwie jeder kennt und von jedem auch immer als "der beste" ausgewiesen wird. Vermutlich weil keiner Plan von Mangas hat und das eben der ist, den man kennt, den alle kennen. Ob's nun "der beste" ist, kann und will ich nicht beurteilen. Ist auch egal. Dass ich die sechs telefonbuchdicken Schwarten binnen 24 Stunden verschlungen habe, bzw. sie mich verschlungen haben, will ich hingegen nicht verschweigen. Knapp 2200 Seiten - und keine einzige langweilig. Wann habe ich sowas zum letzten Mal gemacht? Diese Begeisterung, dieses Mitfiebern. Mich wieder wie ein Junge gefühlt, der einen Schritt in eine große Welt unternommen hat, die ihm noch unbekannt ist, von der er aber überzeugt ist, dass sie wunderbar ist. Keine Theorien im Kopf gehabt, beim Lesen, keinen Text im Geiste mitgeschrieben, nichts eingeordnet, keine Bezüge ausfindig zu machen versucht. Nichts dergleichen. Einfach nur lesen, lieben. Wie rundum entspannend. Wie absolut vergnüglich.
Was für ein tolles Stück Literatur. (Preacher im übrigen auch, aber das wäre ein weiteres Fass, das es zu aufzumachen gälte, aber wenn Sie verzeihen: Die Sonne scheint, der Balkon lacht mich an, neue Comics aus der Bibliothek liegen neben einer Kanne Kaffee bereit.)
 Absolut begeistert hat mich ja Akira, jener Manga, den immer irgendwie jeder kennt und von jedem auch immer als "der beste" ausgewiesen wird. Vermutlich weil keiner Plan von Mangas hat und das eben der ist, den man kennt, den alle kennen. Ob's nun "der beste" ist, kann und will ich nicht beurteilen. Ist auch egal. Dass ich die sechs telefonbuchdicken Schwarten binnen 24 Stunden verschlungen habe, bzw. sie mich verschlungen haben, will ich hingegen nicht verschweigen. Knapp 2200 Seiten - und keine einzige langweilig. Wann habe ich sowas zum letzten Mal gemacht? Diese Begeisterung, dieses Mitfiebern. Mich wieder wie ein Junge gefühlt, der einen Schritt in eine große Welt unternommen hat, die ihm noch unbekannt ist, von der er aber überzeugt ist, dass sie wunderbar ist. Keine Theorien im Kopf gehabt, beim Lesen, keinen Text im Geiste mitgeschrieben, nichts eingeordnet, keine Bezüge ausfindig zu machen versucht. Nichts dergleichen. Einfach nur lesen, lieben. Wie rundum entspannend. Wie absolut vergnüglich.
Absolut begeistert hat mich ja Akira, jener Manga, den immer irgendwie jeder kennt und von jedem auch immer als "der beste" ausgewiesen wird. Vermutlich weil keiner Plan von Mangas hat und das eben der ist, den man kennt, den alle kennen. Ob's nun "der beste" ist, kann und will ich nicht beurteilen. Ist auch egal. Dass ich die sechs telefonbuchdicken Schwarten binnen 24 Stunden verschlungen habe, bzw. sie mich verschlungen haben, will ich hingegen nicht verschweigen. Knapp 2200 Seiten - und keine einzige langweilig. Wann habe ich sowas zum letzten Mal gemacht? Diese Begeisterung, dieses Mitfiebern. Mich wieder wie ein Junge gefühlt, der einen Schritt in eine große Welt unternommen hat, die ihm noch unbekannt ist, von der er aber überzeugt ist, dass sie wunderbar ist. Keine Theorien im Kopf gehabt, beim Lesen, keinen Text im Geiste mitgeschrieben, nichts eingeordnet, keine Bezüge ausfindig zu machen versucht. Nichts dergleichen. Einfach nur lesen, lieben. Wie rundum entspannend. Wie absolut vergnüglich.Was für ein tolles Stück Literatur. (Preacher im übrigen auch, aber das wäre ein weiteres Fass, das es zu aufzumachen gälte, aber wenn Sie verzeihen: Die Sonne scheint, der Balkon lacht mich an, neue Comics aus der Bibliothek liegen neben einer Kanne Kaffee bereit.)
° ° °
Thema: Alltag, medial gedoppelt
War er dann aber doch nicht.
° ° °
Thema: Filmtagebuch
18. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
vor einigen Tagen im Heimkino gesehen
Der Fall liegt ähnlich wie auch schon bei Undead : Geeks machen 'nen Film über Geeks, die in einem Geekfilm so ziemlich geekig sind. Zwei gerademal so nicht mehr als Jungs zu bezeichnende Jungs fahren mit dem Auto quer durch die Pampa. Es geht zur Hochzeit des Jugendschwarms des einen, der es natürlich nie zu mehr als dem gefürchteten "besten Freund" gepackt hat. Ist auch eher ein Wimp, der Typ, und penibel ohne Ende. Sein Kumpel, der sich bei der Reise eher zum Mißfallen des anderen eingezeckt hat, ist das glatte Gegenteil: Fett, ausfallend, geil auf Weiber und nie um 'nen derben Streich verlegen. In einer Raststätte mault er etwas zu krass gegen das dort versammelte Redneck-Volk und schon klebt den Beiden ein rostiger Monstertruck dicht an den Fersen, dessen Fahrer eher unter "bizarres Leichenstückflickwerk" als unter Homo Sapiens einzuordnen ist. Ein Mädel kommt auch noch dazu. Jungsscherze, haha, während sie schläft an die Titten fassen und so. Wie unwitzig. Und gegen Ende, nach vielen weiteren pickligen Pubertätsgags - Haha, mit dem Gesicht voll in den Leichenmansch! - kommt's zum derben Finale in einer Holzhütte.
 Auch hier erstaunlich, wie wenig der Film funktioniert. Von den ganzen Zoten, die die beiden Typen zum Besten geben (oder aber: durchmachen), zündet keine einzige. Bis im Film endlich mal sowas wie Spannung entsteht, hat er schon viel zu lange gedauert und den Punkt schon überschritten, an dem man noch bereit wäre, sich nochmal auf den Film einzustellen: Ganz egal das alles, kommt nur endlich zum Beschluss. Ein paar Splattereien dann noch, die wirkungslos verpuffen, ein Plottwist, der, gelinde gesagt, erahnbar war, ein dümmliches Ende: Gemeinsam fahren die beiden Pizzanerds, nein, nicht in den Sonnenuntergang, aber zurück ins sämig-gemütliche Jungsuniversum: Der eine ist kein wimp mehr, der andere hat ihn endlich bekehrt. Lass' doch den romantischen Schmu. Zurück in einer Welt aus Playstation, leeren Pizzaschachteln und groben Sprüchen über Titten und Muschis. Wenn die beiden wenigstens knutschen würden. Doch Gott bewahre, das wäre von einem so faden Machwerk wie diesem zuviel der Subversion verlangt.
Auch hier erstaunlich, wie wenig der Film funktioniert. Von den ganzen Zoten, die die beiden Typen zum Besten geben (oder aber: durchmachen), zündet keine einzige. Bis im Film endlich mal sowas wie Spannung entsteht, hat er schon viel zu lange gedauert und den Punkt schon überschritten, an dem man noch bereit wäre, sich nochmal auf den Film einzustellen: Ganz egal das alles, kommt nur endlich zum Beschluss. Ein paar Splattereien dann noch, die wirkungslos verpuffen, ein Plottwist, der, gelinde gesagt, erahnbar war, ein dümmliches Ende: Gemeinsam fahren die beiden Pizzanerds, nein, nicht in den Sonnenuntergang, aber zurück ins sämig-gemütliche Jungsuniversum: Der eine ist kein wimp mehr, der andere hat ihn endlich bekehrt. Lass' doch den romantischen Schmu. Zurück in einer Welt aus Playstation, leeren Pizzaschachteln und groben Sprüchen über Titten und Muschis. Wenn die beiden wenigstens knutschen würden. Doch Gott bewahre, das wäre von einem so faden Machwerk wie diesem zuviel der Subversion verlangt.
imdb
Der Fall liegt ähnlich wie auch schon bei Undead : Geeks machen 'nen Film über Geeks, die in einem Geekfilm so ziemlich geekig sind. Zwei gerademal so nicht mehr als Jungs zu bezeichnende Jungs fahren mit dem Auto quer durch die Pampa. Es geht zur Hochzeit des Jugendschwarms des einen, der es natürlich nie zu mehr als dem gefürchteten "besten Freund" gepackt hat. Ist auch eher ein Wimp, der Typ, und penibel ohne Ende. Sein Kumpel, der sich bei der Reise eher zum Mißfallen des anderen eingezeckt hat, ist das glatte Gegenteil: Fett, ausfallend, geil auf Weiber und nie um 'nen derben Streich verlegen. In einer Raststätte mault er etwas zu krass gegen das dort versammelte Redneck-Volk und schon klebt den Beiden ein rostiger Monstertruck dicht an den Fersen, dessen Fahrer eher unter "bizarres Leichenstückflickwerk" als unter Homo Sapiens einzuordnen ist. Ein Mädel kommt auch noch dazu. Jungsscherze, haha, während sie schläft an die Titten fassen und so. Wie unwitzig. Und gegen Ende, nach vielen weiteren pickligen Pubertätsgags - Haha, mit dem Gesicht voll in den Leichenmansch! - kommt's zum derben Finale in einer Holzhütte.
 Auch hier erstaunlich, wie wenig der Film funktioniert. Von den ganzen Zoten, die die beiden Typen zum Besten geben (oder aber: durchmachen), zündet keine einzige. Bis im Film endlich mal sowas wie Spannung entsteht, hat er schon viel zu lange gedauert und den Punkt schon überschritten, an dem man noch bereit wäre, sich nochmal auf den Film einzustellen: Ganz egal das alles, kommt nur endlich zum Beschluss. Ein paar Splattereien dann noch, die wirkungslos verpuffen, ein Plottwist, der, gelinde gesagt, erahnbar war, ein dümmliches Ende: Gemeinsam fahren die beiden Pizzanerds, nein, nicht in den Sonnenuntergang, aber zurück ins sämig-gemütliche Jungsuniversum: Der eine ist kein wimp mehr, der andere hat ihn endlich bekehrt. Lass' doch den romantischen Schmu. Zurück in einer Welt aus Playstation, leeren Pizzaschachteln und groben Sprüchen über Titten und Muschis. Wenn die beiden wenigstens knutschen würden. Doch Gott bewahre, das wäre von einem so faden Machwerk wie diesem zuviel der Subversion verlangt.
Auch hier erstaunlich, wie wenig der Film funktioniert. Von den ganzen Zoten, die die beiden Typen zum Besten geben (oder aber: durchmachen), zündet keine einzige. Bis im Film endlich mal sowas wie Spannung entsteht, hat er schon viel zu lange gedauert und den Punkt schon überschritten, an dem man noch bereit wäre, sich nochmal auf den Film einzustellen: Ganz egal das alles, kommt nur endlich zum Beschluss. Ein paar Splattereien dann noch, die wirkungslos verpuffen, ein Plottwist, der, gelinde gesagt, erahnbar war, ein dümmliches Ende: Gemeinsam fahren die beiden Pizzanerds, nein, nicht in den Sonnenuntergang, aber zurück ins sämig-gemütliche Jungsuniversum: Der eine ist kein wimp mehr, der andere hat ihn endlich bekehrt. Lass' doch den romantischen Schmu. Zurück in einer Welt aus Playstation, leeren Pizzaschachteln und groben Sprüchen über Titten und Muschis. Wenn die beiden wenigstens knutschen würden. Doch Gott bewahre, das wäre von einem so faden Machwerk wie diesem zuviel der Subversion verlangt.imdb
° ° °
Thema: Filmtagebuch: e.f.
18. Juli 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren
gesehen auf DVD
Ein unbedarfter Mann, meist noch Junggeselle, wird unverschuldet in dubiose Geschehnisse hineingezogen und muss auf eigene Faust seinen diskreditierten Ruf wiederherstellen. "Ja, ja - Seit Hitchcock alles altbekannt!" hört man da schon das cinephile Lumpenproletariat aufschreien. "De Palma? Reiner Stilist , der nur ein Rip-Off nach dem anderen runterdreht. Völlig Überschätzt!"
Von wegen...
 Jake ist ein vagabundierender Schauspieler, der sich mit mittelmäßigen Rollen - in noch viel mittelmäßigeren Filmen -, mehr schlecht als Recht über Wasser halten kann. Hat man schon kein Glück, kommt noch das Pech dazu: Eines Tages erwischt er seine Freundin beim Fremdgehen in der gemeinsamen Bleibe. Doch leider ist es ihre Wohnung und Jake sitzt im Handumdrehen auf der Strasse. Mittellos und ziemlich runter mit den Nerven. Als ihm eines Tages ein neuer Bekannter von der Schauspielschule eine luxuriöse Wohnung zur Überbrückung anbietet, scheint sich das Blatt zu wenden. Der Clou: In der Wohnung befindet sich ein Teleskop, mit dem Jake, auf Anraten seines neuen Freundes, eine Frau namens Gloria im Haus gegenüber bei ihren abendlichen Entblätterungen beobachtet. Immer zur gleichen Urzeit.
Jake ist ein vagabundierender Schauspieler, der sich mit mittelmäßigen Rollen - in noch viel mittelmäßigeren Filmen -, mehr schlecht als Recht über Wasser halten kann. Hat man schon kein Glück, kommt noch das Pech dazu: Eines Tages erwischt er seine Freundin beim Fremdgehen in der gemeinsamen Bleibe. Doch leider ist es ihre Wohnung und Jake sitzt im Handumdrehen auf der Strasse. Mittellos und ziemlich runter mit den Nerven. Als ihm eines Tages ein neuer Bekannter von der Schauspielschule eine luxuriöse Wohnung zur Überbrückung anbietet, scheint sich das Blatt zu wenden. Der Clou: In der Wohnung befindet sich ein Teleskop, mit dem Jake, auf Anraten seines neuen Freundes, eine Frau namens Gloria im Haus gegenüber bei ihren abendlichen Entblätterungen beobachtet. Immer zur gleichen Urzeit.
Eines Abends wird er dabei auf einen verdächtig wirkenden Mann - einen Indianer - aufmerksam, der seine Blicke ebenfalls mächtig schweifen lässt. Jake, der durch seine Spannereien mittlerweile ein immer obsessiveres Verhältnis zu Gloria entwickelt hat, kommt die Sache spanisch vor und beginnt ihr nachzustellen. Dabei stellt er sich leider nicht sonderlich geschickt an und erweckt zu allem Überfluss noch den Anschein ein freakiger Perverser zu sein. Sein Herumstromern an Geschäften für Damenunterwäsche zwecks Observation trägt auch nicht gerade dazu bei diesen Eindruck zu zerstreuen. Am Strand wird Gloria vom Indianer plötzlich die Handtasche entrissen. Jake nimmt die Verfolgung auf, kann ihn aber nicht stoppen.
Am nächsten Abend muss er über Teleskop mit ansehen, wie sie von dem Indianer auf grausame Art und Weise ermordet wird...
Klingt in der Tat noch alles etwas konventionell nach Schema Hitchcock. Sicher, es tummeln sich auch auffällig viele formale und inhaltliche Elemente im Film, die diesen Schluss zulassen. Technisch unzureichende Rückprojektionen, der Protagonist muss sich aus ominösen Verstrickungen befreien etc etc. Und dann noch die offensichtlichen Anlehnungen an Vertigo oder Das Fenster zum Hof. Kommt einem doch alles sehr bekannt vor. Auf den ersten Blick. Und dieser täuscht bei de Palma ja bekanntermaßen sowieso meist. Tatsächlich dient Brian de Palma dieses Konjugieren bekannter Klischees nur dazu, seine Vorstellung von Kino paradigmatisch auf den Punkt zu bringen. Und das bedeutet Illusion und Fassade. Nichts ist wie es scheint. Eine Thematik, die sich wie ein roter Faden durch de Palmas Filmographie zieht, aber in keinem seiner Werke eine derartige Zuspitzung erfährt, wie in Body Double.
 Relativ zu Beginn des Films sieht man eine staubige Wüstenlandschaft. Sie entspricht genau dem Bild, das man von solch einem Ort im Kopf hat. Plötzlich neigt sich das Panorama, fluchtet gegen jede natürliche Perspektive. Es war eine Attrappe. Ein ordinärer Hintergrund für eine Studioproduktion. Trotzdem hätte es auch eine wirkliche Wüste sein können. Wirklich im Sinne einer innerfilmischen Realität. Was es anfänglich - bevor die Illusion kippte - ja auch war. Die Personen, die die Szenerie des Films bevölkern, sind nur die fleischgewordene Fortführung dieses Prinzips. Ein netter, verständnisvoller Regisseur tauscht ohne mit der Wimper zu Zucken klammheimlich seinen Hauptdarsteller aus. Eine ach so abgebrühte Pornodarstellerin fällt auf einen abgebrannten Schauspieler herein, der sie mit einem Lächeln und ein paar leeren Versprechungen um den Finger wickelt. Der eigentliche Fall ist zwar sehr spannend, aber auf rührende Weise völlig unerheblich. Auch Jake, der Mann mit dem Teleskop - bei Hitchcock eine gottgleiche Figur, die sieht, ohne selbst gesehen zu werden - ist ein Getriebener. Im Gegensatz zu James Steward wird er gesehen, wird er manipuliert, wird er benutzt. Und alles was er sieht entpuppt sich als großer Schwindel.
Relativ zu Beginn des Films sieht man eine staubige Wüstenlandschaft. Sie entspricht genau dem Bild, das man von solch einem Ort im Kopf hat. Plötzlich neigt sich das Panorama, fluchtet gegen jede natürliche Perspektive. Es war eine Attrappe. Ein ordinärer Hintergrund für eine Studioproduktion. Trotzdem hätte es auch eine wirkliche Wüste sein können. Wirklich im Sinne einer innerfilmischen Realität. Was es anfänglich - bevor die Illusion kippte - ja auch war. Die Personen, die die Szenerie des Films bevölkern, sind nur die fleischgewordene Fortführung dieses Prinzips. Ein netter, verständnisvoller Regisseur tauscht ohne mit der Wimper zu Zucken klammheimlich seinen Hauptdarsteller aus. Eine ach so abgebrühte Pornodarstellerin fällt auf einen abgebrannten Schauspieler herein, der sie mit einem Lächeln und ein paar leeren Versprechungen um den Finger wickelt. Der eigentliche Fall ist zwar sehr spannend, aber auf rührende Weise völlig unerheblich. Auch Jake, der Mann mit dem Teleskop - bei Hitchcock eine gottgleiche Figur, die sieht, ohne selbst gesehen zu werden - ist ein Getriebener. Im Gegensatz zu James Steward wird er gesehen, wird er manipuliert, wird er benutzt. Und alles was er sieht entpuppt sich als großer Schwindel.
Meta-Kino in Formvollendung.
Dann, ganz am Ende, - der Mord ist nun endlich aufgeklärt - produziert Hollywood weiter Illusionen, als ob nichts gewesen wäre. Und ich freue mich. Begierig darauf von neuem getäuscht zu werden.
Die Kamera belügt mich, betrügt mich. Immer wieder hintergeht sie mich. Und wieder und wieder verzeihe ich ihr. Denn ich will es ja so. Kino ist ein tröstlicher Masochismus. Ein magisches Paradox. Verlässlich im Unzuverlässigen. Ehrlich noch in der Zweideutigkeit. Und dann doch wieder ganz anders.
Ich liebe es von ganzem Herzen.
De Palmas bester Film.
imdb | mrqe
Ein unbedarfter Mann, meist noch Junggeselle, wird unverschuldet in dubiose Geschehnisse hineingezogen und muss auf eigene Faust seinen diskreditierten Ruf wiederherstellen. "Ja, ja - Seit Hitchcock alles altbekannt!" hört man da schon das cinephile Lumpenproletariat aufschreien. "De Palma? Reiner Stilist , der nur ein Rip-Off nach dem anderen runterdreht. Völlig Überschätzt!"
Von wegen...
 Jake ist ein vagabundierender Schauspieler, der sich mit mittelmäßigen Rollen - in noch viel mittelmäßigeren Filmen -, mehr schlecht als Recht über Wasser halten kann. Hat man schon kein Glück, kommt noch das Pech dazu: Eines Tages erwischt er seine Freundin beim Fremdgehen in der gemeinsamen Bleibe. Doch leider ist es ihre Wohnung und Jake sitzt im Handumdrehen auf der Strasse. Mittellos und ziemlich runter mit den Nerven. Als ihm eines Tages ein neuer Bekannter von der Schauspielschule eine luxuriöse Wohnung zur Überbrückung anbietet, scheint sich das Blatt zu wenden. Der Clou: In der Wohnung befindet sich ein Teleskop, mit dem Jake, auf Anraten seines neuen Freundes, eine Frau namens Gloria im Haus gegenüber bei ihren abendlichen Entblätterungen beobachtet. Immer zur gleichen Urzeit.
Jake ist ein vagabundierender Schauspieler, der sich mit mittelmäßigen Rollen - in noch viel mittelmäßigeren Filmen -, mehr schlecht als Recht über Wasser halten kann. Hat man schon kein Glück, kommt noch das Pech dazu: Eines Tages erwischt er seine Freundin beim Fremdgehen in der gemeinsamen Bleibe. Doch leider ist es ihre Wohnung und Jake sitzt im Handumdrehen auf der Strasse. Mittellos und ziemlich runter mit den Nerven. Als ihm eines Tages ein neuer Bekannter von der Schauspielschule eine luxuriöse Wohnung zur Überbrückung anbietet, scheint sich das Blatt zu wenden. Der Clou: In der Wohnung befindet sich ein Teleskop, mit dem Jake, auf Anraten seines neuen Freundes, eine Frau namens Gloria im Haus gegenüber bei ihren abendlichen Entblätterungen beobachtet. Immer zur gleichen Urzeit.Eines Abends wird er dabei auf einen verdächtig wirkenden Mann - einen Indianer - aufmerksam, der seine Blicke ebenfalls mächtig schweifen lässt. Jake, der durch seine Spannereien mittlerweile ein immer obsessiveres Verhältnis zu Gloria entwickelt hat, kommt die Sache spanisch vor und beginnt ihr nachzustellen. Dabei stellt er sich leider nicht sonderlich geschickt an und erweckt zu allem Überfluss noch den Anschein ein freakiger Perverser zu sein. Sein Herumstromern an Geschäften für Damenunterwäsche zwecks Observation trägt auch nicht gerade dazu bei diesen Eindruck zu zerstreuen. Am Strand wird Gloria vom Indianer plötzlich die Handtasche entrissen. Jake nimmt die Verfolgung auf, kann ihn aber nicht stoppen.
Am nächsten Abend muss er über Teleskop mit ansehen, wie sie von dem Indianer auf grausame Art und Weise ermordet wird...
Klingt in der Tat noch alles etwas konventionell nach Schema Hitchcock. Sicher, es tummeln sich auch auffällig viele formale und inhaltliche Elemente im Film, die diesen Schluss zulassen. Technisch unzureichende Rückprojektionen, der Protagonist muss sich aus ominösen Verstrickungen befreien etc etc. Und dann noch die offensichtlichen Anlehnungen an Vertigo oder Das Fenster zum Hof. Kommt einem doch alles sehr bekannt vor. Auf den ersten Blick. Und dieser täuscht bei de Palma ja bekanntermaßen sowieso meist. Tatsächlich dient Brian de Palma dieses Konjugieren bekannter Klischees nur dazu, seine Vorstellung von Kino paradigmatisch auf den Punkt zu bringen. Und das bedeutet Illusion und Fassade. Nichts ist wie es scheint. Eine Thematik, die sich wie ein roter Faden durch de Palmas Filmographie zieht, aber in keinem seiner Werke eine derartige Zuspitzung erfährt, wie in Body Double.
 Relativ zu Beginn des Films sieht man eine staubige Wüstenlandschaft. Sie entspricht genau dem Bild, das man von solch einem Ort im Kopf hat. Plötzlich neigt sich das Panorama, fluchtet gegen jede natürliche Perspektive. Es war eine Attrappe. Ein ordinärer Hintergrund für eine Studioproduktion. Trotzdem hätte es auch eine wirkliche Wüste sein können. Wirklich im Sinne einer innerfilmischen Realität. Was es anfänglich - bevor die Illusion kippte - ja auch war. Die Personen, die die Szenerie des Films bevölkern, sind nur die fleischgewordene Fortführung dieses Prinzips. Ein netter, verständnisvoller Regisseur tauscht ohne mit der Wimper zu Zucken klammheimlich seinen Hauptdarsteller aus. Eine ach so abgebrühte Pornodarstellerin fällt auf einen abgebrannten Schauspieler herein, der sie mit einem Lächeln und ein paar leeren Versprechungen um den Finger wickelt. Der eigentliche Fall ist zwar sehr spannend, aber auf rührende Weise völlig unerheblich. Auch Jake, der Mann mit dem Teleskop - bei Hitchcock eine gottgleiche Figur, die sieht, ohne selbst gesehen zu werden - ist ein Getriebener. Im Gegensatz zu James Steward wird er gesehen, wird er manipuliert, wird er benutzt. Und alles was er sieht entpuppt sich als großer Schwindel.
Relativ zu Beginn des Films sieht man eine staubige Wüstenlandschaft. Sie entspricht genau dem Bild, das man von solch einem Ort im Kopf hat. Plötzlich neigt sich das Panorama, fluchtet gegen jede natürliche Perspektive. Es war eine Attrappe. Ein ordinärer Hintergrund für eine Studioproduktion. Trotzdem hätte es auch eine wirkliche Wüste sein können. Wirklich im Sinne einer innerfilmischen Realität. Was es anfänglich - bevor die Illusion kippte - ja auch war. Die Personen, die die Szenerie des Films bevölkern, sind nur die fleischgewordene Fortführung dieses Prinzips. Ein netter, verständnisvoller Regisseur tauscht ohne mit der Wimper zu Zucken klammheimlich seinen Hauptdarsteller aus. Eine ach so abgebrühte Pornodarstellerin fällt auf einen abgebrannten Schauspieler herein, der sie mit einem Lächeln und ein paar leeren Versprechungen um den Finger wickelt. Der eigentliche Fall ist zwar sehr spannend, aber auf rührende Weise völlig unerheblich. Auch Jake, der Mann mit dem Teleskop - bei Hitchcock eine gottgleiche Figur, die sieht, ohne selbst gesehen zu werden - ist ein Getriebener. Im Gegensatz zu James Steward wird er gesehen, wird er manipuliert, wird er benutzt. Und alles was er sieht entpuppt sich als großer Schwindel.Meta-Kino in Formvollendung.
Dann, ganz am Ende, - der Mord ist nun endlich aufgeklärt - produziert Hollywood weiter Illusionen, als ob nichts gewesen wäre. Und ich freue mich. Begierig darauf von neuem getäuscht zu werden.
Die Kamera belügt mich, betrügt mich. Immer wieder hintergeht sie mich. Und wieder und wieder verzeihe ich ihr. Denn ich will es ja so. Kino ist ein tröstlicher Masochismus. Ein magisches Paradox. Verlässlich im Unzuverlässigen. Ehrlich noch in der Zweideutigkeit. Und dann doch wieder ganz anders.
Ich liebe es von ganzem Herzen.
De Palmas bester Film.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Filmtagebuch: e.f.
17. Juli 04 | Autor: e.f. | 2 Kommentare | Kommentieren
gesehen auf DVD
Mondo Debilo
Heiliger BimBam! So ein Ausbund an Absurditäten - ich weiß jetzt gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Eins ist jedenfalls schon mal klar: Milius hält mit seiner politischen Meinung nicht hinter dem Berg, was im Grunde beinahe anerkennenswert ist. Sein Ziel ist es alles aufzuzeigen, was gut und richtig am nationalen Charakter ist. Beschworen andere amerikanische Filme, insbesonders solche der Reagan-Ära, oftmals diffuse Metaphern für das "Reich des Bösen" (Ausserirdische Agressoren, Naturkatastrophen etc), sind die Fronten bei Red Dawn klar verteilt. Da wird gar nicht lange hinten rum gehoben: Der Russe ist böse, der Russe muss weg!
 Entsprechend ist auch der Zuschnitt der Story. Eines Morgens landen in einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt sowjetische und kubanische Truppen mit Fallschirmen auf dem Gelände der örtlichen Schule. Besonders schön ist, dass die Schüler gerade von ihrem Lehrer über die "Grausamkeiten der Mongolen" aufgeklärt werden, was mich direkt an Ekel Alfred erinnerte, der ebenfalls immer eindringlich vor dem Ansturm der Mongolen (= Russen) warnte. Als der begnadetet Pädagoge dann mal draussen nach dem Rechten sehen will , wird er ohne viel Federlesens direkt über den Haufen geschossen. Paff! Ein paar der Schüler, zu allem Überfluss noch Mitglieder des Fottballteams, können sich mit einem Pick-Up in die Berge retten. Dort beschließt man die kommunistischen Invasoren mit Partisanenkampf in die Flucht zu schlagen. Doch bis das Ziel erreicht ist, muss der Baum der Freiheit erst mal ordentlich mit Blut gegossen werden.
Entsprechend ist auch der Zuschnitt der Story. Eines Morgens landen in einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt sowjetische und kubanische Truppen mit Fallschirmen auf dem Gelände der örtlichen Schule. Besonders schön ist, dass die Schüler gerade von ihrem Lehrer über die "Grausamkeiten der Mongolen" aufgeklärt werden, was mich direkt an Ekel Alfred erinnerte, der ebenfalls immer eindringlich vor dem Ansturm der Mongolen (= Russen) warnte. Als der begnadetet Pädagoge dann mal draussen nach dem Rechten sehen will , wird er ohne viel Federlesens direkt über den Haufen geschossen. Paff! Ein paar der Schüler, zu allem Überfluss noch Mitglieder des Fottballteams, können sich mit einem Pick-Up in die Berge retten. Dort beschließt man die kommunistischen Invasoren mit Partisanenkampf in die Flucht zu schlagen. Doch bis das Ziel erreicht ist, muss der Baum der Freiheit erst mal ordentlich mit Blut gegossen werden.
Ironischerweise kommuniziert der Film aber, dass Freiheit und Demokratie nur mit Faschismus erreicht werden können. Das sieht bei Milius so aus: Patrick Swayze schwingt sich zum Gröfaz der Gruppe auf, die nach dem Führerprinzip organisiert, und mit dem markigen Namen "Wolferines" versehen wird. Garniert wird das Ganze dann mit reichlich Esoterik und Blut-Mystik. So zwingen die älteren Gruppenmitglieder bei der Jagt - Scheiße im, Tannenzweige auf dem Kopf - einen Fünfzehnjährigen das Blut eines frisch erlegten Bockes zu trinken. ("Das musst Du tun, dann geht sein Geist in Dich über!") Das dieses Verständnis von Freiheit eine Pervertierung aller Werte für die Amerika steht darstellt, wird John Milius wahrscheinlich nicht in seinen runden Kopf hineinkriegen.
Um diese Exzesse zu rechtfertigen, werden die Sowjets entsprechend sterotypisiert gezeichnet. Martialische Gestalten mit prächtigen Schnurrbärten, die sich gerne mal an den amerikanischen Landpommeranzen vergreifen. In Windeseile hat der Iwan dann auch ein strenges Regime in der Stadt installiert: Überall klebt Lenin an der Wand, im Kino läuft nur Mist und besonders subversive Einwohner kommen in das "Umerziehungslager", welches im ehemaligen Drive-In untergebracht ist. Auch Massenhinrichtungen sind an der Tagesordnung, vor Zivilisten wird kein Halt gemacht. Einmal stimmt eine Gruppe zum Tode Verurteilter mit völlig falscher Tonlage "America the Beautiful" an. Die Sowiets bieten dem Katzenjammer daraufhin mit der geballten Macht der Gewehre Einhalt.
 Da Milius sein Herz aber auf dem rechten Fleck hat, ist auch besinnlichere Momente gesorgt. Als Sheen und Swayze ihren internierten Vater im Lager besuchen, erinnert man sich unter Tränen an die sonnige Kindheit und den ausgelassenen Spass, den man gemeinsam auf der Spielplatzschaukel hatte. Doch plötzlich wird der Herr Papa dienstlich:"Ihr dürft nie wieder weinen! Nie wieder!" und "Rächt uns meine Söhne! Rächt uns alle!" schalmeit er den Früchten seiner Lenden entgegen. Die braven Jungs versprechen es und der alte Arsch kann beruhigt in die kühle Grube sinken. Anscheinend hat Milus als Kind vom Vater ordentlich welche mit dem "Tröster" hinten drauf bekommen, anders ist dieses Delirium beim besten Willen nicht zu erklären.
Da Milius sein Herz aber auf dem rechten Fleck hat, ist auch besinnlichere Momente gesorgt. Als Sheen und Swayze ihren internierten Vater im Lager besuchen, erinnert man sich unter Tränen an die sonnige Kindheit und den ausgelassenen Spass, den man gemeinsam auf der Spielplatzschaukel hatte. Doch plötzlich wird der Herr Papa dienstlich:"Ihr dürft nie wieder weinen! Nie wieder!" und "Rächt uns meine Söhne! Rächt uns alle!" schalmeit er den Früchten seiner Lenden entgegen. Die braven Jungs versprechen es und der alte Arsch kann beruhigt in die kühle Grube sinken. Anscheinend hat Milus als Kind vom Vater ordentlich welche mit dem "Tröster" hinten drauf bekommen, anders ist dieses Delirium beim besten Willen nicht zu erklären.
Bemerkenswert ist auch die Brutalität und Kaltschnäutzigkeit, mit der der Film zu Werke geht. Da werden schon mal wehrlose Gegner abgeknallt oder mit Schlägen zum Reden gebracht. Der Hinweis eines russischen Soldaten auf die Genfer Konventionen wird mit einem hämischen "Kenne ich nicht!" abschlägig beschieden. Er und ein Verräter werden wenig später ohne viel Aufhebens erschossen.
Der Wahnsinn auf Stelzen! Wenigsten hat Milius auf die, von Eastwood in Heartbreak Ridge aufgefahrenen, unterschwellig-agressiven Schwulitäten verzichtet, sonst hätte man sich ja gleich den Strick nehmen können...
imdb
Mondo Debilo
Heiliger BimBam! So ein Ausbund an Absurditäten - ich weiß jetzt gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Eins ist jedenfalls schon mal klar: Milius hält mit seiner politischen Meinung nicht hinter dem Berg, was im Grunde beinahe anerkennenswert ist. Sein Ziel ist es alles aufzuzeigen, was gut und richtig am nationalen Charakter ist. Beschworen andere amerikanische Filme, insbesonders solche der Reagan-Ära, oftmals diffuse Metaphern für das "Reich des Bösen" (Ausserirdische Agressoren, Naturkatastrophen etc), sind die Fronten bei Red Dawn klar verteilt. Da wird gar nicht lange hinten rum gehoben: Der Russe ist böse, der Russe muss weg!
 Entsprechend ist auch der Zuschnitt der Story. Eines Morgens landen in einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt sowjetische und kubanische Truppen mit Fallschirmen auf dem Gelände der örtlichen Schule. Besonders schön ist, dass die Schüler gerade von ihrem Lehrer über die "Grausamkeiten der Mongolen" aufgeklärt werden, was mich direkt an Ekel Alfred erinnerte, der ebenfalls immer eindringlich vor dem Ansturm der Mongolen (= Russen) warnte. Als der begnadetet Pädagoge dann mal draussen nach dem Rechten sehen will , wird er ohne viel Federlesens direkt über den Haufen geschossen. Paff! Ein paar der Schüler, zu allem Überfluss noch Mitglieder des Fottballteams, können sich mit einem Pick-Up in die Berge retten. Dort beschließt man die kommunistischen Invasoren mit Partisanenkampf in die Flucht zu schlagen. Doch bis das Ziel erreicht ist, muss der Baum der Freiheit erst mal ordentlich mit Blut gegossen werden.
Entsprechend ist auch der Zuschnitt der Story. Eines Morgens landen in einer durchschnittlichen amerikanischen Kleinstadt sowjetische und kubanische Truppen mit Fallschirmen auf dem Gelände der örtlichen Schule. Besonders schön ist, dass die Schüler gerade von ihrem Lehrer über die "Grausamkeiten der Mongolen" aufgeklärt werden, was mich direkt an Ekel Alfred erinnerte, der ebenfalls immer eindringlich vor dem Ansturm der Mongolen (= Russen) warnte. Als der begnadetet Pädagoge dann mal draussen nach dem Rechten sehen will , wird er ohne viel Federlesens direkt über den Haufen geschossen. Paff! Ein paar der Schüler, zu allem Überfluss noch Mitglieder des Fottballteams, können sich mit einem Pick-Up in die Berge retten. Dort beschließt man die kommunistischen Invasoren mit Partisanenkampf in die Flucht zu schlagen. Doch bis das Ziel erreicht ist, muss der Baum der Freiheit erst mal ordentlich mit Blut gegossen werden.Ironischerweise kommuniziert der Film aber, dass Freiheit und Demokratie nur mit Faschismus erreicht werden können. Das sieht bei Milius so aus: Patrick Swayze schwingt sich zum Gröfaz der Gruppe auf, die nach dem Führerprinzip organisiert, und mit dem markigen Namen "Wolferines" versehen wird. Garniert wird das Ganze dann mit reichlich Esoterik und Blut-Mystik. So zwingen die älteren Gruppenmitglieder bei der Jagt - Scheiße im, Tannenzweige auf dem Kopf - einen Fünfzehnjährigen das Blut eines frisch erlegten Bockes zu trinken. ("Das musst Du tun, dann geht sein Geist in Dich über!") Das dieses Verständnis von Freiheit eine Pervertierung aller Werte für die Amerika steht darstellt, wird John Milius wahrscheinlich nicht in seinen runden Kopf hineinkriegen.
Um diese Exzesse zu rechtfertigen, werden die Sowjets entsprechend sterotypisiert gezeichnet. Martialische Gestalten mit prächtigen Schnurrbärten, die sich gerne mal an den amerikanischen Landpommeranzen vergreifen. In Windeseile hat der Iwan dann auch ein strenges Regime in der Stadt installiert: Überall klebt Lenin an der Wand, im Kino läuft nur Mist und besonders subversive Einwohner kommen in das "Umerziehungslager", welches im ehemaligen Drive-In untergebracht ist. Auch Massenhinrichtungen sind an der Tagesordnung, vor Zivilisten wird kein Halt gemacht. Einmal stimmt eine Gruppe zum Tode Verurteilter mit völlig falscher Tonlage "America the Beautiful" an. Die Sowiets bieten dem Katzenjammer daraufhin mit der geballten Macht der Gewehre Einhalt.
 Da Milius sein Herz aber auf dem rechten Fleck hat, ist auch besinnlichere Momente gesorgt. Als Sheen und Swayze ihren internierten Vater im Lager besuchen, erinnert man sich unter Tränen an die sonnige Kindheit und den ausgelassenen Spass, den man gemeinsam auf der Spielplatzschaukel hatte. Doch plötzlich wird der Herr Papa dienstlich:"Ihr dürft nie wieder weinen! Nie wieder!" und "Rächt uns meine Söhne! Rächt uns alle!" schalmeit er den Früchten seiner Lenden entgegen. Die braven Jungs versprechen es und der alte Arsch kann beruhigt in die kühle Grube sinken. Anscheinend hat Milus als Kind vom Vater ordentlich welche mit dem "Tröster" hinten drauf bekommen, anders ist dieses Delirium beim besten Willen nicht zu erklären.
Da Milius sein Herz aber auf dem rechten Fleck hat, ist auch besinnlichere Momente gesorgt. Als Sheen und Swayze ihren internierten Vater im Lager besuchen, erinnert man sich unter Tränen an die sonnige Kindheit und den ausgelassenen Spass, den man gemeinsam auf der Spielplatzschaukel hatte. Doch plötzlich wird der Herr Papa dienstlich:"Ihr dürft nie wieder weinen! Nie wieder!" und "Rächt uns meine Söhne! Rächt uns alle!" schalmeit er den Früchten seiner Lenden entgegen. Die braven Jungs versprechen es und der alte Arsch kann beruhigt in die kühle Grube sinken. Anscheinend hat Milus als Kind vom Vater ordentlich welche mit dem "Tröster" hinten drauf bekommen, anders ist dieses Delirium beim besten Willen nicht zu erklären.Bemerkenswert ist auch die Brutalität und Kaltschnäutzigkeit, mit der der Film zu Werke geht. Da werden schon mal wehrlose Gegner abgeknallt oder mit Schlägen zum Reden gebracht. Der Hinweis eines russischen Soldaten auf die Genfer Konventionen wird mit einem hämischen "Kenne ich nicht!" abschlägig beschieden. Er und ein Verräter werden wenig später ohne viel Aufhebens erschossen.
Der Wahnsinn auf Stelzen! Wenigsten hat Milius auf die, von Eastwood in Heartbreak Ridge aufgefahrenen, unterschwellig-agressiven Schwulitäten verzichtet, sonst hätte man sich ja gleich den Strick nehmen können...
imdb
° ° °
17. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Ab heute muss auf den Autoren geachtet werden: e.f. ist ein namentlich anonym bleiben wollender Mensch, den ich andernorts im Web kennengelernt habe und dessen Texte zu Filmen ich doch sehr schätze. Auch und gerade, weil er einen nicht ganz alltäglichen Geschmack an den Tag legt, gerne viele Reisen in die weiten Welten des Genrefilms unternimmt und auf eine grundsympathische Art von diesen zu bereichten weiß. Ich freue mich jedenfalls, dass er meine Einladung angenommen hat und seine Beobachtungen und Berichte nun auch hier einstellt und meine, dass seine Texte doch eine echte Bereicherung darstellen. Ich hoffe, alle anderen sehen das genauso.
Willkommen und auf gute Zusammenarbeit!
Willkommen und auf gute Zusammenarbeit!
° ° °
Thema: Filmtagebuch: e.f.
16. Juli 04 | Autor: e.f. | 0 Kommentare | Kommentieren
gesehen auf DVD
Charly Bronson deconstructed...
Wer sich ein bisschen in dem übel beleumundeten Subgenre des Selbstjustizfilms auskennt, weiß, dass viele der dort beheimateten Filme sehr oft nach gewissen, immer gleichen Spielregeln funktionieren: In den meisten Vigilantenreißern der alten Schule, Ein Mann sieht Rot und seine Sequels nehmen hierbei wohl eine paradigmatische Funktion ein, waren die Verhältnisse klar umrissen. Es gibt Täter, es gibt Opfer. Opfer rächt sich an Täter. Punkt. Erleichtert wurde alles noch durch das völlige Fehlen von Backroundinformationen über Herkunft und Motivationen der Täter. Das Böse, oftmals etwas übernatürlich gezeichnet, schlägt aus dem Nichts zu und zieht sich wieder dorthin zurück. Paul Kersey etwa wird die Mörder seiner Frau niemals ausfindig machen. In Sympathy for Mr. Vengeance wird dieses Prinzip vom Kopf auf die Füße gestellt, die quasi-metaphysische Besetztheit der Täter zugunsten einer gnadenlosen, kalten Fixierung der Einzelschicksale aufgelöst.
 Der taubstumme Ryu, ein ehemaliger Student, muss sich nach der Erkrankung seiner ihn finanziell unterstützenden Schwester als Metallarbeiter in einer Fabrik verdingen. Ein Knochenjob. Sein Ziel: Geld für eine kostspielige Nierentransplantation, die die einzige Chance für seine todkranke Schwester darstellt, zusammenzuraffen. Doch Ryu macht sich in seinem Betrieb bei der Akkordarbeit fast kaputt. Er und seine Freundin leben in Armut. Um das Maß voll zu machen, kann das Krankenhaus einfach kein passendes Spenderorgan auftreiben. In seiner Not wendet er sich an dubiose Organhändler, um auf diesem Wege an eine Niere zu gelangen. Doch natürlich geht alles schief. Die Gangster rippen ihn ab, nehmen sein Geld und schneiden ihm eine Niere aus dem Körper. Als dann das Krankenhaus endlich einen Spender gefunden hat, ist das Ersparte weg. Seine linksradikale Freundin schlägt ihm vor die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns zu entführen. Um das Leben seiner Schwester retten zu können, stimmt er der Aktion zu. Unter der Bedingung es dem entführten Kind so angenehm wie möglich zu machen und auf jedwede Gewaltanwendung zu verzichten.
Der taubstumme Ryu, ein ehemaliger Student, muss sich nach der Erkrankung seiner ihn finanziell unterstützenden Schwester als Metallarbeiter in einer Fabrik verdingen. Ein Knochenjob. Sein Ziel: Geld für eine kostspielige Nierentransplantation, die die einzige Chance für seine todkranke Schwester darstellt, zusammenzuraffen. Doch Ryu macht sich in seinem Betrieb bei der Akkordarbeit fast kaputt. Er und seine Freundin leben in Armut. Um das Maß voll zu machen, kann das Krankenhaus einfach kein passendes Spenderorgan auftreiben. In seiner Not wendet er sich an dubiose Organhändler, um auf diesem Wege an eine Niere zu gelangen. Doch natürlich geht alles schief. Die Gangster rippen ihn ab, nehmen sein Geld und schneiden ihm eine Niere aus dem Körper. Als dann das Krankenhaus endlich einen Spender gefunden hat, ist das Ersparte weg. Seine linksradikale Freundin schlägt ihm vor die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns zu entführen. Um das Leben seiner Schwester retten zu können, stimmt er der Aktion zu. Unter der Bedingung es dem entführten Kind so angenehm wie möglich zu machen und auf jedwede Gewaltanwendung zu verzichten.
Schon ganz schön viel Handlung sollte man meinen. Tatsächlich aber erst der Aufhänger für die folgenden, tragischen Ereignisse. Regisseur Park Chan-wook lässt sich für diese ausgedehnte Exposition reichlich Zeit, was dem Film sehr zu gute kommt und den Zuschauer stark an die Wünsche, Träume und Leiden der Protagonisten bindet. Als Ryus kranker Schwester bewusst wird, dass ihr Bruder dabei ist sein eigenes Leben wegzuschmeißen, um das ihre zu retten, bringt sie sich, um nicht länger zur Last zu fallen, um. Ryu realisiert was geschehen ist, erleidet beinahe einen Nervenzusammenbruch und fährt mir dem Mädchen unter Tränen an einen See, um seine Schwester zu begraben. Dort geschieht das Unglück: Aufgrund von Unachtsamkeit und Ryus eingeschränkter Wahrnehmung, fällt das entführte Kind in den See und ertrinkt. Während er und seine Freundin, nun die Taschen voller Geld, von nagenden Schuldgefühlen heimgesucht werden, schwört der Vater Dong-jin blutige Rache an den Entführern seiner Tochter. Mit Hilfe eines Detektivs macht er sich auf die Suche...
 Im Laufe der Handlung stellte sich bei mir sukzessive ein Gefühl großen Unbehagens ein: Wie kann alles nur so entsetzlich in die Binsen gehen? Mit der idealistischen Absicht gestartet ein Menschenleben zu retten, bleiben am Ende einer unglücklichen Kettenreaktion nur gescheiterte Existenzen und Tote zurück. Der unangenehme Trick des Regisseurs besteht darin, für keine der Gruppierungen Partei zu ergreifen. Die wechselnden Erzählperspektiven unterstreichen diesen Ansatz. Der Film selbst nimmt in gewisser Weise die Rolle des Beobachters ein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat das sich ereignende Unglück erbarmungslos zu dokumentieren. Die Verzweiflung der Figuren wird somit auf mir bis dato nicht bekannte Weise nachvollziehbar gemacht. Ständig ist der Zuschauer ideologisch ungefilterten, unangenehm starken Emotionen ausgeliefert, die – jedenfalls mir - gewaltig zu knabbern geben. Was hat es jetzt mit dem titelgebenden Mr. Vengeance auf sich? Nun, die Protagonisten sind in ihren Rollen praktisch doppelt besetzt. Als Täter und Opfer. So ist Dong-jin durch den Tod seiner Tochter Opfer, um dann in seinem rasenden Hass zum Rächer zu werden. Aber auch der Entführer Ryu ist keineswegs nur Täter. Die Organhändler haben ihn betrogen und seine Niere genommen. Auch er wird sich rächen. Der Zuschauer steht nun vor folgendem Dilemma: Alle Motive sind völlig plausibel und jederzeit nachvollziehbar. Eine prekäre Lage angesichts des sich abzeichenden Unheils. Die Gabe verzeihen zu können scheint der einzige Ausweg aus der Spirale der Gewalt zu sein. Doch dazu findet niemand die Kraft.
Im Laufe der Handlung stellte sich bei mir sukzessive ein Gefühl großen Unbehagens ein: Wie kann alles nur so entsetzlich in die Binsen gehen? Mit der idealistischen Absicht gestartet ein Menschenleben zu retten, bleiben am Ende einer unglücklichen Kettenreaktion nur gescheiterte Existenzen und Tote zurück. Der unangenehme Trick des Regisseurs besteht darin, für keine der Gruppierungen Partei zu ergreifen. Die wechselnden Erzählperspektiven unterstreichen diesen Ansatz. Der Film selbst nimmt in gewisser Weise die Rolle des Beobachters ein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat das sich ereignende Unglück erbarmungslos zu dokumentieren. Die Verzweiflung der Figuren wird somit auf mir bis dato nicht bekannte Weise nachvollziehbar gemacht. Ständig ist der Zuschauer ideologisch ungefilterten, unangenehm starken Emotionen ausgeliefert, die – jedenfalls mir - gewaltig zu knabbern geben. Was hat es jetzt mit dem titelgebenden Mr. Vengeance auf sich? Nun, die Protagonisten sind in ihren Rollen praktisch doppelt besetzt. Als Täter und Opfer. So ist Dong-jin durch den Tod seiner Tochter Opfer, um dann in seinem rasenden Hass zum Rächer zu werden. Aber auch der Entführer Ryu ist keineswegs nur Täter. Die Organhändler haben ihn betrogen und seine Niere genommen. Auch er wird sich rächen. Der Zuschauer steht nun vor folgendem Dilemma: Alle Motive sind völlig plausibel und jederzeit nachvollziehbar. Eine prekäre Lage angesichts des sich abzeichenden Unheils. Die Gabe verzeihen zu können scheint der einzige Ausweg aus der Spirale der Gewalt zu sein. Doch dazu findet niemand die Kraft.
Formal hält sich der Film an eine realistische Inszenierung, die aber dann und wann durch mit Understatement eingesetzte, intelligente Einfälle glänzt. Manierierte Coolness sucht man hier zum Glück vergebens. Die Gewalt kommt äußerst explizit – Latex, kein CGI! - daher, spielt sich teilweise aber auch nur im Kopf des Zuschauers ab. Die bedrückende Atmosphäre wird noch durch die weitgehende Abwesenheit von Musik bzw durch den selten eingesetzten dissonant-minimalistischen Score gesteigert. Das Motiv der Taubstummheit bildet ebenfalls eine interessante Kompoente. Oft ist aber auch nur das Wimmern und Schreien der Protagonisten zu hören. Wenn Dong-jin Ryus Freundin mit einer Autobatterie foltert, möchte man sich am liebsten die Ohren zuhalten, um nicht mehr diesem schrecklichen Geschrei ausgesetzt zu sein. Die Bilder sind hingegen meist ruhig, beinahe statisch, können aber jederzeit in Szenen von eruptiver Härte und Grausamkeit umschlagen.
Ein sehr unbequemer Film, der sowohl seinen Protagonisten, als auch dem Zuschauer einiges abverlangt. Dem Genrefreund hingegen bleibt indes die Einsicht, dass es Charles Bronson meist deutlich einfacher hatte.
imdb | mrqe
Charly Bronson deconstructed...
Wer sich ein bisschen in dem übel beleumundeten Subgenre des Selbstjustizfilms auskennt, weiß, dass viele der dort beheimateten Filme sehr oft nach gewissen, immer gleichen Spielregeln funktionieren: In den meisten Vigilantenreißern der alten Schule, Ein Mann sieht Rot und seine Sequels nehmen hierbei wohl eine paradigmatische Funktion ein, waren die Verhältnisse klar umrissen. Es gibt Täter, es gibt Opfer. Opfer rächt sich an Täter. Punkt. Erleichtert wurde alles noch durch das völlige Fehlen von Backroundinformationen über Herkunft und Motivationen der Täter. Das Böse, oftmals etwas übernatürlich gezeichnet, schlägt aus dem Nichts zu und zieht sich wieder dorthin zurück. Paul Kersey etwa wird die Mörder seiner Frau niemals ausfindig machen. In Sympathy for Mr. Vengeance wird dieses Prinzip vom Kopf auf die Füße gestellt, die quasi-metaphysische Besetztheit der Täter zugunsten einer gnadenlosen, kalten Fixierung der Einzelschicksale aufgelöst.
 Der taubstumme Ryu, ein ehemaliger Student, muss sich nach der Erkrankung seiner ihn finanziell unterstützenden Schwester als Metallarbeiter in einer Fabrik verdingen. Ein Knochenjob. Sein Ziel: Geld für eine kostspielige Nierentransplantation, die die einzige Chance für seine todkranke Schwester darstellt, zusammenzuraffen. Doch Ryu macht sich in seinem Betrieb bei der Akkordarbeit fast kaputt. Er und seine Freundin leben in Armut. Um das Maß voll zu machen, kann das Krankenhaus einfach kein passendes Spenderorgan auftreiben. In seiner Not wendet er sich an dubiose Organhändler, um auf diesem Wege an eine Niere zu gelangen. Doch natürlich geht alles schief. Die Gangster rippen ihn ab, nehmen sein Geld und schneiden ihm eine Niere aus dem Körper. Als dann das Krankenhaus endlich einen Spender gefunden hat, ist das Ersparte weg. Seine linksradikale Freundin schlägt ihm vor die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns zu entführen. Um das Leben seiner Schwester retten zu können, stimmt er der Aktion zu. Unter der Bedingung es dem entführten Kind so angenehm wie möglich zu machen und auf jedwede Gewaltanwendung zu verzichten.
Der taubstumme Ryu, ein ehemaliger Student, muss sich nach der Erkrankung seiner ihn finanziell unterstützenden Schwester als Metallarbeiter in einer Fabrik verdingen. Ein Knochenjob. Sein Ziel: Geld für eine kostspielige Nierentransplantation, die die einzige Chance für seine todkranke Schwester darstellt, zusammenzuraffen. Doch Ryu macht sich in seinem Betrieb bei der Akkordarbeit fast kaputt. Er und seine Freundin leben in Armut. Um das Maß voll zu machen, kann das Krankenhaus einfach kein passendes Spenderorgan auftreiben. In seiner Not wendet er sich an dubiose Organhändler, um auf diesem Wege an eine Niere zu gelangen. Doch natürlich geht alles schief. Die Gangster rippen ihn ab, nehmen sein Geld und schneiden ihm eine Niere aus dem Körper. Als dann das Krankenhaus endlich einen Spender gefunden hat, ist das Ersparte weg. Seine linksradikale Freundin schlägt ihm vor die Tochter eines wohlhabenden Geschäftsmanns zu entführen. Um das Leben seiner Schwester retten zu können, stimmt er der Aktion zu. Unter der Bedingung es dem entführten Kind so angenehm wie möglich zu machen und auf jedwede Gewaltanwendung zu verzichten.Schon ganz schön viel Handlung sollte man meinen. Tatsächlich aber erst der Aufhänger für die folgenden, tragischen Ereignisse. Regisseur Park Chan-wook lässt sich für diese ausgedehnte Exposition reichlich Zeit, was dem Film sehr zu gute kommt und den Zuschauer stark an die Wünsche, Träume und Leiden der Protagonisten bindet. Als Ryus kranker Schwester bewusst wird, dass ihr Bruder dabei ist sein eigenes Leben wegzuschmeißen, um das ihre zu retten, bringt sie sich, um nicht länger zur Last zu fallen, um. Ryu realisiert was geschehen ist, erleidet beinahe einen Nervenzusammenbruch und fährt mir dem Mädchen unter Tränen an einen See, um seine Schwester zu begraben. Dort geschieht das Unglück: Aufgrund von Unachtsamkeit und Ryus eingeschränkter Wahrnehmung, fällt das entführte Kind in den See und ertrinkt. Während er und seine Freundin, nun die Taschen voller Geld, von nagenden Schuldgefühlen heimgesucht werden, schwört der Vater Dong-jin blutige Rache an den Entführern seiner Tochter. Mit Hilfe eines Detektivs macht er sich auf die Suche...
 Im Laufe der Handlung stellte sich bei mir sukzessive ein Gefühl großen Unbehagens ein: Wie kann alles nur so entsetzlich in die Binsen gehen? Mit der idealistischen Absicht gestartet ein Menschenleben zu retten, bleiben am Ende einer unglücklichen Kettenreaktion nur gescheiterte Existenzen und Tote zurück. Der unangenehme Trick des Regisseurs besteht darin, für keine der Gruppierungen Partei zu ergreifen. Die wechselnden Erzählperspektiven unterstreichen diesen Ansatz. Der Film selbst nimmt in gewisser Weise die Rolle des Beobachters ein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat das sich ereignende Unglück erbarmungslos zu dokumentieren. Die Verzweiflung der Figuren wird somit auf mir bis dato nicht bekannte Weise nachvollziehbar gemacht. Ständig ist der Zuschauer ideologisch ungefilterten, unangenehm starken Emotionen ausgeliefert, die – jedenfalls mir - gewaltig zu knabbern geben. Was hat es jetzt mit dem titelgebenden Mr. Vengeance auf sich? Nun, die Protagonisten sind in ihren Rollen praktisch doppelt besetzt. Als Täter und Opfer. So ist Dong-jin durch den Tod seiner Tochter Opfer, um dann in seinem rasenden Hass zum Rächer zu werden. Aber auch der Entführer Ryu ist keineswegs nur Täter. Die Organhändler haben ihn betrogen und seine Niere genommen. Auch er wird sich rächen. Der Zuschauer steht nun vor folgendem Dilemma: Alle Motive sind völlig plausibel und jederzeit nachvollziehbar. Eine prekäre Lage angesichts des sich abzeichenden Unheils. Die Gabe verzeihen zu können scheint der einzige Ausweg aus der Spirale der Gewalt zu sein. Doch dazu findet niemand die Kraft.
Im Laufe der Handlung stellte sich bei mir sukzessive ein Gefühl großen Unbehagens ein: Wie kann alles nur so entsetzlich in die Binsen gehen? Mit der idealistischen Absicht gestartet ein Menschenleben zu retten, bleiben am Ende einer unglücklichen Kettenreaktion nur gescheiterte Existenzen und Tote zurück. Der unangenehme Trick des Regisseurs besteht darin, für keine der Gruppierungen Partei zu ergreifen. Die wechselnden Erzählperspektiven unterstreichen diesen Ansatz. Der Film selbst nimmt in gewisser Weise die Rolle des Beobachters ein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat das sich ereignende Unglück erbarmungslos zu dokumentieren. Die Verzweiflung der Figuren wird somit auf mir bis dato nicht bekannte Weise nachvollziehbar gemacht. Ständig ist der Zuschauer ideologisch ungefilterten, unangenehm starken Emotionen ausgeliefert, die – jedenfalls mir - gewaltig zu knabbern geben. Was hat es jetzt mit dem titelgebenden Mr. Vengeance auf sich? Nun, die Protagonisten sind in ihren Rollen praktisch doppelt besetzt. Als Täter und Opfer. So ist Dong-jin durch den Tod seiner Tochter Opfer, um dann in seinem rasenden Hass zum Rächer zu werden. Aber auch der Entführer Ryu ist keineswegs nur Täter. Die Organhändler haben ihn betrogen und seine Niere genommen. Auch er wird sich rächen. Der Zuschauer steht nun vor folgendem Dilemma: Alle Motive sind völlig plausibel und jederzeit nachvollziehbar. Eine prekäre Lage angesichts des sich abzeichenden Unheils. Die Gabe verzeihen zu können scheint der einzige Ausweg aus der Spirale der Gewalt zu sein. Doch dazu findet niemand die Kraft. Formal hält sich der Film an eine realistische Inszenierung, die aber dann und wann durch mit Understatement eingesetzte, intelligente Einfälle glänzt. Manierierte Coolness sucht man hier zum Glück vergebens. Die Gewalt kommt äußerst explizit – Latex, kein CGI! - daher, spielt sich teilweise aber auch nur im Kopf des Zuschauers ab. Die bedrückende Atmosphäre wird noch durch die weitgehende Abwesenheit von Musik bzw durch den selten eingesetzten dissonant-minimalistischen Score gesteigert. Das Motiv der Taubstummheit bildet ebenfalls eine interessante Kompoente. Oft ist aber auch nur das Wimmern und Schreien der Protagonisten zu hören. Wenn Dong-jin Ryus Freundin mit einer Autobatterie foltert, möchte man sich am liebsten die Ohren zuhalten, um nicht mehr diesem schrecklichen Geschrei ausgesetzt zu sein. Die Bilder sind hingegen meist ruhig, beinahe statisch, können aber jederzeit in Szenen von eruptiver Härte und Grausamkeit umschlagen.
Ein sehr unbequemer Film, der sowohl seinen Protagonisten, als auch dem Zuschauer einiges abverlangt. Dem Genrefreund hingegen bleibt indes die Einsicht, dass es Charles Bronson meist deutlich einfacher hatte.
imdb | mrqe
° ° °
Thema: Hoerkino
16. Juli 04 | Autor: thgroh | 0 Kommentare | Kommentieren
Clip zum Opener von Beende Deine Jugend vom neuen Boxhamsters-Album Demut und Elite, das ich nicht für so wahnwitzig großartig halte wie beispielsweise Prinz Albert (aber hey, die ist immerhin eine der großartigsten Platten aller Zeiten!). Den Song selbst finde ich sehr schön. Gut, dass es die Boxies gibt.


° ° °
Thema: DVDs

Ende August erscheint bei Rapid Eye Movies ein DVD-Digipack, das Kenji Fukasakus Meisterwerk des Yakuzathrillers Graveyard of Honor (Japan 1975) mit dem grandiosen Remake von Takashi Miike aus dem Jahr 2002 in sich vereint. Der Stoff handelt von Aufstieg und bitterem Fall eines manischen Yakuzas, beide Filme je für sich Meisterwerke des japanischen Genrekinos. Ganz klare Empfehlung!
Der Untertitel Yakuza Box Vol. 01 lässt auf weitere Titel hoffen. Wäre eine schöne Sache!
° ° °
Thema: Filmtagebuch
11.07.2004, Heimkino
 "Im Jahre 1801 wird der unheimliche Graf Regula zur Sühne am Mord von zwölf Jungfrauen gevierteilt. Jahre später erhält der Advokat Roger und die attraktive Baronesse Lilian eine Einladung in das Sandertal. Zusammen mit einem skurrilen Pater und Lilians Zofe machen sie sich auf den Weg, auf dem sich bereits gespenstische Dinge ereignen. Verfolgt von dem unheimlichen Anatol, landen sie vier in einem düsteren Gewölbe, wo dieser die Wiederbelebung Graf Regulas zelebriert. Für ein Lebenselixier benötigt dieser das Blut einer dreizehnten Jungfrau..." (Jan-Eric Loebe, entnommen von deutscher-tonfilm.de)
"Im Jahre 1801 wird der unheimliche Graf Regula zur Sühne am Mord von zwölf Jungfrauen gevierteilt. Jahre später erhält der Advokat Roger und die attraktive Baronesse Lilian eine Einladung in das Sandertal. Zusammen mit einem skurrilen Pater und Lilians Zofe machen sie sich auf den Weg, auf dem sich bereits gespenstische Dinge ereignen. Verfolgt von dem unheimlichen Anatol, landen sie vier in einem düsteren Gewölbe, wo dieser die Wiederbelebung Graf Regulas zelebriert. Für ein Lebenselixier benötigt dieser das Blut einer dreizehnten Jungfrau..." (Jan-Eric Loebe, entnommen von deutscher-tonfilm.de)
Die Frage zunächst: Kann das alles überhaupt gut gehen? Da inszeniert Harald Reinl, einer der umtriebigsten deutschen Genreregisseure, der auch Schoten wie die Winnetou-Filme, einige der frühen Rialto-Wallace-Schinken (Buchbesprechung: Edgar Wallace Lexikon), ein paar schräge Mabuse-Filme und nicht zu vergessen unzähligen Paukerfilm-Kappes gedreht hat, den überaus seltenen Fall eines deutschen Nachkriegs-Gruselfilms. Das Drehbuch (nach Motiven von Edgar Allan Poe, naja, sagen wir so: geschenkt) stammt dann auch noch von Manfred R. Köhler, der im wesentlichen ähnlichen Blödsinns Grundlage verfasst hat, die fetzige Swingmusik komponierte der dahingehend nicht unbeleckte Peter Thomas (Raumpatrouille!), vor der Kamera dann Lex Barker und Schönheit Karin Dor und für wenige Minuten auch der reichlich untote Christopher Lee, den man als "Graf Regula" (was nur im Englischen blöden Sinn ergibt) verheizt. Kann das also klappen?
 Es klappt. Auf seltsam sämige Art sogar sehr gut, auch wenn der ganze Unfug natürlich weit davon entfernt ist, ein "guter Film" im klassischen Wortsinne zu sein. Zum einen fasziniert natürlich der bloße Look: Schaurige Gemäuer, nebliger Wald, in dem von jedem Baum ein Toter baumelt (was ein Quark, aber wie wundervoll!), rotbemützte Henker, eine wunderschön anzusehende Fahrt vor einen blutorangenfarbenem Himmel - alles im schönsten Technicolor. Bilder zum Verlieben sind das und auf meinem Zweitfernseher im Schlafzimmer - ein Uralt-Gerät, das selbst neue Filme noch aussehen lässt wie aus Technicolor-Blütezeiten - erst recht. Wie wunderbar schon der Beginn, als Christopher Lee mal eben gerichtet wird, mit einer Maske, wie man sie auch schon vom Beginn von Mario Bavas wundervollem Maschera il Demonio (Italien 1960) kennt, wie knalleknallerot da die Maske des Henkers schimmert. Toll.
Es klappt. Auf seltsam sämige Art sogar sehr gut, auch wenn der ganze Unfug natürlich weit davon entfernt ist, ein "guter Film" im klassischen Wortsinne zu sein. Zum einen fasziniert natürlich der bloße Look: Schaurige Gemäuer, nebliger Wald, in dem von jedem Baum ein Toter baumelt (was ein Quark, aber wie wundervoll!), rotbemützte Henker, eine wunderschön anzusehende Fahrt vor einen blutorangenfarbenem Himmel - alles im schönsten Technicolor. Bilder zum Verlieben sind das und auf meinem Zweitfernseher im Schlafzimmer - ein Uralt-Gerät, das selbst neue Filme noch aussehen lässt wie aus Technicolor-Blütezeiten - erst recht. Wie wunderbar schon der Beginn, als Christopher Lee mal eben gerichtet wird, mit einer Maske, wie man sie auch schon vom Beginn von Mario Bavas wundervollem Maschera il Demonio (Italien 1960) kennt, wie knalleknallerot da die Maske des Henkers schimmert. Toll.
Auch der Rest des Films: Ein herrlich abstruser Schmaus für Freunde des Genres, der vor allem auch durch seine zwar nie großartige, geschweige denn ausgeklügelte, aber eben dennoch sehr angenehm elegante, in ihren eigenen Schwung verliebte Kameraarbeit besticht. Wie ein heißes Messer durch warme Butter zieht diese Kamera durch das Gemäuer, blickt mal hier, mal dort hin und ist im wesentlichen immer in Bewegung. Natürlich ist auch die Musik toll, auch wenn Peter Thomas's typischer 60s Swing nun gar nicht zu dem eher Corman-typischen Sets passt. Egal, denn auch der Rest, eine mit reichlich heißen Nadeln gestrickte Story um Blut von Jungfrauen, mit selbigem durchgeführte Wiederbelebungen, Charakter-Veränder-Tränken und Priestern, die eigentlich Ganoven sind, passt nicht wirklich (wobei die Szene, in der Dor und Barker die Wiederbelebung des Grafen nicht schauen dürfen und sich umdrehen müssen, um so nurmehr der Schatten des Spektakels gewahr zu werden, schon wieder ganz, ganz großartig ist!). Vollkommen untergeordnet alles dem Ganzen, Pulp für den Cinephilen - nicht weniger!
imdb
"Was geschieht hier?"
- Lex Barker
- Lex Barker
 "Im Jahre 1801 wird der unheimliche Graf Regula zur Sühne am Mord von zwölf Jungfrauen gevierteilt. Jahre später erhält der Advokat Roger und die attraktive Baronesse Lilian eine Einladung in das Sandertal. Zusammen mit einem skurrilen Pater und Lilians Zofe machen sie sich auf den Weg, auf dem sich bereits gespenstische Dinge ereignen. Verfolgt von dem unheimlichen Anatol, landen sie vier in einem düsteren Gewölbe, wo dieser die Wiederbelebung Graf Regulas zelebriert. Für ein Lebenselixier benötigt dieser das Blut einer dreizehnten Jungfrau..." (Jan-Eric Loebe, entnommen von deutscher-tonfilm.de)
"Im Jahre 1801 wird der unheimliche Graf Regula zur Sühne am Mord von zwölf Jungfrauen gevierteilt. Jahre später erhält der Advokat Roger und die attraktive Baronesse Lilian eine Einladung in das Sandertal. Zusammen mit einem skurrilen Pater und Lilians Zofe machen sie sich auf den Weg, auf dem sich bereits gespenstische Dinge ereignen. Verfolgt von dem unheimlichen Anatol, landen sie vier in einem düsteren Gewölbe, wo dieser die Wiederbelebung Graf Regulas zelebriert. Für ein Lebenselixier benötigt dieser das Blut einer dreizehnten Jungfrau..." (Jan-Eric Loebe, entnommen von deutscher-tonfilm.de)Die Frage zunächst: Kann das alles überhaupt gut gehen? Da inszeniert Harald Reinl, einer der umtriebigsten deutschen Genreregisseure, der auch Schoten wie die Winnetou-Filme, einige der frühen Rialto-Wallace-Schinken (Buchbesprechung: Edgar Wallace Lexikon), ein paar schräge Mabuse-Filme und nicht zu vergessen unzähligen Paukerfilm-Kappes gedreht hat, den überaus seltenen Fall eines deutschen Nachkriegs-Gruselfilms. Das Drehbuch (nach Motiven von Edgar Allan Poe, naja, sagen wir so: geschenkt) stammt dann auch noch von Manfred R. Köhler, der im wesentlichen ähnlichen Blödsinns Grundlage verfasst hat, die fetzige Swingmusik komponierte der dahingehend nicht unbeleckte Peter Thomas (Raumpatrouille!), vor der Kamera dann Lex Barker und Schönheit Karin Dor und für wenige Minuten auch der reichlich untote Christopher Lee, den man als "Graf Regula" (was nur im Englischen blöden Sinn ergibt) verheizt. Kann das also klappen?
 Es klappt. Auf seltsam sämige Art sogar sehr gut, auch wenn der ganze Unfug natürlich weit davon entfernt ist, ein "guter Film" im klassischen Wortsinne zu sein. Zum einen fasziniert natürlich der bloße Look: Schaurige Gemäuer, nebliger Wald, in dem von jedem Baum ein Toter baumelt (was ein Quark, aber wie wundervoll!), rotbemützte Henker, eine wunderschön anzusehende Fahrt vor einen blutorangenfarbenem Himmel - alles im schönsten Technicolor. Bilder zum Verlieben sind das und auf meinem Zweitfernseher im Schlafzimmer - ein Uralt-Gerät, das selbst neue Filme noch aussehen lässt wie aus Technicolor-Blütezeiten - erst recht. Wie wunderbar schon der Beginn, als Christopher Lee mal eben gerichtet wird, mit einer Maske, wie man sie auch schon vom Beginn von Mario Bavas wundervollem Maschera il Demonio (Italien 1960) kennt, wie knalleknallerot da die Maske des Henkers schimmert. Toll.
Es klappt. Auf seltsam sämige Art sogar sehr gut, auch wenn der ganze Unfug natürlich weit davon entfernt ist, ein "guter Film" im klassischen Wortsinne zu sein. Zum einen fasziniert natürlich der bloße Look: Schaurige Gemäuer, nebliger Wald, in dem von jedem Baum ein Toter baumelt (was ein Quark, aber wie wundervoll!), rotbemützte Henker, eine wunderschön anzusehende Fahrt vor einen blutorangenfarbenem Himmel - alles im schönsten Technicolor. Bilder zum Verlieben sind das und auf meinem Zweitfernseher im Schlafzimmer - ein Uralt-Gerät, das selbst neue Filme noch aussehen lässt wie aus Technicolor-Blütezeiten - erst recht. Wie wunderbar schon der Beginn, als Christopher Lee mal eben gerichtet wird, mit einer Maske, wie man sie auch schon vom Beginn von Mario Bavas wundervollem Maschera il Demonio (Italien 1960) kennt, wie knalleknallerot da die Maske des Henkers schimmert. Toll.Auch der Rest des Films: Ein herrlich abstruser Schmaus für Freunde des Genres, der vor allem auch durch seine zwar nie großartige, geschweige denn ausgeklügelte, aber eben dennoch sehr angenehm elegante, in ihren eigenen Schwung verliebte Kameraarbeit besticht. Wie ein heißes Messer durch warme Butter zieht diese Kamera durch das Gemäuer, blickt mal hier, mal dort hin und ist im wesentlichen immer in Bewegung. Natürlich ist auch die Musik toll, auch wenn Peter Thomas's typischer 60s Swing nun gar nicht zu dem eher Corman-typischen Sets passt. Egal, denn auch der Rest, eine mit reichlich heißen Nadeln gestrickte Story um Blut von Jungfrauen, mit selbigem durchgeführte Wiederbelebungen, Charakter-Veränder-Tränken und Priestern, die eigentlich Ganoven sind, passt nicht wirklich (wobei die Szene, in der Dor und Barker die Wiederbelebung des Grafen nicht schauen dürfen und sich umdrehen müssen, um so nurmehr der Schatten des Spektakels gewahr zu werden, schon wieder ganz, ganz großartig ist!). Vollkommen untergeordnet alles dem Ganzen, Pulp für den Cinephilen - nicht weniger!
imdb
° ° °