Gestern Nachmittag von Schanelec hatte mich enttäuscht. Liegt vielleicht auch an mir. Im Endeffekt war das für mich so, dass der Berlin-Teil aus Marseille, der mir da schon nicht gefallen hat, nun auf einmal Spielfilmlänge hatte. Klar, da ist viel cineastisch wertvolles zu finden, in dem Film. Die Schwenks auf einmal bei Schanelec, die Räume, die nie Räume sind, das Off, aus dem die meisten sprechen. Aber dann, nach etwa der Hälfte der Spielzeit, in der ich wirklich um einen Zugang bemüht war, kam mir irgendwann einfach nur noch die Erkenntnis, dass es nicht viel helfen würde, mich da weiter zum Gut-Finden zu zwingen. Das Problem ist nämlich einfach: Das hat mit mir nicht das Geringste zu tun. Ich interessiere mich für solche Leute nicht. Mir sind Theatermenschen aus der Wohlstandsgegend West-Berlins einfach sehr egal. Und vor allem, wenn sie sinnversonnenes lakonisch aufsagen. Irgendwann einfach nur noch der Gedanke, dass das alles Deppen jenes Kultur-Gossenschlags sind, die menschlich einfach mal so was von am Ende sind, bei denen ich im echten Leben ja schon froh bin, wenn ich sie nicht sehen muss. Aber okay, vielleicht ist das böse und ungerechtfertigt. Deswegen schreibe ich auch keine Kritik. Die erste Einstellung aber, da muss ich Ekkehard vollkommen recht geben, ist wirklich großartig - ein seltenes Stück Kinomagie - ganz am Ende des Abspanns steht in der Dankesliste dann ein New Filmkritiker.
Ganz anders hingegen Woman on the Beach von Hong Sang-Soo, zu sehen im Panorama. Gesehen habe ich ihn im Cubix, einem der unerfreulichsten Kinos der Stadt, weit droben über derselben. Wenn man aus dem Saal geht, hat man einen unvergleichlichen Blick über die nähere Umgebung. Woman on the Beach hat mich als Film sehr gefreut, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich darüber schreiben sollte. Vielleicht sollte ich darauf hinweisen, dass die Zoombewegungen in diesem Film auf eine glücklich machende Weise wundervoll sind. Überhaupt ein Formmittel, das sehr zu Unrecht in Verruf geraten ist. Auch die Schwenks sind toll, vor allem, wenn in ihnen noch gezoomt wird: Kontinuität des Raumes. Überhaupt alles toll an dem Film.
Für den Naruse-Film morgen in der Retro habe ich keine Pressekarte gekriegt, was ich sehr schade finde. Ich werde mein Glück einfach so versuchen und hoffen, in den ersten Reihen noch einen Platz zu finden. Wenn jemand eine Karte hat und also vor mir drin ist, im Saal, dann kann er mir ja - oder auch sie, natürlich - einen Platz freihalten. Danke!

 Ab 1986 wurden in Mauretanien schwarze Intellektuelle, die für Gleichberechtigung kämpften, vom herrschenden Regime systematisch Repressalien ausgesetzt. Dazu gehörte unter anderem die 'Verwahrung' der Gesellschaftskritiker in einem weit in der Wüste gelegenen Sicherheitsgefängnis unter haarsträubenden Bedingungen - angeblich nur "bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung". Die Realität aber sprach ein Wärter aus: "Hier kommt ihr her, um zu sterben." - Der Bau ist Teil einer systematischen Aushungerungs- und Verelendungsstrategie. Erst als zwei der auf diese Weise Inhaftierten unter den Bedingungen zusammenbrechen und sterben, richtet sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den "Kreis der Ertrunkenen" (so der Titel in deutscher Übersetzung): 'Glücklicherweise' starben zwei prominente Figuren - ein Literat und ein Minister - und 'retteten' so das Leben der Anderen, kommentiert einer von diesen lakonisch das Ende seiner Haftzeit in den frühen 90er Jahren.
Ab 1986 wurden in Mauretanien schwarze Intellektuelle, die für Gleichberechtigung kämpften, vom herrschenden Regime systematisch Repressalien ausgesetzt. Dazu gehörte unter anderem die 'Verwahrung' der Gesellschaftskritiker in einem weit in der Wüste gelegenen Sicherheitsgefängnis unter haarsträubenden Bedingungen - angeblich nur "bis zum Beginn der Gerichtsverhandlung". Die Realität aber sprach ein Wärter aus: "Hier kommt ihr her, um zu sterben." - Der Bau ist Teil einer systematischen Aushungerungs- und Verelendungsstrategie. Erst als zwei der auf diese Weise Inhaftierten unter den Bedingungen zusammenbrechen und sterben, richtet sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den "Kreis der Ertrunkenen" (so der Titel in deutscher Übersetzung): 'Glücklicherweise' starben zwei prominente Figuren - ein Literat und ein Minister - und 'retteten' so das Leben der Anderen, kommentiert einer von diesen lakonisch das Ende seiner Haftzeit in den frühen 90er Jahren.
Le Cercle des Noyés lässt einen der Überlebenden zu Wort kommen, buchstäblich: Er ist nur auf der Tonspur präsent, erzählt - oft literarisiert-lakonisch, dann wieder voller Details - von den Umständen der Haft. Die Worte sind langsam gesprochen, quellen eher über Lippen, als dass sie rakontieren.
Auf der Bildebene hingegen ist Le Cercle des Noyés in vollendeter Konsequenz als Geste der Verweigerung des horriblen Bildes zu verstehen: Zwar war der Regisseur nach Mauretanien gereist, doch bleiben seine Bilder, als Erzählendes, stumm: Eine lange Einstellung zeigt eine Asphaltstraße durch die Wüste, Autos, die vorbeifahren. Windgeräusche. Dazu der stete voiceover, dann wieder ein Wüstenpanorama, in der Mitte des Bildes, weit entfernt, ein Hügel, darauf das Gefängnis als tiefschwarzer Fremdkörper inmitten der Landschaft. Der gesamte Film ist fast schon chromatisch grau, schwarzweiß ist das nicht mehr zu nennen.
Bild und Ton ergeben selten auf eine Anhieb eine Einheit. Der minutenlange Blick ins 'Nichts' entwickelt durée, Monotonie. Die Aufmerksamkeit versinkt ganz in die Stimme. Ein Verweilen im Schrecken, der durch keine Bilder mehr darzustellen ist. Oft werden Träume des Inhaftierten illustriert, der Traum von einem Schlachthof etwa: Dokumentarisch, nicht 'traumhaft'.
Der Riss im Leben, das Trauma des Folterschreckens - beides ergibt hier keine Überwältigungsstrategie - weder ästhetisch, noch motivisch. Man hört zu, diesem einen Menschen, dem unmenschliches widerfahren ist.
Fast schockartig ist ein Moment gegen Ende: Erstmals sieht man vor sich einen Menschen, der spricht: Er entpuppt sich als einer der Wärter. Er spricht davon, Mitleid gehabt zu haben. Dass nicht er schuld gehabt habe, dass nicht er verantwortlich gewesen sei.
Der Reichtum des Filmes ist seine Armut an Gesten des Sentiments.
info-site (forum)

 Manchmal spielt einem der Zufall kleine Filmwunder in die Hände, so in diesem Falle. Ich komme etwa zehn Minuten zu spät am Potsdamer Platz an, um die eigentlich geplante Filmvorführung noch besuchen zu können. Ein schneller Blick in die diversen Zettel der einzelnen Sektionen mit den Presseterminen weist Lady Chatterley als mögliche Alternative auf; dunkel habe ich vom schnellen Überfliegen der Berichterstattung im Kopf, dass Ekkehard den imnerhin fast dreistündigen Film sehr lobte - also gebe ich ihm eine (zunächst auf eine erste halbe Teststunde begrenzte) Chance, auch wenn ich Adaptionen von klassischer Weltliteratur meist schon alleine deshalb skeptisch gegenüber stehe, weil ich die betreffenden Bücher nicht gelesen habe. Doch der Test gelingt, wird als solcher fast vergessen und fast drei Stunden lang sitze ich, mir der Dauer des Filmes nicht eine Sekunde land bewusst, in der zahlenmäßig sträflich gering besuchten Pressevorfühung und sehe voller Entzücken den wahrscheinlich besten Film des Festivals.
Manchmal spielt einem der Zufall kleine Filmwunder in die Hände, so in diesem Falle. Ich komme etwa zehn Minuten zu spät am Potsdamer Platz an, um die eigentlich geplante Filmvorführung noch besuchen zu können. Ein schneller Blick in die diversen Zettel der einzelnen Sektionen mit den Presseterminen weist Lady Chatterley als mögliche Alternative auf; dunkel habe ich vom schnellen Überfliegen der Berichterstattung im Kopf, dass Ekkehard den imnerhin fast dreistündigen Film sehr lobte - also gebe ich ihm eine (zunächst auf eine erste halbe Teststunde begrenzte) Chance, auch wenn ich Adaptionen von klassischer Weltliteratur meist schon alleine deshalb skeptisch gegenüber stehe, weil ich die betreffenden Bücher nicht gelesen habe. Doch der Test gelingt, wird als solcher fast vergessen und fast drei Stunden lang sitze ich, mir der Dauer des Filmes nicht eine Sekunde land bewusst, in der zahlenmäßig sträflich gering besuchten Pressevorfühung und sehe voller Entzücken den wahrscheinlich besten Film des Festivals.
Lady Chatterley erzählt, in Anlehnung an einen Roman von D.H. Lawrence, die Annäherung einer großbürgerlichen jungen Ehefrau in England an die Erotik. Die historische Kulisse stellt als Latenz der soeben beendete 1. Weltkrieg dar: Lady Chatterleys Gatte kehrt querschnittsgelähmt aus ihm ins weit umfassende Anwesen zurück. In einer kleinen Hütte draußen im Wald lebt Parkin, ein vergleichsweise grobschlächtiger Handwerker.
Lady Chatterleys Welt ist ein ummantelnder Kokon, der jede Körperlichkeit verbannt hat, selbst da noch, wo Menschen einander berühren. Die Körperpflege des gelähmten Patriarchen könnte kaum distanzierter ausfallen, ebenso seine Rasur. Chatterley leidet an allgemeiner Schwäche: Diagnostisch klopft der Hausarzt ihren Körper ab. Frühzeitig zeigt der Film sie nackt: Beim Entkleiden vor dem Gang ins Bett betrachtet sie sich im Spiegel - ein Verhältnis zu sich hat sie nicht. Doch liegt in ihrem fragenden Blick ein Tasten. Zuvor war die junge Dame unter Schichten von Textil verwahrt und gleichsam aus der Welt gesperrt.
Regelmäßig fragmentiert die Kamera ihren Körper: Hände werden gefilmt, wenn Chatterley sich streckt, um durch ein Fenster blicken zu können, sehen wir ihre auf Zehenspitze gestellten Füße - eingekleidet im Leder der feinen Schuhe. Ein Körper, so scheint es, der zu sich selbst kein Verhältnis findet, in der kulturellen Semantik nur als Bedecktes, Verborgenes denkbar bleibt.
Parkin tritt erstmals in grober Unbekleidetheit auf: Beim Gang um ein im Wald gelegenes Haus, stößt Chatterley auf ihn bei der Morgenwäsche. Der nackte Rücken löst sichtlich einen Schock aus, sie flieht zurück zu den Bäumen, wartet.
Wenn die Welt des Bürgertums, die Lady Chatterley als Film zeigt, eine ist, die jegliche Taktilität zur materiellen Welt verloren hat, so ist diejenige Parkins eine, die aus nichts anderem zu bestehen scheint. Er hämmert versiert Nägel in Hühnerkäfige, wäscht sich im Freien, verarbeitet das Holz, trägt Handschuhe aus gröbstem Leder, welche die Lady, die langsam die Welt des Handwerkers auch haptisch erkundet, in einer der schönsten Szenen des Films genüsslich überstreift.
Die Annäherung der beiden, die aus Tasten Erotik entwickelt, folgt einer schrittweisen Entblätterung; das Entkleiden, das Tasten, das Fühlen wird Teil des erotischen Zeremoniells der beiden. Keine Stelle an Lady Chatterleys ist erotisch aufgeladener als jenes Stück freie Haut, das sich unter ihrem Rock zwischen dickem Strumpf und Unterrück befindet. Der erste Sex zwischen den beiden mag grob vonstatten gehen (die Geste des Films ist im übrigen einmalig: wir haben die Lady zuvor schon nackt gesehen, hier nun sehen wir sie als Nackte nicht), doch etabliert er eine ganz eigene sinnliche Körperlichkeit, die schließlich, im Laufe des Films, zu einer spielerischen Zärtlichkeit weiterausformuliert wird, deren sensible filmische Umsetzung gänzlich unvergleichlich ist: Die sukzessive körperliche Erfahrung des anderen, die Bewunderung für das einfache /Dasein/ der Merkmale des anderen - ein halb-erigierter Penis, ein Leberfleck auf einer Brust, Schamhaare - entwickelt sich aus einem streng filmisch gedachten Inszenierungskonzept.
Dies sieht vor, dass man nicht erschlagen wird, sondern nachspürt: Über weite Strecken ist Lady Chatterley dialogfrei. Mise en scène und Montage, vor allem aber die sicher geführten Gesten und Blicke, Erzählung und Erzählhaltung des Filmes (gerade letztere immer wieder: eindrucksvoll überraschend!) - all dies schwingt sich zur Eleganz auf, die nicht kulturbeflissenes Virtuosentum, sondern den kommunikativen Akt mit dem Zuschauer zum Ziel hat.
Wenn Erotik denn eine Geistestätigkeit ist, die der rein körperlichen Triebabfuhr des Sexes eine imaginativ-phantasmatische Qualität ermöglicht, die gerade Erfahrung und Inszenierung von Körperlichkeit zusammenbringt, dann ist Lady Chatterley nicht nur einer der erotischsten Filme der letzten Jahre - weit abseits im übrigen jeder Schlüpfrigkeit und Gelecktheit, die diese Bezeichnung oft mitschwingen lässt - , sondern auch einer der besten über Erotik selbst. Warum ein solcher - sowohl inhaltlich, als auch ästhetisch - herausragender Film dazu verdammt ist, weit abseits des Wettbewerbs unter "ferner liefen" wahrgenommen zu werden, bleibt im größten Maße fraglich und dürfte wohl eine der bezeichnendsten Fehlleistungen der Wettbewerbskommission darstellen.
imdb
 Vorausschicken muss ich, dass ich Eastwoods Flags of our Fathers, der vor wenigen Monaten als erster dieses zusammengehörigen Filmdoppels ins Kinorennen geschickt wurde, leider nicht gesehen habe. Wenn man den Kritikern glauben darf - auch den japanischen -, dann ist der erste der beiden Filme auch der bessere, wenngleich auch Letters viel Jubel ausgelöst hat; der Academy war er bei den Nominierungen denn auch der liebere. Es mag deshalb sein, dass sich der Blick auf Letters nach Sichtung von Flags verschieben mag; dennoch scheint mir, dass Eastwood, der letzte große Humanist und der letzte alte Mann des klassischen Kinos, hier seinen schwächsten Film seit Jahren vorgelegt hat.
Vorausschicken muss ich, dass ich Eastwoods Flags of our Fathers, der vor wenigen Monaten als erster dieses zusammengehörigen Filmdoppels ins Kinorennen geschickt wurde, leider nicht gesehen habe. Wenn man den Kritikern glauben darf - auch den japanischen -, dann ist der erste der beiden Filme auch der bessere, wenngleich auch Letters viel Jubel ausgelöst hat; der Academy war er bei den Nominierungen denn auch der liebere. Es mag deshalb sein, dass sich der Blick auf Letters nach Sichtung von Flags verschieben mag; dennoch scheint mir, dass Eastwood, der letzte große Humanist und der letzte alte Mann des klassischen Kinos, hier seinen schwächsten Film seit Jahren vorgelegt hat. Flags of our Fathers spürt in verschachtelter Erzählweise einem ins Gedächtnis der USA gemeiselten Ikon und den daran beteiligten Person nach: Joe Rosenthals Fotografie der us-amerikanischen Flagge auf dem Berg Suribachi auf der Vulkaninsel Iwo Jima, dem ersten Flecken japanischen Landes, der im Zuge der Japan-Offensive besetzt werden konnte. Das Foto zählt zu den am meisten reproduzierten der Geschichte, ihm vorausgegangen war eine blutige Schlacht um das Stückchen Erde, in der eine zahlenmäßig hoffnungslos unterlegene und am eigenen, kulturell bedingten Ethos krankende Einheit der japanischen Armee sich bis zum letzten Atemzug der hochgerüsteten Flotte entgegen stellte. Letters from Iwo Jima erzählt von derselben Schlacht - allerdings strikt aus japanischer Perspektive und dies in respektabler Konsequenz.
Ein Foto hier, Briefe dort: Jeweils sind es mediale Artefakte, die für Eastwood den (Erzähl-)Zugriff auf Geschichte nicht nur ermöglichen, sondern überhaupt erst initiieren. Iwo Jima, 2005: Bei einer Ausgrabung stoßen Archäologen auf einen im Tunnelsystem des Berges Suribachi verscharrten Postsack, in dem sich die niemals zugestellten Briefe der hier im technologisch hochgerüsteten Fegefeuer brutal zerschlissenen Soldaten finden. Voller alltäglicher Banalitäten, Gesten des Zweifels und Liebesbekundungen erzählen sie die Geschichte derjenigen, die für einen vor allem auch von japanischer Seite aus fast schon lächerlich unsinnigen und suizidalen Krieg sterben mussten (als unterfütternde Lektüre sei Keji Nagazawas mehrbändige Manga-Autobiografie Barfuss in Hiroshima empfohlen). Letters from Iwo Jima - und damit Eastwood als humanistischer auteur - bemüht sich nun im folgenden, die Soldaten als höchst heterogene Ansammlung von Menschen mit sehr unterschiedlichen Begriffen von Lebensführung und soldatischer Ehre, mit Ängsten und Bedürnissen zu zeigen. Das bedrohliche Bild vom gleichgeschalteten, bedrohlichen Kamikaze-Soldat, der mit unbewegter Miene in den Tod zieht, solange es dem Vaterland dient, wird hier entschieden aufgebrochen.
Die Geste stimmt, allein die Umsetzung macht zu schaffen. Letters from Iwo Jima changiert zwischen Melodram und Kriegsfilm, die Fallen, die beide Genres in sich bergen, werden dabei nicht immer souverän umschifft. Es mag ein ganz grundsäötzliches Problem mit Eastwoods Humanismus sein: Dieser mag für die "aus dem Leben gegriffenen" Dramen, die er in den letzten Jahren ins Kino brachte - Mystic River und Million Dollar Baby, beide verdientermaßen instant classics -, höchst funktional sein; im pompösen Schlachtengemälde in Feldherrenästhetik, das Letters über weite Strecken ist, gerinnen die bewegenden menschlichen Momente indes zu Kolorit. Zwar steigt auch hier wieder die in den letzten Jahren als markantes Stilmittel etablierte Eastwood'sche Schwärze aus der Kulisse den Figuren ins Gesicht; doch folgt dies nicht mehr jener Logik des präzisen Aufbaus, der die vorangegangenen Filme noch auszeichnete: Das zwingende Element geht, zwischen Bolidentrommel und Momenten des Mensch-Seins, verloren. Bleibt vielleicht die Feststellung, dass auch Japaner im Krieg nur (zerfaserbare) Menschen sind.
Ob es für diese Einsicht bald zweieinhalb Stunden Filmlänge und massiven Technikeinsatz benötigt hat, bleibt fraglich. Zumal Eastwood auch den Einsatz der Mittel kaum reflektiert zu haben scheint: Der alten Problemstellung des Anti-Kriegfilms - wie den Krieg darstellen ohne ihn als technologisches Spektakel zu bebildern - scheint Eastwood von vorneherein aus dem Weg gegangen zu sein; es mag auch an Co-Produzent Spielberg gelegen haben, dass Letters from Iwo Jima immer dann, wenn vom beengten Tunnel zum Feldherrenhügel gewechselt wird, eine (unfreiwillige) ästhetische Herrlichkeit entwickelt, die sich aus dem berühmten opening von Saving Private Ryan zwar speist, aber deren Klaustrophobie und Ebene einer ganz physischen Bedrohung nicht adaptiert. Beeindruckend ist es, wenn Berg Suribachi erstmals aus der Luft mit Bomben eingedeckt wird, wenn die us-amerikanische Flotte über's Meer kommt, macht der Rechner Überstunden und des Publikumsstaunens im größen Cinemaxx-Saal darf man sich gewiss sein. Wenn Körper unter Granateneinsatz zerrissen werden, darf der naturalistische MakeUp-Splatter bewundert werden. In all dieser Herrlichkeit verliert Letters jeden existenziellen Ton und produziert am laufenden Meter "Bilder für die Wand".
Letters from Iwo Jima ist im Ganzen betrachtet sicher kein "schlechter Film". Man hätte sich nur gewünscht, dass Eastwoods, grundsätzlich zwar nobler, Humanismus, der immer strikt am Einzelnen und dessen Lebenssphäre orientiert ist, in diesem Falle mehr Raum gegriffen hätte. Sei es, dass er den Einzelnen konsequent ernst genommen oder übergeordnete Strukturen aufgedeckt hätte. So aber bleibt Unwohlsein beim Verlassen des Saals - und die Hoffnung auf Flags of our Fathers als Korrektiv.
imdb
Ein paar schöne, eigenartig entrückte Bilder hat der Film zu bieten, und viele skurrile Einfälle. Ganz wunderbar gelungen ist die musikalische Untermalung, soviel habe ich noch mitbekommen. Für einen konkreten Nachvollzug der sehr sprunghaften und offenbar ohnehin episodisch angelegten Handlung war ich dann aber doch zu matt. Plötzlich war der Vater tot - und ein anderer da? Hä?
Eines der Bilder, die mir die letzten Tage nicht aus dem Kopf gehen:Nach dem Fotoshooting vor der Pressekonferenz der Jury schlägt sich Mario Adorf an der offenen Türe das Gesicht an.
Im Kino läuft Willem Dafoe an mir vorbei und flachst mit Paul Schrader, der deshalb anscheinend wohl auch an mir vorbeigelaufen ist (wäre ja sonst komisch).
Der Skandal der Berlinale ist, dass es kein Wasser vom (offenbar abgesprungenen) Sponsor mehr für die Journalisten gibt. Das Thema - das Wasser ja leider nicht - ist in aller (Akkreditierten) Munde. Wer mit trocken' Maul in trocken' Forums-Filmkunst sitzt, wünscht sich glatt Birne-Maracuja und Ananas-Papaya (oder wie die ganzen - und dann auch noch angesüßten - Pastiche-Mixe der letzten Jahre genannt wurden) zurück.
Die Internet-Ticket-Schlangen werden immer länger. Ich erinnere mich dunkel an Zeiten, da holte ich mir die Tickets via Kreditkarte und Internet und holte das dann zügig bei unverschämt unterbeschäftigten Counter-Angstellten ab. Heute holt man sich den Kram im Internet - und wartet dann in den Arkaden nochmal zwei Stunden beim Abholen.
Stefan und Ekkehard laufen im CineMaxx aneinander dicht an dicht vorbei und es hätte ja doch keinen Zweck, beide davon verbal zu unterrichten. Zu weit weg.
Am Potsdamer Platz ist es abends nun arschkalt. Also doch noch Winter.
Thomas Vorberg von satt.org drückt mir endlich das Belegexemplar seines Fanzines in die Hand. Vor einem Jahr hatte ich zum Kritikerspiegel beigesteuert, das Heft ist denn auch kurz nach dem Festival erschienen. Er hätte ja gewusst, dass er mich irgendwann mal sieht, sagt er, als wir einander begegnen, und zieht es aus der Umhängetasche. Vielleicht sollte ich doch mal wieder auf eine Pressevorführung jenseits der Berlinale gehen.
Was ich auch nicht verstehe: Dass sich die Leute die Hacken blöde stehen - um sich eine Karte für einen Film von Robert De Niro zu ziehen, der ohnehin während des Festivalbetriebs regulär anläuft. Dafür lohnt sich das!
Die Leute vom ZDF wohnen in so seltsamen Wohnwägen unweit des Marlene-Dietrich-Platzes, die aussehen wie Alu-Dosen aus den 50er Jahren. Oder so. Hallo, Konservenfernsehen!
Die Gesänge der Zikaden, die mir letztes Jahr erstmals in Nobuo Nakagawas einem (Name vergessen) Samuraifilm als Hintergrund-Sound so wirklich aufgefallen sind, tauchen auch weiterhin in asiatischen, und vor allem japanischen Filmen auf. Wäk-Wäk-Wäk-Wääääk schnattern die Viecher. Eine seltsame Klang-Kartografie, hallo Weltkino.
Ansonsten ist das Festival von einer seltsamen Lässigkeit gezeichnet. Meine Filme widersprechen einander nicht im Zeitplan. Ich habe jeden Tag mindestens zwei zumindest vielversprechende und empfohlene Filme auf dem Schedule. Der Wettbewerb ist so schnurz, dass es mich nicht wundern täte, würde die Jury am letzten Tag klammheimlich abreisen, um der Schmach, öffentlich einzuräumen, dass sie die Bären lieber selbst behalten als solchen Filmen zu geben, zu entgehen. Das Gewese um den Wettbewerb ist so unglaublich weit weg, wenn man sich vor allem im Saal 5 des Cinemaxx tummelt.

 Mit dem herrlich skurillen The Saddest Music in the World gelang dem kanadischen Einsiedel-Independent-Regisseur Guy Maddin vergangenen Dezember auch endlich in Deutschland der Einstand in den Kinobetrieb. Dem war eine (meines Wissens komplette) Retrospektive im Kino Arsenal vorangegangen, nun läuft sein neuestes Werk unter dem Rubrum "Forum Special Screening". Es bleibt zu hoffen, dass solche Manöver den eigenwilligen Regisseur in der deutschen Filmlandschaft auch für die Zukunft verankern.
Mit dem herrlich skurillen The Saddest Music in the World gelang dem kanadischen Einsiedel-Independent-Regisseur Guy Maddin vergangenen Dezember auch endlich in Deutschland der Einstand in den Kinobetrieb. Dem war eine (meines Wissens komplette) Retrospektive im Kino Arsenal vorangegangen, nun läuft sein neuestes Werk unter dem Rubrum "Forum Special Screening". Es bleibt zu hoffen, dass solche Manöver den eigenwilligen Regisseur in der deutschen Filmlandschaft auch für die Zukunft verankern.
Brand Upon the Brain ist eine "Remembrance in 12 Chapters", wie das Insert zu Beginn verrät. Das "by Guy Maddin" ist in diesem Falle wörtlich zu verstehen: Maddin selbst reist zu Beginn auf eine entlegene, kleine Insel, auf der er seine Kindheit in einem dem starken Regiment seiner Mutter unterstehenden Waisenhaus verbracht haben will. Hier steckt alles voller Erinnerungen, voller Past-ness. Natürlich greift er zum Pinsel, um dem in einem Leuchttum gelegenen Waisenhaus einen neuen Anstrich zu verpassen - und um also alte Erinnerungen zu übertünchen.
Natürlich geht das Vorhaben schief: Munter übersprudeln sich die Ereignisse, kommen bizarre Bilder wieder, die sich aus dem Stummfilm, der Mythologie der Phantastik und der Schundliteratur des späten 19. Jahrhunderts speisen. In einem aberwitzigen Bilderreigen geht es um Mütter, die wie Vampire "Nektarit" aus den Kindern saugen, um emsig in Kellern arbeitende Väter, die den Jungbrunnen erfinden, um Filmstars, die zu Detektiven aus Jugend-Kriminalromanen werden, und Jugendlieben, die Gender-Grenzen überwinden. Das Bizarre und Skurille, das Witzige und Erschreckende liegen bei Maddin nahe zusammen: Wenn Film, wie allerfrüheste Filmtheorie gerne behauptet hat, den Modus von Erinnerung und Träumen wiedergibt, dann liefert Guy Maddin einen verführerischen Beweis dafür, dass dies gelten mag, solange denn der richtige an den Apparaturen sitzt.
Denn Brand upon the Brain ist ungemein rasant und höchst assoziativ gestaffelt, filmischer stream of consciousness. Dies ist vor allem Maddins künstlerischem Projekt zu verdanken: Seit Jahren arbeitet sich Maddin an der spezifischen (Material-)Äthetik der Stummfilmzeit ab, ohne dabei bloß Pastiche-Gesten für versonnene Nostalgiker abzuliefern. Im Gegenteil, Guy Maddin nimmt den Stummfilm in einer Weise ernst, die Schwindeln macht: Maddin dreht keine bloße Reprise, sondern denkt Stummfilm in einer Weise weiter, als hätte die Film-Genealogie in den späten 20er Jahren an einer anderen Stelle abgebogen.
Gerade das Stumme und materialästhetisch Verfremdete bietet sich als Medium für einen stream of consciousness an; in Brand upon the Brain hat Maddien, der die Techniken für eine solche Filmkonzeption im jahrelangen Privatstudium weit abseits des Filmbetriebs erlernt hat, seine Methode zu einer Perfektion heranreifen lassen, die, allerdings, gerade so noch auf der Kippe zum "Maddin-Manierismus" steht.
Zwar mag Brand... an seinen Vorgänger nicht ganz heranreichen; dennoch stecken in ihm noch immer soviele Ideen, die sich in rasantester Flüchtigkeit vor einem abspielen, wie sie manch anderer Filmemacher zahlenmäßig in seiner ganzen Schaffenszeit nicht anhäufen kann. Alleine die Vision schon, die Maddin antreibt, seine Liebe für's - motivische wie rein physische - Material und nicht zuletzt die sture Eigenwilligkeit, mit der Maddin sich voran durch's Werk bewegt, lassen auch in Brand Upon the Brain nichts anderes zu als freudiges Staunen, zumal wohl in der Deutschen Oper, wo der Film am 15.02. in einer (schon ausverkauften) Sondervorführung mit Geräusch- und Musikorchester und Isabelle Rosselini als Filmerzählerin (im normalen Kino ist ihr Kommentar Teil der Tonspur) aufgeführt werden wird.
imdb ~ info-seite (forum) (das dort verlinkte pdf bringt ein ausführliches interview mit maddin)

 Killer of Sheep entstand in den frühen 70er Jahren, als New Hollywood bereits munter dabei war, der New Mainstream zu werden, und Afro-Amerikaner auf der Leinwand vor allem im Rahmen von Blaxploitation-Filmen zu sehen waren, einem sehr ambivalenten Zusammenhang von Filmen, der einerseits zwar überhaupt erst einmal von Afro-Amerikanern handeln, andererseits aber vor allem auf Klischees zurückgreifen oder aber solche zum Ausgangspunkt nehmen und sie somit auch häufig wieder zementieren. Dass Klischees dabei auch gebrochen wurden, steht außer Frage - auf der anderen Seite aber stellen diese in dieser Umgebung dennoch einen primären Bezugspunkt dar.
Killer of Sheep entstand in den frühen 70er Jahren, als New Hollywood bereits munter dabei war, der New Mainstream zu werden, und Afro-Amerikaner auf der Leinwand vor allem im Rahmen von Blaxploitation-Filmen zu sehen waren, einem sehr ambivalenten Zusammenhang von Filmen, der einerseits zwar überhaupt erst einmal von Afro-Amerikanern handeln, andererseits aber vor allem auf Klischees zurückgreifen oder aber solche zum Ausgangspunkt nehmen und sie somit auch häufig wieder zementieren. Dass Klischees dabei auch gebrochen wurden, steht außer Frage - auf der anderen Seite aber stellen diese in dieser Umgebung dennoch einen primären Bezugspunkt dar.
Dieser Hintergrund ist wichtig, wenn man Killer of Sheep sieht. Gedreht hat ihn Charles Burnett als Abschluss seiner Ausbildung auf der UCLA, 1981 hat ihn das Forum erstmals gezeigt, nun ist er in restaurierter (und auf 35mm hochgezogener) Kopie zu sehen. Der Verleih wurde bislang auf Grund ungeklärter Musiktitelrechte stark erschwert.
Jedenfalls, Killer of Sheep ist in einer überschaubaren neighborhood in South Central/Los Angeles angesiedelt, eine bereits in den 70ern vor allem von Afro-Amerikanern bewohnte Gegend. Im Mittelpunkt steht Stan, Familienvater und eine Spur zu verträumter Idealist. Er arbeitet im Schlachthof, daher der Titel des Films. Die Kinder spielen ringsum nahe den Gleisen, die Tochter wagt ihre ersten Schritte in den Garten und auf den Gehweg. In der Ehe klappt es nicht mehr ganz so gut. Ein paar Gangster sprechen Stan an, ob sie bei ihm ihre Waffen lagern könnten, natürlich bleibt er standhaft. Das Leben fließt, die Kamera ist dabei.
Mit dem heutigen South Central, betont Charles Burnett im anschließenden Q&A, hat die im Film gezeigte community nichts mehr zu tun. Dennoch ist auch das heutige Bild von South Central durch die Nachrichten verzerrt, führt er fort. Natürlich gibt es Gangs, Gewalt und Armut, natürlich hat das Viertel in den letzten 30 Jahren einen starken Niedergang erlebt, doch auch dort gibt es noch immer Menschen, die ihrem Broterwerb nachgehen und mit Gewalt nichts am Hut haben. Es gibt einen Alltag dort, unterstreicht er, und er findet jenseits von Gewalt und Drogen statt.
Killer of Sheep ist nicht nur auf Grund seiner nahezu mangelnden Dramaturgie - auch der, sagt Burnett, hat kein richtiges Ende, alles ergibt zusammen das nächste und so geht es immer weiter - als Angriff auf Hollywood zu verstehen; seine Bilder sind deutlich als Gegenbilder zu erkennen. Zu sehen ist im wesentlichen: Alltag. In einer Gegend, die nicht die Beste ist. Die Kinder beim Spielen, am Abend die Küche. Arbeitsleben. Der Versuch, ehelicher Romantik am Abend. Ein Motor wird erworben. Einige Gangster lungern auf der Straße herum.
Aber Killer of Sheep ist weder Dokumentation, noch Pendant zum shomingeki, dem japanischen, oft beschaulichen Alltagsfilm. Burnetts Bilder zeichnen sich durch einen sanften Hang zur Stilisierung aus. Auch wenn man das über weite Strecken kaum glauben mag: "The movie was storyboarded" sagt er nach der Vorführung. Doch vielen anderen Bildern nimmt man das ab: Gesichter, die sich im close-up vor der Kamera drehen, Perspektiven, die konzentriert /dieses/ Geschehen einfangen und kein anderes. Dass der Film komplett gescriptet gewesen sein soll, fällt zu glauben hingegen schwerer aus: Die Dialoge und Darsteller - viele davon Laien - sind in einer Weise naturalistisch, dass man eher an Improvisationskino denkt.
Deutlich zu spüren ist eine Latenz der Gefahr, gerade so, als deute sich das spätere South Central und die Gang-Gewalt der 80er Jahre bereits an. Wenn die Jungen bei den Gleisen spielen, beschmeißen sie einander mit nicht eben kleinen Steinen; zum haarsträubenden Drahtseilakt gerät der Transport eines offenkundig schwergewichtigen Motorblocks, der rückwärts über Treppen - Stans Schuhe sind nicht gut geschnürt, sehen wir - erfolgt. Der Motor wird auf einen Pick-Up gewuchtet, der rückwärts am Hügelhang steht. Der Wagen setzt sich in Bewegung, die Kamera liegt dazu frontal am Boden, einige Meter vom Wagen entfernt - hügelabwärts. Da geschieht es und der Motorblock kippt nach hinten weg, geradewegs auf die Kamera zu und nur um Haaresbreite an ihr vorbei. Irgendetwas muss er aber getroffen haben, das Bild wird ordentlich durchgerüttelt. Eines der ersten Bilder aber ist auch eines der eindrücklichsten (motivisch wird es gelegentlich wiederholt): Im close-up-Anschnitt sieht man ein Brett, hinter dem sich jemand verbirgt. Hektisch lugt er immer wieder an der Seite hervor und wird offenbar beworfen. Die Einstellung dauert lange - sie soll sich offensichtlich einbrennen - und etabliert eine latente Bedrohung; erst der Umschnitt zeigt, dass es sich um ein Spiel handelt (bei dem einer verletzt zu Boden geht). An einer anderen Stellen fahren die Kinder mit Skateboards und Fahrrädern auf die Straße, und nur knapp am Auto vorbei (man wartet aber, dass in letzter Sekunde noch ein Kind hervorprescht). Zum Ende fallen ein paar Kids beim Fahrradfahren um - doch der entgegenkommende Wagen kann noch abbremsen. Die Welt von Killer of Sheep steckt voller Gefahren - an einer Stelle heißt es, Tiere haben Zähne und der Mensch eben Fäuste. Inmitten tummeln sich die Kinder - um die es auffallend häufig geht - als Erben dieser Welt. Eine Schwangerschaft wird im Laufe des Films ebenfalls verkündet.
In der (dieses Jahr sehr persönlich abgefassten) Broschüre des Forums wird Killer of Sheep als "ungesehenes Meisterwerk der amerikanischen Filmgeschichte" bezeichnet - und dies völlig zu Recht. Weit abseits von New Hollywood ist Killer of Sheep ein Autorenfilm par excellence und auf eine Weise (bild-)politisch, die über inhaltistisches Sloganeering weit hinaus geht. Einer jener Filme, in denen fast jeder Moment ein kleines Glück birgt, schon alleine weil hier - weit abseits von ausstellender Geste - etwas zu sehen ist, was ansonsten nicht zu sehen wäre.
Das schönste Bild in ihm: Ein beengter Blick in ein Zimmer, links und rechts stark beschnitten. Am Boden sitzt die kleine Tochter vor einem Plattenspieler. Eine LP spielt Soul der 70er Jahre. Das Mädchen spielt mit einer Puppe.
» imdb ~ info-seite (forum)
» movie magazine search engine ~ movie blog search engine
 Was ist das, "Armenien"? Was ist das, ein Land, seine Kultur, seine Geschichte? Was sind die Bedingungen seiner Vermitteltheit - durch Gebräuche, Erzählungen, mithin Schriften und also Medien? Wie verhält sich das innere Bild "Armenien", zumal wenn es in der 'Diaspora' gebildet wurde, zur blanken Faktizität einer realen Begegnung?
Was ist das, "Armenien"? Was ist das, ein Land, seine Kultur, seine Geschichte? Was sind die Bedingungen seiner Vermitteltheit - durch Gebräuche, Erzählungen, mithin Schriften und also Medien? Wie verhält sich das innere Bild "Armenien", zumal wenn es in der 'Diaspora' gebildet wurde, zur blanken Faktizität einer realen Begegnung? Gariné Torossians Film verdichtet mehrere Reisen nach Armen in einen Film. Genauer: Verdichtet werden mediale Artefakte von den Reisen. Die Reisen selbst, als eine faktische Abfolge von Bewegungen und Begegnungen, bleiben im Unklaren. Stone Time Touch handelt von der Unberührbarkeit dessen, was außerhalb seiner kulturellen und damit medialen Einbettung - als Bild im Kopf, als Praxis im Alltag - nur als stumme Materialität zu greifen wäre.
Ein Stein etwa in einer Kirche. Er ist Zeuge der Zeit, seine im Laufe von Jahrzehnten gebildete Textur kündet davon. Er lässt sich berühren. Stein, Zeit, Berührung. Er ist das Bindeglied zur Geschichte. Er ruft Bilder hervor. Und bleibt dennoch nur ganz er selbst.
Gariné Torossians Film situiert sich zwischen Essay-, Dokumentar- und Experimentalfilm. Das gesammelte Material - Fotos, Videoaufnahmen, Tonband - wurde jahrelang gesammelt und gebündelt. Verfremdet und erneut abgefilmt. Digitalisiert, bis das digitale Rauschen in einer Weise hervortritt, die so zuvor nicht zu sehen war. Die Filmemacherin arbeitet mit vielschichtigen Bildern, Ausblendungen, digitalen Übermalungen. Nichts, wirklich rein gar nichts erinnert an irgendetwas, was man ansonsten gemeinhin mit "Armenien" in Verbindung bringen könnte. Jedes Ikon wird umgangen und für ungültig erklärt; statt dessen neue Bilder, die ikonenhaften Anspruch für sich schon deshalb nicht behaupten können, weil sie im digitalen Rauschen in die Flüchtigkeit versiegen. Dazwischen: Begegnungen und Details, die faktisch bleiben. Hier, in dieser Umgebungen, können sie aufatmen. Errettungen im Strom des Ephemeren.
Die Tonspur ist suggestiv, zuweilen ambient, dann Soundkollagen. Der Voiceover der Filmemacherin bleibt oft nur Flüstern. Zwischen all dem auch akustischen Rauschen geht ein Satz wie "I travelled to Armenia to experience this country's essence" fast unter. Über allem liegt jedoch eine Frauenstimme, traditioneller Gesang. Ihre Tonqualität scheint naturalistisch. Ein mythischer Background, der dem in den Trümmern seiner eigenen Geschichte liegenden Land ("I have seen the worst days on Earth" sagt eine Alte, mit Händen, die man so noch nie gesehen hat) eine Grundierung, einen Rest Nationalgefühl gibt? Das letzte Bild zeigt die Sängerin: Vor einer weißen Wand, um die richtigen Töne bemüht. Die Insinuierung des Mythos Armeniens findet nicht statt.
Von wo wird gefilmt? Auch dieser Punkt bleibt oft unklar. Einige Sequenzen unterstreichen deutlich: Die Kamera steht nicht an jener Stelle, die das Bild nahelegt. Ein Foto ist das, auf einem Monitor. Vor diesem steht die Kamera. Die differente Frequenz irritiert die Bildstabilität. Es flimmert, flickert. Das Medium schiebt sich dazwischen. Wie steht es dann mit statischen Bildern?
Stone Time Touch irritiert, desorientiert. Das Bild "Armenien" ist hier nicht zu finden, es existiert nur in der Vorstellung; das vorgefunden Faktische ist mit dem Bild nicht in Einklang zu bringen; indem es seine eigene Visualität beständig untergräbt, deren Medialität unentwegt in den Vordergrund der Bildebene hebt, handelt Stone Time Touch mit Präzision von diesem Widerstreit. Was ist das, Geschichte? Zunächst einmal: Tinte auf Papier. Eine Textur auf dem Stein. Sie liegt zum Greifen nahe. Und Armenien? Ein Trümmerfeld der Geschichte.
Stone Time Touch ist der Film, mit dem mein Festival begann. Es hätte danach enden können, ich hätte mich um nichts betrogen gefühlt.

 Erneut erweist sich das Forum erfreulicherweise um Kontinuität bemüht: Bereits vor zwei Jahren war Lee Yoon-ki mit seinem hübschen This Charming Girl in der Sektion vertreten. Dieser Film handelte von einer jungen Frau und ihren alltäglichen Bewegungen - erst am Ende, wenn sich eine Traumatisierung aufgetan hat, ließ sich erkennen, dass wir sie auch in dieser Anschauung zuvor nicht erkannt haben.
Erneut erweist sich das Forum erfreulicherweise um Kontinuität bemüht: Bereits vor zwei Jahren war Lee Yoon-ki mit seinem hübschen This Charming Girl in der Sektion vertreten. Dieser Film handelte von einer jungen Frau und ihren alltäglichen Bewegungen - erst am Ende, wenn sich eine Traumatisierung aufgetan hat, ließ sich erkennen, dass wir sie auch in dieser Anschauung zuvor nicht erkannt haben. Ad Lib Night schließt hieran an: Im Mittelpunkt steht erneut eine junge, im urbanen Korea lebende Frau, die gleich zu Beginn von zwei Männern auf offener Straße angesprochen wird. Beide sind sich einig, in ihr ihre junge Schwester wiedererkannt zu haben, die vor rund 10 Jahren die auf dem Land lebende Familie fluchtartig verlassen hat. Der Vater liegt im Sterben, sagen sie. Die Frau reagiert spärlich, verneint jedoch schließlich: Sie sei nicht die Schwester der beiden, wiederholt sie bestehend.
Eine Abwägung folgt. Ob man dem ohnehin komatösen Vater denn nicht dieses Mädchen vorsetzen könne, damit der Frieden geschlossen werde. Man diskutiert. Harter Schnitt. Sie fährt mit den beiden Männern im Wagen. Sie flieht, das kann man der SMS ablesen, die sie gerade noch erhalten hat. Sind die beiden Männer ihr gegenüber aufrichtig? Sie versteinert spürbar innerlich, als sie eine Schaufel im Wagen entdeckt. Nein, ihr drohe keine Gefahr, wiederholen die beiden Männer.
Bei der Familie angekommen ergibt sich ein trauriges Bild: Die Familie ist menschlich mehr oder weniger bankrott. Die Trauer, scheint es, ist ritualhaft. Gehässigkeiten untereinander, Intrigen. Der Vater siecht am Boden. Gespräche entfalten sich, die Nacht wird lang ...
Wie This Charming Girl sucht Ad Lib Night die Langsamkeit und das flüchtige Detail. Bewegungen werden registriert, und Wohnungsinneneinrichtungen. Der quasi-naturalistische Ansatz von Lee Yoon-ki ermöglicht Ansichten eines koreanischen Alltagslebens, die ansonsten kaum möglich scheinen. An der weißen Wand neben der Couch: Ein schwarzer Fleck, das vom Möbel herrührt. Ein kleines Punktum.
Seinen Reiz bezieht Ad Lib Night aus der Frage nach der Geschichte, bzw. Identität der jungen Frau. Eine ganze Weile lang bleibt ungewiss, ob sie nicht vielleicht /doch/ das gesuchte Mädchen ist, das sich hier, quasi-inkognito, für einen Moment in ihr altes Leben zurückwagt. Szenen in ihrem Jugendzimmer, das spielhafte Anziehen alter Socken legen eine solche Lesart nahe.
Man merkt, dass auch diese Frau eine Krypta in sich trägt, derjenigen aus This Charming Girl nicht unähnlich. Falls sie die Gesuchte sein sollte, liegt dieses Geheimnis in dieser Familie, die wir sehen und teils nicht erträglich finden, begründet; falls nicht, ergeben sich weitere Fragen. Ad Lib Night beantwortet sie, bleibt darin aber unaufdringlich.
Zuweilen aber fließt der Film in erster Linie. Menschen werden kennengelernt und erlebt. Langsam wird das Gefüge der Beziehungen abgetastet. Man spürt dem nach und lässt die Einblicke atmen.

 Regisseur Yau Nai Hoi legt hier seinen Debütfilm vor, doch ist er dem erfahrenen Besucher des Internationalen Forums, bzw. dem Freund des Hongkong-Kinos kein Unbekannter: Als Drehbuchautor zeichnete er für die beiden Johnnie-To-Filme PTU und Running On Karma verantworlich, die ebenfalls beide in früheren Jahrgängen des Forums zu sehen waren. Beide gehören zu den besten Filmen, die Johnnie To - ohnedies einer der interessantesten Filmemacher Hongkongs - vorzuweisen hat. Dass Yau Nai Hoi dann auch mit Tony Leung Ka Fai (nicht zu verwechseln mit dem im auf Grund seiner Zusammenarbeiten mit Wong Kar Wei im Ausland weit bekannteren Tony Leung), Lam Suet und Simon Yam (der sich hier unrasiert und mit dickem Schmerbauch durch Hongkongs Straßen tümmeln darf) die (zumindest einstmals) erste Garde der aufs Genrekino abonnierten Darsteller Hongkongs versammelt, lässt die Erwartungen an diesen Beitrag zusätzlich steigen. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass aus Hongkong zuletzt kaum mehr Signale zu vernehmen waren: Milkyway Productions, Johnnie Tos Filmschmiede, scheint der letzte übrig gebliebene Qualitätsgarant der mehr oder weniger vor den eigenen Trümmern stehenden Hongkonger Filmindustrie. Dies lässt sich auch an der Programmierung des Forums ablesen, wo traditionell immer wenigstens ein Genrefilm aus Hongkong untergebracht war: Vor zwei Jahren war dies der wenig inspirierte, ermüdende Jiang Hu, im letzten Jahr hatte man gar still und schweigend auf einen Beitrag aus Hongkong verzichtet.
Regisseur Yau Nai Hoi legt hier seinen Debütfilm vor, doch ist er dem erfahrenen Besucher des Internationalen Forums, bzw. dem Freund des Hongkong-Kinos kein Unbekannter: Als Drehbuchautor zeichnete er für die beiden Johnnie-To-Filme PTU und Running On Karma verantworlich, die ebenfalls beide in früheren Jahrgängen des Forums zu sehen waren. Beide gehören zu den besten Filmen, die Johnnie To - ohnedies einer der interessantesten Filmemacher Hongkongs - vorzuweisen hat. Dass Yau Nai Hoi dann auch mit Tony Leung Ka Fai (nicht zu verwechseln mit dem im auf Grund seiner Zusammenarbeiten mit Wong Kar Wei im Ausland weit bekannteren Tony Leung), Lam Suet und Simon Yam (der sich hier unrasiert und mit dickem Schmerbauch durch Hongkongs Straßen tümmeln darf) die (zumindest einstmals) erste Garde der aufs Genrekino abonnierten Darsteller Hongkongs versammelt, lässt die Erwartungen an diesen Beitrag zusätzlich steigen. Dies vor allem auch vor dem Hintergrund, dass aus Hongkong zuletzt kaum mehr Signale zu vernehmen waren: Milkyway Productions, Johnnie Tos Filmschmiede, scheint der letzte übrig gebliebene Qualitätsgarant der mehr oder weniger vor den eigenen Trümmern stehenden Hongkonger Filmindustrie. Dies lässt sich auch an der Programmierung des Forums ablesen, wo traditionell immer wenigstens ein Genrefilm aus Hongkong untergebracht war: Vor zwei Jahren war dies der wenig inspirierte, ermüdende Jiang Hu, im letzten Jahr hatte man gar still und schweigend auf einen Beitrag aus Hongkong verzichtet.Um es vorweg zu nehmen: Eye in the Sky lässt aufatmen und dürfte dem Connaisseur des guten Großstadtthrillers aus Hongkong einigen Seelenbalsam anbieten. Eye in the Sky erzählt seine Story so präzise und effektiv, wie man das vom guten Hongkong-Film seit je her gewohnt war und wie es dem zuweilen zur psychologischen Schwerfälligkeit neigenden US-Kino – prominentestes Beispiel wohl Scorseses Departed, bezeichnenderweise ein Remake eines Hongkong-Films – nur selten gelingt. Überdies verzichtet Eye in the Sky wohltuend auf stylishe Fingerübungen, übermäßigen Farbfiltereinsatz oder ähnliche, entweder dem Festival- oder Direct-to-DVD-Markt verbundenen, Mätzchen. Die Tugenden des ambitionierten Genrefilms, für die Johnnie To steht, werden von Yau Nai Hoi gelungen aktualisiert.
Eye in the Sky schmeißt einen zunächst orientierungslos ins Straßengewirr Hongkongs. Schnell akzentuiert die Kamera die tragenden Figuren des Films auf engstem Raume, doch die Fäden müssen wir selber engführen: Da steht einer an der Ecke – fett, frisst - , drei fahren in derselben Straßenbahn, eine davon beobachtet den anderen, der dritte ist unbeteiligt, scheint es. Die Wege trennen sich, doch ergeben sich Beziehungen. Die eine folgt dem etwas dicklichen, der sich bald als ihr zukünftiger Vorgesetzter, Codename „Dog Head“, zu erkennen gibt und ihr für fortan den Codenamen „Piggy“ gibt; der andere besteigt ein Dach und übt sich seinerseits in Observation, wie auch der dritte, der Dicke, der immer noch unentwegt an der Straßenecke steht und frisst. Ein Überfall auf einen Juwelier findet statt, die Aktion ist vom Wachposten über der Stadt präzise konzertiert. Allein der Fette, eine Reserve an der Ecke für den Fall, dass ein Polizist das Feld betritt, fällt auf späteren Videoaufnahmen auf – eine erste Spur für Piggys erste Mitarbeit in der Einsatzgruppe.
Ein "Auge im Himmel" zu sein, darauf käme es bei der Beschattung an, mahnt Dog Head Piggy bei der Einweisung an; ein Prinzip, das den Film trägt und wechselseitig Anwendung findet. Minutiös beschattet eine ganze Spezialeinheit den ominösen „Fatman“. Von hier führt eine Spur zur nächsten, ein Link zum nächsten, dies immer unter den Bedingungen der Hongkonger Straßensituation. Zugleich basiert die Arbeit des Strippenziehers, der zu Beginn über den Dächern Posten bezogen hat, auf nichts anderem als lückenloser Datenakquise. Aus dieser Spannung – überwachen, verfolgen, dabei unerkannt bleiben – bezieht der Film seinen Reiz: Die Arbeit der Beschatter ist mit einer bislang nicht gekannten Detailfreude ausgeschmückt – jede Bewegung, jedes Manöver steht im Dienst der Spannungseffizienz.
Ganz natürgemäß ist Eye in the Sky deshalb auch „Stadtfilm“. Nur die moderne Großstadt, diese Abfolge fragmentierter Sinneseindrücke und ephemerer Begegnungen, bietet den kulturellen Rahmen der lückenlosen Beschattung. Die Frage ist, wie hier aus dem „Teig der Stadt“ und den Bewegungen der unüberschaubaren Bewohner Sinn entnommen wird: Welche Bewegung entspringt dem städtischen Alltag, welche ist Überwachung, welche kriminelles Manöver? Erst die Erfassung des urbanen Raumes durch Medien und Technik vernäht das von Flüchtigkeit und steter Bewegung geprägte Straßenbild zur Information mit gesteigertem Wert. Eye in the Sky rückt deshalb die Methoden der Ermittler – aber auch der mafiösen Gegenseite – regelmäßig ins Bild und spielt häufig genug in der „Schaltzentrale“. Der Zuschauer ist dabei seinerseits aufgefordert, sich mit dem Treiben auseinander zu setzen, Spuren zu lesen. Wie von selbst gleitet denn auch Paranoia ins Feld.
Deutlich anzumerken ist Yau Hai Nois Herkunft vom Drehbuchschreiben: Das Konstruierte, das die besten To-Filme auszeichnet, tritt deutlich und nicht zum Nachteil zutage. Eye in the Sky ist sorgfältig und mit Bedacht geschrieben worden; lediglich zum Ende hin finden sich zwei kleinere flaws, die den Genuss im Großen und Ganzen aber nicht stören. Es tut gut, das alte Hongkong-Kino wieder einmal in straighter Form zu erleben: Albernheiten, Mätzchen, nobilitierender Pomp finden sich an keiner Stelle. Yau Nai Hois Debüt mag den Filmen des Lehrmeisters To das Wasser noch nicht reichen, aber auf seine weiteren Arbeiten darf man jetzt schon gespannt sein. Potenzial ist im hinreichenden Maße vorhanden.

 Rund um die Pressevorführungen herrscht ja bekanntlich immer viel Geschäftigkeit. Wenn es schon nicht Regisseure oder Produzenten sind, die nach den Filmen den Kontakt zu den Journalisten suchen, sind es doch oft - zumindest wenn asiatische Filme gezeigt wurden - TV-Teams.
Rund um die Pressevorführungen herrscht ja bekanntlich immer viel Geschäftigkeit. Wenn es schon nicht Regisseure oder Produzenten sind, die nach den Filmen den Kontakt zu den Journalisten suchen, sind es doch oft - zumindest wenn asiatische Filme gezeigt wurden - TV-Teams. Zum Beispiel heute, nach der Vorführung des (im übrigen guten, aber dazu später mehr) Hongkong-Thrillers Eye in the Sky: Keck kam da ein kleines TV-Team aus Hongkong an mich herangesprungen, mit der Frage, ob ich den Film denn gesehen hätte. Klar, meinte ich. Und ob ich denn auch ein Interview "for Hongkong television" geben möchte? Äääh, okay.
So stand ich denn also, schwerbeladen, in voller Montur, tendenziell unrasiert - und sprach mit Eric, wie er sich vorstellte, über Eye in the Sky ("I really liked it!"), über Johnnie To ("I love his movies. I've seen PTU some years ago here in Berlin and there are some similarities to this movie, I think"), ob es so etwas wie eine "Johnnie To Schule" gebe ("I think there are definitely some influences") und was mir an dem Film denn so richtig gut gefallen habe ("It's very straight, very precise and overall quite thrilling.").
Ich glaube, ich habe mich manchmal schon auch stark versprochen und englischen Quatsch gesagt. Aber: Am anderen Welt kucken mir jetzt irgendwelche Menschen zu, wie ich über ihre Filme rede. Nein, diese deutschen Hünen, werden sie wohl denken, big in Hongkong.
 Uckermark, kurz vor Weihnachten: Der junge, aus Berlin stammende Lars verlebt die Tage vor dem Fest mit seinem Vater in dessen neuer Behausung, einer mehr oder weniger darnieder liegenden Scheune nahe eines ost-deutschen Kaffs. Dem war offenbar kürzlich eine Trennung der beiden Eltern vorangegangen, wir erfahren das erst nach und nach, wie sich hier überhaupt alles immer erst mit Verspätung ergibt.
Uckermark, kurz vor Weihnachten: Der junge, aus Berlin stammende Lars verlebt die Tage vor dem Fest mit seinem Vater in dessen neuer Behausung, einer mehr oder weniger darnieder liegenden Scheune nahe eines ost-deutschen Kaffs. Dem war offenbar kürzlich eine Trennung der beiden Eltern vorangegangen, wir erfahren das erst nach und nach, wie sich hier überhaupt alles immer erst mit Verspätung ergibt. Von den Dorfbewohnern werden sie konsequent gemieden - kein Wort, keine Geste in ihre Richtung -, auch die Ankündigung einer Feier im Hof der Scheune ergibt keinen Kontakt. Am Tag seiner Abreise trifft Lars auf die taubstumme Marie, die von Dorfjugendlichen blöde angemault wird; Lars geht dazwischen, kriegt aufs Maul, Nasebluten und Zug verpasst. Marie und Lars befreunden sich und Lars bleibt zunächst einmal und zur Überraschung des Vaters hier: Als er vom Bahnsteig wieder nach Hause kommt, trifft er dort seine halbnackte Tante.
Die Probleme, die die Bekanntschaft zwischen Lars und Marie mit sich bringt, sind dörflicher Natur. Maries Vater ist der Geschäftsführer der lokalen Kneipe und Jäger im nahen Wildschweinrevier. Entsprechend roh sein Auftreten und Umgang. Bald kommt es zum Streit zwischen den Vätern, unterdessen Lars' Mutter, eine offenkundig schwere Neurotikerin, bei der Scheune an die Türe klopft ...
Mit Jagdhunde legt Ann-Kristin Reyels, Absolventin der Filmhochschule Konrad Wolff in Potsdam, ihren Debüt- und Abschlussfilm vor. Man könnte seine zuweilen mit dem Kargen liebäugelnde Gestaltung, seinen oft eher weglassenden, denn zeigenden Gestus grob der so genannten "Berliner Schule" zuschieben (Constantin von Jascheroff, der den Lars spielt, spielte denn auch die Hauptrolle in Hochhäuslers großartigem Falscher Bekenner), doch ginge das bei genauerer Betrachtung kaum auf. Seine Strategie ist nicht so sehr die gezielte, quasi-syntaktische Weglassung, als vielmehr die eines konsequent lakonischen Tonfalls, der gleichermaßen das Komische und Tragische sucht. Das Abendessen an Heiligabend etwa, in dem sich alle wesentlich beteiligten Parteien am gemeinsamen Tisch zusammenfinden, wäre bei anderen Regisseuren des genannten Zusammenhangs sicher in eine schmerzhafte Bilanz bürgerlicher Befindlichkeiten gemündet; hier ist die Unerträglichkeit dieser Anordnung in äußerer Perspektive beobachtet und gestattet mitunter das Auflachen.
Jagdhunde tut also nicht weh, er strengt auch nicht unbedingt zur Reflexion an; im wesentlichen ist er eine Art unschuldiger Liebesfilm, dem zuweilen vor allem auch dank der hervorragenden Darsteller einige hinreißende Momente gelingen. Dass sich der Tonfall weder zum Schnulz, noch zur Theoretisierung neigt, ist dabei ein vielleicht nicht immens wichtiges, aber doch schon bemerkenswertes Detail.
Auch der Hang zur (sachten) Ästhetisierung seiner Bilder macht ihn der "Berliner Schule" fremd: Zahlreiche Einstellungen wirken ephemer und doch komponiert, zuweilen wie Stillleben und schließlich wie melancholische Nachtansichten. Zu diesem gesetzten Bildmodus, der das Statische betont, steht ein anderer im Widerstreit: Der einer Art spielerischen Intimität zwischen Marie und Lars. Immer wenn die beiden ganz bei und für sich sind, fragmentiert die plötzlich beweglich gewordene Kamera das Geschehen zu einer Abfolge räumlich nicht mehr nachvollziehbarer "Bits und Bytes": Im Taumel löst sich das Bild auf, geradewegs als würde Konfetti durch graue Straßen rieseln.
Auch die anderen Darsteller bereichern diesen kleinen Film, selbst noch in den Nebenrollen. Erwähnt werden muss natürlich Josef Hader als Lars' Vater, der mit seiner unvergleichlichen Lakonie den Film erdet ohne sich in den Vordergrund zu spielen. Eine wahre Entdeckung aber ist Luise Berndt, die mit Gestik und Mimik viel ehrliche Wärme in den Film trägt.
Jagdhunde ist sicher kein großer Wurf der Filmkunst, aber allemal ein vielversprechendes Debüt einer jungen Regisseurin, die hoffentlich auch weiterhin in der Lage sein wird, zwischen den Polen einer theoriegestärkten Filmkunst und den Untiefen der schmockigen Filmförderkultur so unaufgeregte und sympathische Filme zu drehen.

 Auch wenn seine Rachetrilogie nach dem überzuckerten Lady Vengeance abgeschlossen ist, handeln Park Chan-Wooks Filme auch weiterhin von Menschen, die die Vergangenheit heimsucht und umtreibt. Nur ist diesmal der Tonfall arg ins pittoresk-skurrile und erratische verruscht, nur eben nicht zum Vorteil.
Auch wenn seine Rachetrilogie nach dem überzuckerten Lady Vengeance abgeschlossen ist, handeln Park Chan-Wooks Filme auch weiterhin von Menschen, die die Vergangenheit heimsucht und umtreibt. Nur ist diesmal der Tonfall arg ins pittoresk-skurrile und erratische verruscht, nur eben nicht zum Vorteil. In der diesmaligen Psychoschau geht es, wie zu erahnen war, um ein junges Mädchen, das sich für einen Cyborg hält. Warum und wieso erfahren wir im versöhnlichen Schluss, der eine Psychogenese mehr oder weniger widerstandsfrei im filmischen Rahmen ausartikuliert und das vorangegangene nachträglich mit Sinn füllt. Das Vorangegangene springt arbiträr zwischen Innen- und Außenwelt der Protagonisten, verfolgt ihren Weg in die Psychiatrie und wirbelt dabei Imagination, Psychose und objektive Welt munter durcheinander.
Für Psychosen ganz allgemein interessiert sich Park Chan-Wook dabei natürlich nicht im Geringsten; Verrückte sind verrückt, weil sie verrückt geworden sind. Das kann man zwar narrativ erklären, aber dies auch nur insofern, als dass dadurch der (somit reichlichst gemaßregelte) visuelle Anarchismus zahlreicher Sequenzen - am groteskesten die eine, in der der vorgebliche Cyborg endlich seine Batterien aufgefüllt hat und jetzt das gesamte Pflegepersonal mit Kugeln, die aus den Fingerkuppen kommen, hinrichten kann - im Nachhinein legitimiert wird.
Deutlich merkt man Park Chan-Wooks Bestreben, nach seinen drei blutigen und düsteren Rachefilmen nun endlich auch mal was für's Herz zu drehen: Am Ende steht ein Regenbogen. Zuweilen schimmert da auch der Ansatz einer herzigen Liebesgeschichte durch, alleine, Park Chan-Wook besteht auf seinen zweifelhaften Autorismus und schiebt vor jeden noch so kleinen Moment einen großen bildtechnischen Einfall, der mal gelingt, mal nicht. In der jeweiligen Ausarbeitung ist's dann eh herzlich egal. Patient tot, Anstalt geschlossen.

 Steven Soderberghs Versuch, den klassischen Hollywood-Code der 40er Jahre nach Maßgabe von Michael Curtiz mit heutigen Mitteln zu simulieren, schlägt leider fehl, und dies auf mehreren Ebenen. Seltsam unkonzentriert, ja orientierungslos scheint er zu Werke gegangen zu sein.
Steven Soderberghs Versuch, den klassischen Hollywood-Code der 40er Jahre nach Maßgabe von Michael Curtiz mit heutigen Mitteln zu simulieren, schlägt leider fehl, und dies auf mehreren Ebenen. Seltsam unkonzentriert, ja orientierungslos scheint er zu Werke gegangen zu sein.Die Geschichte ist behäbig und muss dem offenkundigen Zweck des linksliberalen Gespanns Clooney/Soderbergh – unterstreichen, dass ja auch die USA sich nach dem 2. Weltkrieg nicht immer ganz korrekt verhielt – eher untergebogen werden, entsprechend bemüht wirkt das Ganze. Situiert ist sie im Berlin unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, ihren Beschluss findet sie zum Zeitpunkt des Atombombenabwurfs über Japan. Hier – in diesem kurzen Zwischenflimmern der Geschichte - wurden, so die These aus Good German, die Weichenstellungen für die Zukunft gestellt, „für die nächsten 100 Jahre“, wie eine Figur mal sagt, und man glaubt das Soderbergh auch gerne, evident ist's sowieso, allein: Wie sich das dorthin bemüht, zu diesem Punkt, ist eine rechte Qual. Zwischen V2-Entwicklung und Atombomben, zwischen guten Amerikanern und bösen Nazis, die man für Gutes nutzen könnte (und wenn es nur dieses wäre, dass eben die Russen sie nicht bekommen), passt noch immer eine abgehangene Liebesgeschichte im Dreieck, deren prominenteste Spitze Elena Brandt bildet, die von Cate Blanchett, viel Make-Up und der Gesichtsausleuchtung gespielt wird. Der eine der beiden Männer ist Clooney, hier ein Auslandskorrespondent, der vormals schon in Berlin gelebt hatte und einstmaliger Liebhaber Elenas ist; der andere ist Tully, gespielt von Tobey Maguire, ein fieser Opportunist, dem die Trümmerwelt Berlins, aus der er seine Vorteile zieht, gerade recht kommt.
Zu dritt sind sie verstrickt in eine Geschichte, die Clooney erst nach und nach herausfindet, nachdem sein Konkurrent um Elenas Gunst, unweit des Orts der Potsdamer Konkurrenz, erschossen aufgefunden wird. Die Geheimnisse, die er lüftet, stellen auch Elena in ein neues Licht. Und ihren Gatten, einen Mathematiker, der angeblich gefallen, womöglich aber doch am Leben ist und von allen Seiten der nunmehr ideologische Stellung gegeneinander beziehenden Alliierten händeringend gesucht wird ...
Was Soderbergh nun wirklich in die Trümmer des Dritten Reiches gezogen hat, bleibt rätselhaft. Die Geschichte kann's kaum sein, und ihre Aussage erschöpft sich ohnehin schon in Folklore. Es mag da ein Anliegen gegeben haben – die USA ist nicht so super, wie sie sich gibt, sie hat den größten Opportunisten und Verbrechern zum Eigennutz Schutz und Heimat geboten -, doch seine Auflösung ins Curtiz-gespeiste Pastiche verliert sich ins Triviale, Gemüt_liche. Geradewegs haarsträubend sind denn auch mit Pathos schwangere und dennoch so unglaublich hohle Sätze wie die aus Clooneys Munde, wenn er die Bürokraten der eigenen Streitkraft, die im Mordfall Tully Ermittlung nicht ins Auge fassen, anmahnt, dass es doch gerade diese Sache gewesen sei – Mord, der nicht verfolgt wird -, dessentwegen man in den Krieg eingetreten war; gerade so, als handele es sich bei der Shoah um eine allenfalls kriminalistisch spezifische Petitesse.
Bleibt als Rückzugspunkt die Ästhetik. Vielleicht wollte Soderbergh der Welt nur einmal zeigen, dass er Curtiz nicht nur mag, sondern selbst auch so inszenieren kann. Er kann es nicht. The Good German ist zwar eine Abfolge von Reminiszenzen und nostalgisch gewendeter icons, voller Zitate und lichtgesetzter Anschmiegungen; mühevoll wurden historische Archivaufnahmen von Berliner Straßen aus der Phase unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ins Filmbild entweder gestanzt oder in seinen Fluß einfach hineingeschoben – dann darf in einem Einschub Stalin durch's Filmbild laufen oder Clooney fährt vor Rückprojektionen, die Entzücken ob solcher nostalgischen Technik hervorrufen sollen. Dies aber ist keine ästhetische Annäherung oder gar Reflexion, sondern bloß ausgestelltes Gimmick: Wer hinschaut, sieht Plansequenzen, die in den 40ern derart schwungvoll nur schwerlich gelungen wären; die Schnittfrequenz ist zu hoch, gerade in Stakkato-Szenen der Gewalt; auch das grobe Korn alten Filmmaterials, die mangelnde Detailschärfe des klassischen Hollywood-Kinos schien man heutigem Publikum kaum zumuten wollen: The Good German verweist mit seiner schier endlosen Anzahl von Grauabstufungen geradewegs auf Sin City und das digitale Kino. Nicht zuletzt wäre eine Simulation auch eine Frage des Formats gewesen: Die bildästhetische Spezifik einer jeden Filmepoche lässt sich schwerlich ohne Berücksichtigung der Seitenverhältnisse und den daraus folgernden Problemstellungen und -lösungen begreifen.Statt des (angestaubten) Academy Formats aber gibt es eher etwas aktuelleres 1,66:1.
Also Virtuosentum als eigentlicher Beweggrund, nur mag man dies Soderbergh eigentlich nicht recht zutrauen. Und dennoch wirkt The Good German immer geradezu aufdringlich auf's glossy image hininszeniert. In ihnen verschwindet alles, mithin der ganze Film. Abblende, Buh-Rufe im Berlinale-Palast, selten so berechtigt.

"Ich war nicht der einzige Schauspieler Deutschlands, der Pornos synchronisiert hat. Heiner gehört auch dazu. Schreiben Sie das bitte als Aufmacher."Sagt heute der Schweigers Til über den Lauterbachs Heiner in der Erstausgabe der Vanity Fair, was SpOn prompt zu zitieren weiß.
Dass die Geburt des deutschen Gegenwartskinos nur aus dem Geiste des deutschen Sexfilms zu verstehen ist, ist ja nun hinlänglich bekannt, filmtagebuch zerrt deshalb noch weit schrecklichere Geheimnisse ans erbarmungslose Tageslicht: Heiner Lauterbach stellte seine Stimme nämlich auch dem Gedärme- und Hasenleichenfilm Man-Eater zur Verfügung, gedreht vom umtriebigsten aller Splatter-, Horror- und Pornoregisseure Italiens, Joe D'Amato - und in Deutschland ist dieser Streifen nun auch noch per staatsanwaltlichen Beschluss verboten und weggesperrt. Eine echte Gefahr für die deutsche
Zugleich kommt Man-Eater auch eine kulturhistorisch prominente Position in Deutschland zu, entflammte sich doch mithin an diesem (so ganz unter uns Chorschwestern: eher etwas langweiligen) Film die hiesige Videodebatte in den frühen 80er Jahren, Talkrunden im ÖR-TV (mit, wenn ich das richtig überliefert bekommen habe, Ausschnitten aus besagtem Machwerk) inklusive. Mit dem bekannten Ergebnis: In keinem Land der westlichen Hemisphäre ist der Jugendschutz so dümmlich übertrieben wie in Deutschland.
Und da kommt der Schweiger mit ollen Pornos an.
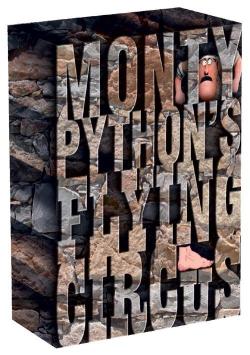
Ungelogen die beste Nachricht seit langem: Sony Pictures bringt Ende März Monty Python's Flying Circus als komplettes, 7 DVDs umfassendes Box-Set auf den Markt. Spieldauer: über 1300 Minuten. Well, there'll certainly be some car door slamming in the streets of Kensington tonight.
Mein Jubel über diese wirklich seit Jahren herbeigesehnte Box kennt, ernsthaft, keine Grenzen. Soetwas wie diese Serie hat es in der Geschichte des Fernsehens wirklich nur ein einziges Mal gegeben. Wer die Welt ein bisschen weit verstehen will, muss diese Serie gesehen haben, die sie bis zur Kenntlichkeit verfremdet. Daneben stellt sie, als Gesamtwerk, eines der großen philosophischen Werke der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dar. Wie wunderbar, dass dieses nun in Bälde komplett und in hoffentlich guter Qualität vorliegt (besser wohl jedenfalls als meine Longplay-VHS-Aufnahmen von zum Teil dunne dazumal).
Wer gerade etwas Zeit mitbringt, kann ja jetzt einfach noch diese an der Humboldt Universität entstandene Magisterarbeit lesen.
Sei's drum, diesmal fand das erste "seltsame Ereignis" bereits am 05. Februar statt. Drei Tage vor Startschuss. Es trug sich zu in den oberen Etagen des Filmhauses, wo die dffb ihre Bibliothek hat. Dorthin wollte ich (natürlich überfällige) Bücher zurücktragen, doch wie ich so vor verschlossener Türe stand und innen drin mir zwei Huscherln, wie sie nur in Bibliotheken
"Sie können sich hier umschauen" sagt der gute Mann sichtlich unbeholfen, was beide Damen zu einer Wiedergabe schönster japanischer Silben bewegt, die weder ich, noch sichtlich Terhechte verstand. "You can go around here" versucht's er dann und die eine Dame bespricht dann wieder sehr, sehr lange was mit der anderen. Offenbar fungiert sie als eine Art Dolmetscherin, was ja keinen Sinn macht. Jedenfalls spricht sie mit Terhechte, dann mit ihrer Begleitung, immer abwechselnd.
Das Ganze dauert so seine Zeit und ich lasse derweil per Knopfdruck nach dem Aufzug rufen, auf dass er mich wieder in niedere, ausgangsnahe Geschosse bringen möge. Irgendwas verstehe ich dann, "Domo arigato" sagt die eine, und unter vielen Verbeugungen lassen diese beiden einen erleichterten, aber auch leicht verwirrt wirkenden Forumsleiter zurück. Ich betrete den derweil angekommenen Aufzug, als die beiden mich ansprechen und "down? down? down?" sagen. Ich so: "Down, down" und alles ist gut. Die Damen betreten den Aufzug, Terhechte winkt, die beiden verbeugen sich, mehrmals. Sein Angebot, sich umzuschauen, schienen sie offenbar nicht nutzen zu wollen.
Kaum sind wir aus seinem Blickfeld entschwunden, fangen beide hektisch das Reden an. Sie beachten mich gar nicht weiter, finde ich okay so.
Ich weiß ja auch nicht. Aber es war schon hübsch entrückend. Bibliothek geschlossen, kein Mensch weit und breit, nur wir vier eben, über dem Potsdamer Platz. Einen Moment lang gefällt mir der Gedanker, dass diese beiden, die da vor mir im Aufzug unentwegt in dieser wundervollen Sprache schnattern, große alte Damen des klassischen japanischen Kinos sind, die hier jetzt eben nur keiner kennt. Inkognito aufs Festival.
[via]
Ganz am Rande aber gibt es alljährlich eine Kategorie, die mir schon sehr am Herzen liegt: Die des animierten Kurzfilms. Wie überhaupt Animations- und Kurzfilm schon je für sich genommen eigentlich was ganz, ganz tolles sind, was man unbedingt häufiger sehen, drüber schreiben müsste.
Dieses Jahr gibt es Neues von Scrat, diesem Hörnchen mit dem Nüsschen aus Ice Age, das in den Trailern zu den Filmen der Reihe schon immer besonders viel Freude macht. Da die Eiszeit naturgemäß ein limitiertes Szenario für Verwicklungen rund um Nüsse bietet, haben sich die Macher diesmal einen kleinen Kniff einfallen lassen: Scrat jagt der Nuss quer durch alle Zeiten hinterher - und hoppt dabei von einem Großereignis der Geschichte zum nächsten, vorwärts, rückwärts, kein Problem.
Da wird man vor einem Film wieder zum Kind, wenn man das sieht. Ist ja auch gut so. Hier kann man sich das ansehen.
 Über Angela Schanelecs Marseille bin ich mir noch im Unklaren. Teilt man den Film in drei Teile, dann haben wir Marselle, dann Berlin, und schließlich nochmals, wenn auch viel kürzer, Marseille. Teil zwei und drei beginnen mit einer fast schockartigen Montage, die gerade nicht verbindet, sondern Lücken aufklaffen lässt, die schlagartig ins Bewusstein gerückt werden. Überhaupt, es fehlt in Marseille weit mehr, als da ist (in dieser Geste, würde ich jetzt schnell sagen, ist wohl auch sein filmpolitisches Projekt zu verstehen; wenn in klassischeren Konzeptionen von Film eine Welt überhaupt erst durch das Kameraauge etabliert und strukturier wird, geht hier gerade Welt durch Kamerazuschnitt verloren, weil die Kamera /inmitten/ des Vorgefundenen, und nicht durch sie Etablierten steht). Wenn Sophie, die Figur, um die es in der Hauptsache geht, im ersten Drittel durch Marseille schlendert, eine ihr fremde Stadt, in die sie aus Berlin gefahren ist, aus Gründen, die nie /ganz/ ersichtlich werden, und sie dabei die Umgebung ja fast schon ertastet (mit den Augen, mit dem Fotoapparat), dann sehen wir zwar /sie/, aber nicht, /was/ sie sieht. Auffällig häufig, fast immer eigentlich, blickt sie, deutlich zwar beobachtend, aber auch merkwürdig indifferent, in das Off des Bildes, das für uns im Unklaren bleibt. Sie macht Fotos, an einer Stelle wird es ihr untersagt (warum, bleibt ein Geheimnis). Dass wir das nicht sehen, was sie sieht, wird in einem Moment zugespitzt, wenn das Filmbild eine belebte Kreuzung zeigt. Mitten auf dieser Kreuzung: Eine Art Verkehrsinsel, auf der Sophie steht. Gerade so lässt sich auf diese Distanz noch erkennen, dass sie den Fotoapparat hebt - und in unsere Richtung fotografiert. Was ist da, hinter unserem Rücken? Eine Straße vermutlich. Später sagt sie das auch, danach gefragt, was sie fotografiere: Straßen. Straßen, deren Präsenz vor allem durch die Tonspur vermittelt wird, deren Relevanz für den ästhetischen Eindruck in diesem Falle der des Bildes mindestens ebenbürtig ist. Die Tonspur nimmt alles auf, was im Off nicht zu sehen ist, der Ton ist immer und völlig präsent, seinem Gegenstand gegenüber, scheinbar, indifferent. Er bildet einen Mantel, einen Kokon, der die äußere Welt fast schon taktil abtastbar erscheinen lässt. Zugleich ein Rauschen, das einbettet und Distanzen aufbaut: Schockartig fällt dann die deutsche Sprache in den Film, nach etwa einer Dreiviertelstunde. Plötzlich ist alles anders. Auch Sophie klingt, als träte sie in diesem Film überhaupt erst hier zum ersten Male auf.
Über Angela Schanelecs Marseille bin ich mir noch im Unklaren. Teilt man den Film in drei Teile, dann haben wir Marselle, dann Berlin, und schließlich nochmals, wenn auch viel kürzer, Marseille. Teil zwei und drei beginnen mit einer fast schockartigen Montage, die gerade nicht verbindet, sondern Lücken aufklaffen lässt, die schlagartig ins Bewusstein gerückt werden. Überhaupt, es fehlt in Marseille weit mehr, als da ist (in dieser Geste, würde ich jetzt schnell sagen, ist wohl auch sein filmpolitisches Projekt zu verstehen; wenn in klassischeren Konzeptionen von Film eine Welt überhaupt erst durch das Kameraauge etabliert und strukturier wird, geht hier gerade Welt durch Kamerazuschnitt verloren, weil die Kamera /inmitten/ des Vorgefundenen, und nicht durch sie Etablierten steht). Wenn Sophie, die Figur, um die es in der Hauptsache geht, im ersten Drittel durch Marseille schlendert, eine ihr fremde Stadt, in die sie aus Berlin gefahren ist, aus Gründen, die nie /ganz/ ersichtlich werden, und sie dabei die Umgebung ja fast schon ertastet (mit den Augen, mit dem Fotoapparat), dann sehen wir zwar /sie/, aber nicht, /was/ sie sieht. Auffällig häufig, fast immer eigentlich, blickt sie, deutlich zwar beobachtend, aber auch merkwürdig indifferent, in das Off des Bildes, das für uns im Unklaren bleibt. Sie macht Fotos, an einer Stelle wird es ihr untersagt (warum, bleibt ein Geheimnis). Dass wir das nicht sehen, was sie sieht, wird in einem Moment zugespitzt, wenn das Filmbild eine belebte Kreuzung zeigt. Mitten auf dieser Kreuzung: Eine Art Verkehrsinsel, auf der Sophie steht. Gerade so lässt sich auf diese Distanz noch erkennen, dass sie den Fotoapparat hebt - und in unsere Richtung fotografiert. Was ist da, hinter unserem Rücken? Eine Straße vermutlich. Später sagt sie das auch, danach gefragt, was sie fotografiere: Straßen. Straßen, deren Präsenz vor allem durch die Tonspur vermittelt wird, deren Relevanz für den ästhetischen Eindruck in diesem Falle der des Bildes mindestens ebenbürtig ist. Die Tonspur nimmt alles auf, was im Off nicht zu sehen ist, der Ton ist immer und völlig präsent, seinem Gegenstand gegenüber, scheinbar, indifferent. Er bildet einen Mantel, einen Kokon, der die äußere Welt fast schon taktil abtastbar erscheinen lässt. Zugleich ein Rauschen, das einbettet und Distanzen aufbaut: Schockartig fällt dann die deutsche Sprache in den Film, nach etwa einer Dreiviertelstunde. Plötzlich ist alles anders. Auch Sophie klingt, als träte sie in diesem Film überhaupt erst hier zum ersten Male auf. Aber ich bin mir noch, wie gesagt, im Unklaren. Das erste Drittel ist famos, nichts weniger. Das letzte Drittel - seine Dauer fällt knapp aus - steht dem in nichts nach. Die Sequenz in Berlin aber, der Mittelteil, fällt zäh aus. Dies ist gewollt, ganz sicher. Sophies persönliches Eingebettet-Sein - die Quasi-Syntax ihres sozialen Gefüges -, der Filz an Menschen und Problemen, aus dem sie stammt, der in Marseille abwesend in Permanenz war, wo sie durch eine Welt ging, in deren Mitte sie zwar stand (daher auch die radikale Auflösung der Einstellungen und der Ton: Mitten drin, doch nicht dabei), zu sehr sie aber doch nicht zählt, diese Ummantelung also aus Beziehungen und Alltag zieht den Drang zur Flucht ganz automatisch nach sich (gut: Keine Romantik, kein Pathos, alles bleibt in der Schwebe, zwischen zwei Bildern liegt hier die Welt). Trotzdem gerinnt der Film an diesen Stellen für meine Begriffe über das rein Funktionale solcher Spröde hinaus; Bürgersöhne und -töchter sprechen Bürgersätze ins Leere hinein. Die eine sagt, man bräuchte einen Landarzt, der immer um einen herum ist, der einen kennt; zu überdeutlich wird hier auf die Zerschlagenheit der Beziehungen angespielt, eine Nuance zu stark tritt hier die Tradition des deutschen Kunstfilms auf.
Hingegen, was mit der Kamera geschieht - oder was hier nicht geschieht - ist bei aller Strenge großartig: Ihre Statik ist nicht kalkuliertes Aushängeschild, jeder Einsatz der Formmittel und -technik Ergebnis einer konzentrierten Reflexion. Man sieht das selten so, selten waren unbewegte Einstellungen über Minuten hinweg spannender, weil man immer mit dem Umschnitt rechnet, der dann doch nicht kommt, und jeder Umschnitt, der dann doch kommt, schlagartig Bedeutung generiert.
Doch wie gesagt, der Ton ist es, der diesen Film für mich am spannendsten macht. Man könnte die Augen schließen - und hätte ein fieldrecording, mit aller Sinnlichkeit, die diese akustische Strategie auszeichnet. Was ich mir gewünscht hätte: Kein Berlin dazwischen, ein Mehr der fremden Frau in einer fremden Stadt, nicht unbedingt die Katastrophe am Ende des Films (die aber, natürlich, an diese Stelle passt), zwei Stunden erleben, wie eine neue Umgebung ertastet wird, die Spannung jeder Geste, jedes Moments, im Widerstreit zwischen Zeigen und Nicht-Zeigen-Wollen. Dieser andere Film, der als Potenzial in Marseille liegt, wird hoffentlich noch zu sehen sein.
weiterführende links:
» imdb ~ filmz.de
» movie blog search engine ~ movie magazine search engine
» marseille-notizen der regisseurin
zur erhältlichkeit:
Der Film ist im Rahmen der Revolver Edition der Filmzeitschrift Revolver beim Label Filmgalerie 451 als schlicht konzipierte DVD erschienen. In Berlin ist sie bei den üblichen Anlaufstellen - Videodrom, Filmkunst und in einigen weiteren Videotheken - für einen geringen Preis zu entleihen. In Ausgabe 13 der Zeitschrift findet sich ein ausführliches Interview mit der Regisseurin, das als Quasi-Bonus zur Veröffentlichung zu verstehen ist.
Man kann diesen online lesen (derzeit mit Zwischenschaltung, weil die Jungle World noch immer Abonnenten braucht, ganz unten kann man aber weiter klicken und kommt an der richtigen Stelle raus, auch wenn man ein Abo schon ins Auge fassen sollte!) und er befasst sich mit einem der schönsten Filme der letzten Jahre, die aus den USA zu uns gekommen sind, mit Punch-Drunk Love. Er schließt mit den schönen Sätzen: "Machen Sie sich eine Sternstunde. Gehen Sie ins Kino."
New Filmkritik zitiert Nettelbecks Selbstauskunft aus den 60er Jahren.
Zu häufig haben sie ihre Leser in die falschen Filme geschickt, zu narzisstisch haben sie das Bild ihrer cineastischen Kompetenz gezeichnet und dabei ihre zentrale Aufgabe vergessen, nämlich Entscheidungshilfen für potenzielle Zuschauer zu bieten. Statt sich in den Dienst der Filme zu stellen, haben sie umgekehrt diese für ihre Selbstdarstellung in Dienst genommen. Der heutige Kritiker schreibt am liebsten über sich selbst, der Film ist da nur beiläufiger Anlass.
könnte ich, ums mal gänzlich unnarzisstisch in meinem Mutterdialekt auszudrücken, "glatt die Wänd' naufgeh'".
Mit Verlaub, was für ein Riesenquatsch. Wer so schreibt, schreibt nicht über Filmkritik, sondern über outgesourcte PR-Einsatzkommandos, die man, als Anbieter der Ware Film, obendrein noch nicht einmal auf die Gehaltsliste setzen muss. Dass der Zustand hiesiger Filmkritik, zumindest in ihren bezahltesten Ausläufern, von innen her zur Morschheit neigt, ist dabei gänzlich unbestritten, was allerdings eher am zweifelhaften Gebaren von Ressortleitern liegt, die Hinz und Kunz in Pressevorführungen schicken und wenn sie noch so wenig Ahnung von Film haben. Dass diese Schreiberlinge - mehr sind sie ja wirklich nicht - noch obendrein die Haltung des Finanz- und Konsumberaters, die auch Rohrbach sich erwünscht, schon auf eine dermaßen erschreckende Weise in ihre "Schreibe" internalisiert haben, dass sie Film nurmehr auf Grund von Parametern wie "Spannung", "gute Schauspieler" und "witzig" beurteilen können und dabei noch den einen oder anderen rhetorischen Flachwitz einbauen, garniert mit ein bisschen Wichtigkeits-Kreolen (eine allerdings übliche Krankheit unter Journalisten), ist dabei schon längst alltäglich geworden; Film, so lautet der Tenor, ist eben gefühlig, ein Instant-Erfrischungsgetränk, mit oberflächlicher Abtastung zu meistern, bitte schön.
Schlicht und ergreifend gelogen - dreist gelogen! - ist die Behauptung, Filmkritik sei dazu da, dem Leser eine Entscheidungshilfe zu bieten, was er bitte sehen solle/wolle. Als ob ein Durchschnitts-Kinogänger, und gerade und besonders auch aus jenem leicht an-intellektualisiertem Spektrum, das sich Rohrbach wünscht, nicht von alleine wissen würde was a) ihn interessiert und b) ihn ansprechen wird. Ich wage zu behaupten, dass ein solcher Mensch, der sich einigermaßen um seinen Kinogenuss kümmert, in der Lage ist, schon angesichts eines Trailers eine Entscheidung zu treffen, ob ihm ein Film als Abendinvestition taugen könnte oder nicht. Wer anders argumentiert, behauptet, dass seine Mitmenschen obrigkeitshörige Deppen ohne eigenen Erfahrungs- und Ermessensraum sind.
Filmkritik ist keine Investitionsberatung. Das ist nicht ihre Funktion. Filmkritik kann vieles sein. Zuallererst eine Dokumentation von Erfahrung. Dann Speicher für Beobachtungen, Festhalten von Eindrücken und Auffälligkeiten. Nicht zuletzt wird der einzelne Film mit seinen ephemeren Qualitäten verankert in einem Netz aus Bedeutungen, Ansichten, Geschichten, Traditionen. Filmkritik ist Reden über einen Film - mit dem Vorteil einer dokumentierenden Speicherung der Auseinandersetzung. Sie dient nicht zuletzt der Nachwelt dazu, zu erfahren, was über Film und Filme gedacht wurde, wie sie gesehen wurden, wie sie in der Kultur widerhallten. Wer einen Film aus längst vergangenen Jahrzehnten sieht, wird sein besonderes Auftreten in der Semantik seines eigenen Hier und Jetzt erst wirklich /dann/ verstanden haben, wenn er zu Rate zieht, was über den Film - seinerzeit - gedacht/geredet/geschrieben wurde. Gute Filmkritik vermag einen Film in einer Weise zusätzlich aufzuschließen, dass andere Sichtweisen kommunizier- und teilbar werden (am liebsten lese ich deshalb Filmkritiken, die mir nicht nach meinem Gusto schreiben - sondern die mich in einer Weise konfronieren, die mich reicher werden lässt).
Filmkritik sollte auch niemals "sich in den Dienst der Filme" stellen, wie Rohrbach sich das hier flauschig zurecht imaginiert. Wir haben das schon zur Genüge in der Berichterstattung über "den deutschen Film", bei dem es als Indiz für Supidupi-Neo-Geilheit schon ausreicht, wenn er zahlenmäßig signifikant im landeseigenen A-Festival vertreten ist. Nein, "nicht im Dienst der Filme" steht die Filmkritik, sonst hieße sie ja PR-Agentur MediaCool oder so; sie steht, wenn nicht im Dienst der eigenen Erfahrung, so doch im Dienst der Sache des Films als solchem, Cinephilie heißt nicht "Filme gut finden", sondern Film. Dies schließt ein, dass man ihn überall da verteidigt, wo mit ihm Schindluder getrieben wird; dies heißt nicht unbedingt, dass man in altes und gänzlich ahistorisches Blockwartdenken (hier der böse US-Hochpreis-Film, da das gute Mümmel-Kino mit cineastischem Bonusstempelchen) verfällt.
Rohrbach spricht von "cineastischer Kompetenz", denen die Filmkritiker allzu oft verfallen seien. Dabei ist es ja überhaupt erst diese, die sein Schreiben und seine Wortmeldung überhaupt erst legitimiert und also die unabdingbare Grundlage seiner Arbeit bildet. Nicht ein /zuviel/ an "cineastischer Kompetenz" ist das Problem, sondern ganz klar ein /zuwenig/ derselben: Lieblos runtergeschusterte Texte ohne cinephilen Resonanzraum, die sich genauso gut auf ein "war gut" / "war nich so gut" reduzieren lassen könnten, Texte also, deren Lektüre kein Stück weit lohnt, weil es völlig gleichgültig ist, was da steht, weil sie keine Basis haben und also genauso gut das Gegenteil da stehen könnte (irgendeinen, dem der Film eben "nich so gut" gefallen hat, findet man schließlich immer). Wenn sich Filmkritik auf "cineastische Kompetenz" als Grundlage ihrer Arbeit final verabschieden würde, dann könnte man sie auch gleich vollkommen abschaffen. Dann setzt man sich einfach Freiwillige aus der Bevölkerung vorab in ein Kino, die halt ganz gerne mal 'nen Film schauen, und am Ende darf jeder auf ein elektronisches Abstimmgerät drücken:
- Super Film!
- Guter Film!
- Ging so, die Effekte hätten besser sein können!
- Hab mich gelangweilt
- Zu wenig Titten
- Scheißfilm
Das Ende wird dann allgemein kommuniziert. "76% der repräsentativen Zuschauer fanden diesen Film gelungen. 89% der Zuschauer, die diesen Film gelungen fanden, fanden auch die Filme X, Y und Z besonders gut. Auf Grundlage dieses Ergebnisses können Sie nun selbst entscheiden, ob Sie Ihre 3 Euro fuffzich am Kinotag in diesen Film für Ihre gediegene Unterhaltung investieren wollen!"
Film wird auf diese Weise zum BigMac, auf den sich alle einigen können. Schnell gefressen, schnell geschissen. Für das leicht an-intellektualisierte Kulturbürgertum gibt's dann noch etwas Distinktionskolorit, das sich ebenfalls so irgendwie berechnen lässt, muss man halt die Parameter abändern. Ist auch okay so, wenn das so gehandhabt wird - im Supermarkt weiß ich auch lieber vorab, was für Futter mich im Anschluss erwartet -, nur hat diese Domäne eben rein gar nichts mit Filmkritik zu tun. Wer fordert, dass Filmkritik in dieser Funktion tätig sein soll, der führt ein diebisches Projekt im Schilde: Er fordert, dass sich Filmkritik auf eine Weise verhalten soll, die ihre eigene Legitimität und Grundlage schrittweise abbaut, damit sie später nur umso leichter weggewischt werden kann.
Im übrigen gibt es ein ganz einfaches Mittel, sich nölige Kritiken vom Leibe zu halten. Gute Filme drehen.
»Ohne Fördergremien wie den Rotterdamer Hubert Bals Fund oder den Berliner World Cinema Fund könnten Autorenfilmer aus Thailand, Paraguay oder Kasachstan heute kaum mehr arbeiten. Aber welche Art von Film wird da gefördert? Und was bedeutet das für den Aufbau einer Filmindustrie im jeweiligen Land?«
Unter dem Titel Das Weltkino und die Eventkultur schreibt Simon Rothöhler (u.a. new filmkritik) heute in der taz vor dem Hintergrund der neuesten Arbeit des Thailänders Apichatpong Weerasethakul konzentriert, informiert und präzise über die vielfältigen und heiklen Beziehungen zwischen dem filmökonomischen und -politischen Zentrum des hiesigen Festival- und Förderwesens und dem an sich peripheren 'Weltkino' mit geförderter Repräsentationsfunktion.
Ich versteh' zwar kein Wort. Bzw. keinen Satz, das eine oder andere Wort kennt man ja doch so irgendwie. Klingt aber super. Als würden die rückwärts sprechen. Das Hörspiel, das ich gerade höre, hat was mit "G'schbenn'stRR" zu tun, glaube ich; ist also Grusel.
Schon eine eigene Sprache, das, ganz klar. Was ich immer wieder interessant finde, ist ja, dass das schriftsprachlich ja mehr oder weniger hochdeutsch ist; was dann aber, für meine Ohren jedenfalls, immer so vollkommen anders klingt - bis hin zum Moment, dass ich, beim bloßen Hören, die Waffen strecke.
[via]
Und zugleich der alte Traum, dass die Apparate ein "Mehr" entbergen könnten, das dem blanken Auge in Permanenz entgeht, und sei es Bewegung und Zeit als in sich unendlich gewundene Statik.
Ich bin ja mal gespannt, wie das so wird. So recht sinnvoll fand ich das filmportal.de bislang nämlich nicht, von gelegentlich dort entdeckten Dokumenten aus der Filmpublizistik (ältere, online ansonsten nicht abrufbare Texte, Reportagen und Essays aus diversen Filmzeitschriften) mal abgesehen. Schöner fände ich es überhaupt, wenn das Filmportal diese Stärke des Netzes - den schnellen Transport von Schriftgütern - betonen würde als sich als (vermutlich ohnehin nur mäßig interessanten) Konkurrent von archive.org, VideoGoogle und YouTube mit etwas kommerzieller Starthilfe für den deutschen Gegenwartsfilm zu gerieren. Aber mal schauen, vielleicht wird's ja doch prima.
Nachtrag: Ui, wie ich jetzt erst sehe, werden die Clips aus den Filmen - bislang beschränkt sich die Auswahl auf eine von Kinowelt/Arthaus besorgte Vorauswahl aus dem eigenen DVD-Repertoire - in der Tat via VideoGoogle eingebunden. Von dort aus könnten die Dateien dann auch als Videos in beispielsweise Weblogs eingebunden werden (zumindest ist der hierfür nötige Code auf VideoGoogle nicht von der uploadenden Instanz gesperrt worden - ein Versäumnis?). Dasselbe gilt für die Trailer. Das ebenfalls nun via filmportal.de abrufbare Kinomagazin der "Deutschen Welle" indes wird leider Gottes nur über das schrottige RealVideo-Format zur Verfügung gestellt - schade.
(Meine (schon ein paar Jahre alte) Rezension des Filmes hier.)
Haaresbreite, dachte ich. Noch nicht einmal, wenn man den kosmologischen Rahmen sieht. Haaresbreite wäre ja ein anderer Planet oder sowas. Da war ich dann schon wach, als ich das dachte, und blickte hoch an die Decke über mir, wie in solchen Filmen. Man stelle sich das vor, dachte ich, wäre das Ding da auf seiner langen Bahn auch nur irgendwann einmal für den minimalsten Bruchteil einer Sekunde einen Hauch zu stark in die Nähe eines Gravitationsfeldes geraten, dann wäre es womöglich auf uns niedergegangen; und wenn es, diese Annäherung zuviel, vor Milliarden Jahren geschehen wäre.
Am Nachmittag, der zu dem Zeitpunkt längst angebrochen war, noch überlegt, ob darüber nun wahnsinnig zu werden oder ein Roman darüber zu schreiben sei. Für letzteres entschieden, auch wenn das Quatsch ist, juvenil natürlich, dann aber Kaffee getrunken und mich überlebend gefühlt, erneut an Tunguska gedacht und dass Menschen, die an Horoskope glauben, die ersten sind, denen die unendliche Eitelkeit der Menschheit vorzuwerfen ist.

Wer an diesem und am nächsten Wochenende in München weilt, sollte sich ein paar herzallerliebste Kinotermine vormerken: Das nette, kleine - und weit über die Grenzen der Stadt hinaus berühmte - Werkstattkino zeigt dann einige Superverbrecher und Gleichgesinnte von der produktionsökonomischen Peripherie aus den 60er Jahren: Zum einen den ganz wunderbar charmanten Diabolik von Mario Bava und dann auch noch das türkische Pendant Kilink, der sich auf den Cat Suit noch ein Totenskelett gemalt hat.
Genaueres gibt der Wochenanzeiger her.
Besonders lesenswert ist die von Geoffrey Winthrop-Young und Nicholas Gane verfasste Einführung, die auf elf Seiten das ansonsten nur schwer zugängliche theoretische Werk Kittlers gelungen und nachvollziehbar umreißt. Winthrop-Young hat vor kurzem auch die im Junius Verlag erschienene Einführung in Kittlers Theoriewerk geschrieben, ist also ein ausgewiesener Kittler-Experte. Regelrecht faszinierend, zumindestens erhellend und in mancher Hinsicht auch bezeichnend, wenn nicht schon mehr als nur kontrovers, ist hingegen das ausführliche und konzentrierte Interview, das John Armitage 2003 mit Kittler in Berlin geführt hat - eine spannende, anregende, und oft genug konfliktstiftende Lektüre.
Von Kittler selbst wurden die beiden, allerdings ins Englische übersetzten, relativ jungen Aufsätze Farben und/oder Maschinen denken (in dem sein spezifischer Medien- und Technikmaterialismus quasi-programmatisch umrissen wird) und Zahl und Ziffer beigesteuert. Beide können als Updates, bzw. Ergänzungen zu seinen Aufsätzen in der meines Erachtens idealsten Einstiegspublikation Draculas Vermächtnis. Technische Schriften. betrachtet werden.
In weiteren Aufsätzen befassen sich schließlich Geoffrey Winthrop-Young (Kittler und Pink Floyd), Sybille Krämer (Time Axis Manipulation - Kittlers Medienkonzeption) und Claudia Breger (über seine derzeitige neo-helenische Phase) mit einzelnen Aspekten.
Ob es wohl ein bewusster Gegenpol ist? Der zweite Schwerpunkt der Ausgabe ist auf die feministische Kulturtheoretikerin Donna Haraway gelegt, mit deren Cyborg-Konzeptionen Kittler so einige Probleme hat, wie er immer wieder einstreut (und es sich auch implizit aus seinen Schriften ergibt).

Vier Hunde auf dem Asphalt. Maschinelles Lärmen aus dem Irgendwo. Plötzlich, unvermittelt von oben: Vier mechanische Arme einer, vermute ich, bizarren Maschine, mit der Straßen aufgerissen werden. Die Maschinenarme schlagen zu, heftig. Laut. Die Hunde rennen davon, jaulen. Ein starkes Bild, mit dem der Film beginnt, in ihm liegt eine Form von Archaik und Mythik, die durch das ganz reale, ästhetisch nicht überhöhte Bild gebrochen wird; dass man es nicht direkt versteht, ist wesentlicher Bestandteil seines Gelingens und darüber hinaus programmatisch für den sich diesem Bild anhängenden Film, in dem das Direkte und Beobachtete, das Gefüge der alltäglichen Realität bis zu einer diffusen Kenntlichkeit verfremdet wird. 4 ist der Debütfilm von Ilya Khrjanovsky, der ihn in Zusammenarbeit mit Vladimir Sorokin, einem Provokateur der russischen Gesellschaft, konzipiert hat, und allemal Erfahrung. In ihm überwuchern sich Bildertumore ins Groteske, zugleich ist er, vielleicht, einer der wichtigsten, wohl aussagekräftigsten, zumindest aber bemerkenswertesten Filme aus/über Russland der letzten Jahre.
Dreh- und Angelpunkt ist ein nächtliches Gespräch an einem Tresen einer Bar, in irgend einer größeren russischen Stadt. Drei finden sich ein, der vierte ist der Barkeeper, der im wesentlichen aber mit einnicken beschäftigt ist. Zwei Männer, eine Frau, sie vermutlich Prostituierte, jedenfalls wohl keine, die in Werbung macht, wie sie sagt, der eine vorgeblich in der Administration des russischen Präsidenten beschäftigt, in echt jedoch nur ein mafiöser Gammelfleischhändler, dessen kartografierte Businesswelt bald in sich zusammenbricht, wenn er erstmals von der Existenz kugelrunder Ferkel erfährt, der letzte schließlich Pianostimmer, der allerdings vorgibt, in ein weit in den Stalinismus zurückreichendes Klonprojekt jenseits administrativer Kenntnis von ganz oben verstrickt zu sein, und dabei sehr deutlich in den Raum stellt, dass die einst noch hinter dem Eisernen Vorhang gezüchteten "Doubles" längst schon massenhaft in der Gesellschaft angekommen seien. Die Ziffer 4, sagt jener letzter, sei schließlich diejenige, die mythologisch und kulturell am wenigsten aufgeladen sei: 1, 2, 3, 7 - undsoweiter - alle belegt, aufgeladen, mythologisiert. Die 4 hingegen ist die reine Funktionalität; vier Beine hat der Tisch - und vier Kanten, sagt man sich als Zuschauer, fast jedes Industrieprodukt.
Das Gespräch dauert lang, entzündet sich an Small Talk und ist streng funktional gefilmt. Es führt vom Tresenplausch direkt in die Zone, die schmerzt, in das Unterirdische jeder Gesellschaft, dorthin, wo man das Gespräch beendet, aufsteht und vondannen zieht. In dieser Form bildet es das Auge des Sturms, der sich in den ersten Filmbildern andeutet - und mit dem er - lange, schmerzvoll - enden wird. Weit draußen in der russischen Provinz, in einer Art Kolonie der alten Vetteln, die mit ihren ganz eigenen Psychosen zwischen Stützstrümpfen, gekautem Brot und verwelkten Titten das Leben zur Hölle umformen.
Provinz und Stadt, Straße und tiefste Keller (in denen Tierleichen seit den 60er Jahren gehortet werden - es hat hier 28 Grad unter Null, die kann man noch verkaufen!) - in einer Art Schuss-/Gegenschussverfahren (das ist durchaus wörtlich zu nehmen; wo man hier hinblickt: man will den Blick abwenden) faltet 4 eine eigenartige mentale Karte der gegenwärtigen russischen Gesellschaft auf, ohne dabei aber didaktisch, essayistisch oder gar analytisch vorzugehen; man muss ihm dies danken. Khrjanovsky/Sorokin verfolgen eine Strategie der Eskalation, die jedoch nie das bloße Bersten sucht (die Kamera weiß, was sie tut, immer), sondern, sozusagen, nach Methode einer kontrollierten Sprengung vorgeht.
Das Ergebnis ist das Paradox eines surreal flirrenden Realismus: Quasi-instinktiv /weiß/ man, dass dieser Film sich mit höchster Relevanz zum Zustand des gegenwärtig gärenden Russlands verhält, ohne dass man konkret benennen könnte, wie. Wenn, wie Brecht das richtig gesagt hat, die Fotografie einer Fabrik uns noch nichts über den Kapitalismus sagt, dann zieht 4 - weit abseits bloß abgefilmter Begebenheiten - mit geschliffenem Skalpell tief ins Gewebe einer Gesellschaft, die vor den Trümmern der eigenen Geschichte steht und sich deshalb in Permanenz transformiert. Das Umspannende einer derart disparaten Kultur, die sich vielleicht am ehesten mittels des schönen englischen Wortes vast ausdrücken lässt, versucht 4 in den Blick zu kriegen.
Speaking of Geschichte. Tarkowskij war vielleicht derjenige Regisseur, der einen Moment zumindest der russischen Mentalitätsgeschichte unter Umständen am prägnantesten ins Filmbild übersetzt hat. 4 ist übervoll mit zumindest ikonischen Anspielungen auf sein Werk: Vor allem Stalker und Solaris kommen einem immer wieder in den Sinn. Doch im Unterschied zu dem mexikanischen Regisseur Carlos Reygadas, der sich in Japón ganz offenkundig an die Tarkowskij'sche Ästhetik angeschmiegt hat, sucht 4 nicht die cinephile Liebkosung, sondern betont das Moment des Aufbrechens und der Inversion: Wenn der Gammelfleisch-Sohn nach Hause kommt, fällt der psychotische Hygiene-Vater auf die Knie und schmiegt sein Gesicht an des Sohnes Rumpf - eine ikonisch direkte Umkehrung des Schlussbildes aus Tarkowskijs Lem-Adaption. Und die Hunde rennen draußen vor den Türen über vor Nässe glitzernde Straßen, als wäre die Welt überflutet worden wie die Gemäuer in der Zone, während am nebligen Horizont über winterlich vermatschten Seepfützen die Türme der Atomkraftwerke in sich ruhen.
4 entlässt einen mit Rätseln, Andeutungen, nicht zu Ende gedachten Sackgassen und Ekel allenthalben. Er bietet kein hermeneutisch zu entschlüsselndes "Paket" an, vielmehr lässt er Gedanken fließen, ohne ins bloß delirierende Assoziieren zu verfallen. Eine Welt wird etablert, die ganz alltäglich ist und von der Kamera nie überhöht wird, und doch ist sie bizarr und jenseitig. Momente des Dokumentarischen, fast schon Ethnografischen, stehen neben offenkundig Fiktionalem. Doch alles ist aus einem Guss, folgt einer eigenständigen Syntax. 4 ist einer der spannendsten und vielleicht, was die Filmkunst betrifft, wichtigsten Filme der letzten Jahre.
weiterführende Links:
» imdb ~ offizielle website
» movie magazine search engine ~ movie blog search engine
» kinokultura.com ~ jump-cut.de ~ taz ~ senses of cinema ~ rouge
Zur Erhältlichkeit:
Der auf internationalen Festivals ausgezeichnete und von der internationalen Kritik gefeierte Film ist in Deutschland - wen sollte dies auch wundern - weder im Kino gelaufen, noch auf DVD erschienen. Eine englisch untertitelte DVD lässt sich mittels Eigenimport aus Großbritannien beziehen. In Berlin kann der Film in den Programmvideotheken Videodrom (Kreuzberg) und Filmkunst (Friedrichshain) entliehen werden.
Is' wohl klar, wem ich die Daumen drücke.
